Für echte Diskussionen, auch im Fernsehen
08:38 Minuten
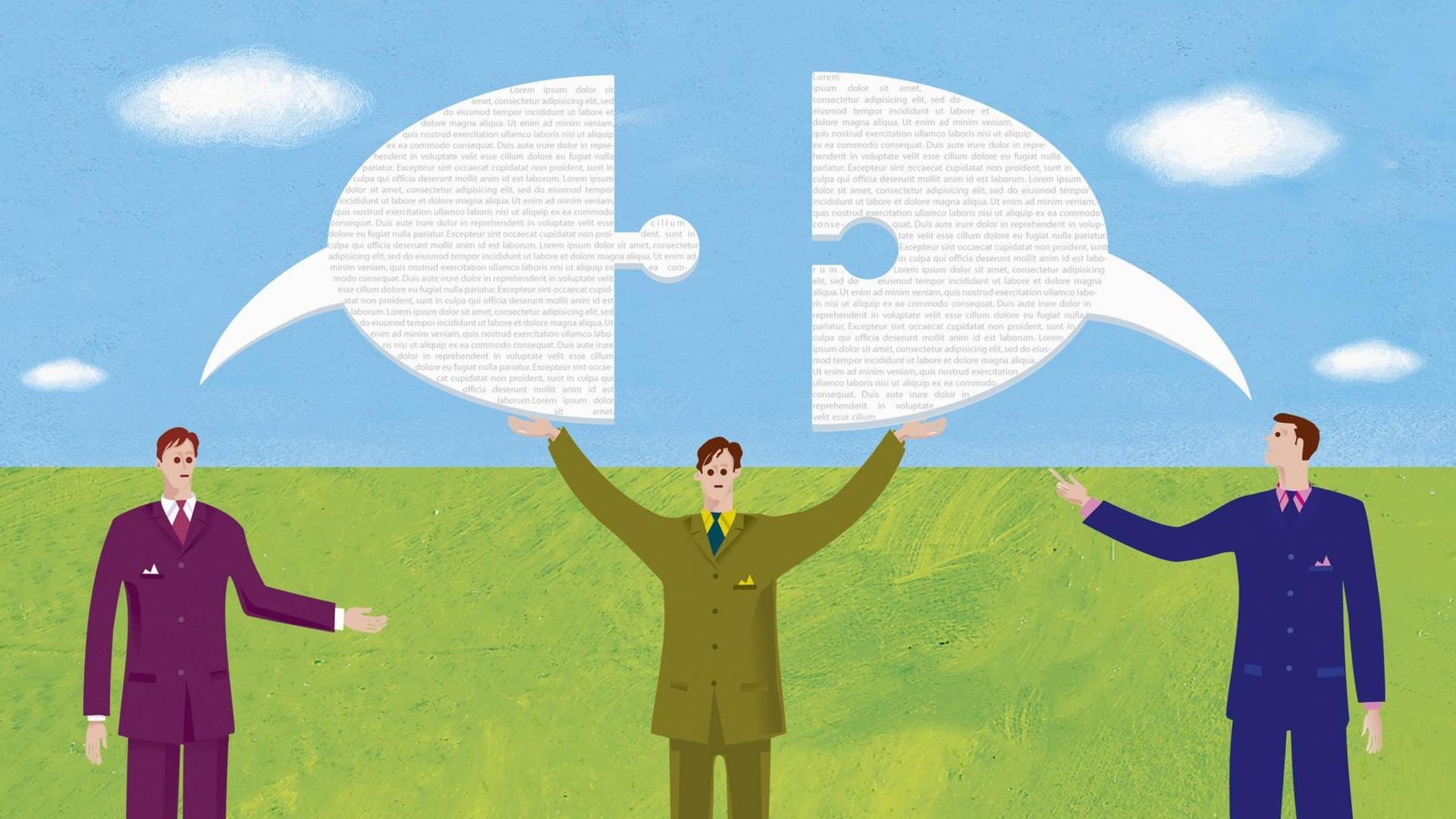
Öffentlich-rechtliche Talkshows sollten eine viel offenere Diskussionskultur pflegen, meint der Autor Oliver Weber. Derzeit seien die Talkshows durchgeplant und wenig erhellend. Er empfiehlt Gäste, "mit denen einiges schief gehen kann".
Ob Plasberg, Maischberger, Illner oder Will – die öffentlich-rechtlichen Talkshows stehen regelmäßig in der Kritik: Fallen sich in einer Sendung die Gäste dauernd ins Wort, ist von "Krawalltalk" die Rede. Dürfen die Teilnehmer ihre Gedanken länger ausformulieren, wird bemängelt, dass keine Debatte entstanden sei.
In seiner Streitschrift "Talkshows hassen – Ein letztes Krisengespräch" übt nun auch der 22-jährige Volkswirt und Politologe Oliver Weber scharfe Kritik an den Talkformaten. Er kritisiert vor allem drei Punkte an den Sendungen, die er für sein Buch analysiert hat: "die Wiederholung von Gästen, die Wiederholung von Themen und eine Art von Sprache, die Diskussionen nicht mehr wirklich zugelassen hat."
Die schlechte Diskussionskultur in Talkshows könne man am wenigsten den politischen Gästen vorwerfen: Ihr Interesse sei es, Mehrheiten zu gewinnen. "Da ist eine ausgefeilte Argumentation manchmal ganz hilfreich, aber in der Regel kommt es darauf an, die Botschaft sehr pointiert zu wiederholen", sagt Weber. Vorwerfen müsse man vielmehr den Moderatoren und Redaktionen, dass sie den Politikern nichts entgegenzusetzen hätten.
Alles durchgeplant, kein Widerspruch
Weber wendet sich gegen die "enge Logik" der Talkshows. Er wünscht sich eine Diskussion, in der es "nicht darum geht, dass Politiker ihre Botschaften wiederholend ins Gespräch werfen und Experten mit ihrer Analyse sozusagen noch eine andere Position vertreten". Stattdessen plädiert er für einen ergebnisoffenen Austausch unter den Gästen. Ihm geht es darum, "dass man nicht nur einen Standpunkt vertritt, sondern dass man diesen Standpunkt rechtfertigen muss, dass er vielleicht am Ende sogar Differenzierungen zulässt und sich noch mal ein Stückchen weit verschiebt."
Er sagt: "Ich glaube, man sollte sich von dem Anspruch verabschieden, dass man so eine Diskussion von Anfang bis Ende durchplanen kann." Für öffentlich-rechtliche Talkshows sei Quote nicht das zentrale Kriterium. Talkshow-Redaktionen müssten den "Sprung ins Ungewisse wagen" und auch Gäste einladen, "mit denen einiges schief gehen kann", so der Autor.
(huc/jfr)




