Neues Bewusstsein
Das deutsche Feuilleton hat in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Veränderungen erfahren. Einst lediglich Berichterstattung über neue Theaterpremieren, neue Bücher und neue Gemälde, sogenanntes Rezensionsfeuilleton, gesellten sich nicht bloß Auseinandersetzungen hinzu, sogenanntes Debattenfeuilleton, sondern auch eine Reihe von neuen Objekten der Begutachtung.
Das waren Film, Hörfunk, Fernsehen, Tonaufnahme, es waren Architektur und Städtebau. Der allerneueste Gegenstand ist reine Redundanz. Es geht um jenes Medium, dessen sich das Feuilleton wie die übrige Medienwelt bedient, nämlich die Sprache.
Wir erleben eine Konjunktur der Sprachkritik. Was früher eher die Sache klandestiner Bünde wie des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins war, gedieh zum Masseninteresse. Was früher fast bloß in elitären Printorganen wie der „Fackel“ des Österreichers Karl Kraus stattfand, sickert heute in die Kulturseiten der Tagespresse. Sprachkritische Bücher erreichen Bestsellerstatus, wie die von Bastian Sick und Wolf Schneider. Viel benutzte Online-Portale bringen regelmäßig Kolumnen zum Sprachgebrauch. Radiosender und selbst das Fernsehen wenden sich dem Thema zu.
Wieso solches Interesse aufkam, ist nicht leicht zu erklären. Zweifellos hat die jahrzehntelange Auseinandersetzung um die Reform der deutschen Rechtschreibung, die am Ende doch keine war, erheblich dazu beigetragen, wiewohl es bei Orthographie doch bloß um die schriftliche Darstellung, nicht um die Artikulation von Sprache geht. Ein anderer Anlass waren und sind die Einflüsse des Englischen, die sich teils als alberner Beweis von Weltläufigkeit, teils als Invasion von Begriffen und Wendungen äußern. Belege existieren zur Genüge und werden lauthals beklagt. Jemand erfand das hübsche Wort Angloholismus. Hier wollen wir auf zwei Fälle eingehen, deren angelsächsischer Ursprung sich aufs erste Hinsehen nicht erkennen lässt.
Der eine ist häufig gebrauchte Wendung „einmal mehr“. Sie ist eine Lehnübersetzung des englischen „once more“, korrekteres Deutsch wäre „noch einmal“ oder „ein weiteres Mal“. Das andere ist die derzeit epidemisch auftretende Negativantwort „nicht wirklich“. Sie entspricht dem englischen „not really“ und hieße in korrektem Deutsch „eigentlich nicht“. Wir wollen uns nicht in die donquichoteske Lage begeben, gleich den Untergang unserer Muttersprache zu beschwören. Entweder verschwinden diese Unarten, wie so viele andere, auch weil man sie, wie gerade hier, als Unarten kenntlich macht. Oder wie so viele andere verschwinden sie nicht und werden irgendwann durch Aufnahme in den Duden geadelt.
Gleichwohl, die gellenden Klagen über den Niedergang der deutschen Sprache wollen nicht enden. Dass noch niemals so schlecht gesprochen und geschrieben worden sei wie gegenwärtig, ist die verbreitete Überzeugung. Sie ist nur nicht neu. Ebenso formulierte es Kurt Tucholsky über neunzig Jahren, von dem erwähnten Karl Kraus zu schweigen. Arthur Schopenhauer, nicht nur ein scharfsinniger Philosoph, sondern auch ein vorzüglicher Stilist, beklagte gegen Ende seines Lebens (er starb 1860) die Schändung des Deutschen. Es lässt sich solches Lamento immer weiter zurückverfolgen bis zu den fruchtbringenden Gesellschaften des Barock. Jacob Grimm, Begründer unserer Sprachwissenschaft, war der Überzeugung, wirklich gutes Deutsch man bloß zur Zeit Walthers von der Vogelweide gesprochen.
Dass solche Art Pessimismus keine deutsche Spezialität ist, beweist der Blick auf unsere Nachbarländer. In Frankreich wehrt man sich gegen Einflüsse des Angelsächsischen wie in Deutschland. Selbst der böse linguistische Bube, das Englische, muss sich wehren, nämlich gegen Einflüsse des Amerikanischen, wo man seinerseits gegen Einflüsse des Spanischen kämpft.
Was also ist? Sprachen wandeln sich. Sprachen verlassen ursprüngliche Normen und setzen sich neue. Sie werden von Infektionen heimgesucht, die sie manchmal besiegen und manchmal nicht. Das neue Masseninteresse an Sprachkritik ist geeignet, übelste Verhunzungen zu beseitigen. Es ist Ausdruck eines Bewusstseins, das es früher so nicht gab. Wir haben die Sprache zum Inhalt unseres Patriotismus gemacht. Das ist vorzüglich. Ein Mehr an Patriotismus, auch das noch zu sagen, brauchen wir nicht.
Rolf Schneider stammt aus Chemnitz. Er war Redakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift Aufbau in Berlin (Ost) und wurde dann freier Schriftsteller. Wegen ‘groben Verstoßes gegen das Statut’ wurde er im Juni 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, nachdem er unter anderem zuvor mit elf Schriftstellerkollegen in einer Resolution gegen die Zwangsausbürgerung Wolf Biermanns protestiert hatte. Veröffentlichungen u.a. ‘November’, ‘Volk ohne Trauer’ und ‘Die Sprache des Geldes’. Rolf Schneider schreibt gegenwärtig für eine Reihe angesehener Zeitungen und äußert sich insbesondere zu kultur- und gesellschaftspolitischen Themen.
Wir erleben eine Konjunktur der Sprachkritik. Was früher eher die Sache klandestiner Bünde wie des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins war, gedieh zum Masseninteresse. Was früher fast bloß in elitären Printorganen wie der „Fackel“ des Österreichers Karl Kraus stattfand, sickert heute in die Kulturseiten der Tagespresse. Sprachkritische Bücher erreichen Bestsellerstatus, wie die von Bastian Sick und Wolf Schneider. Viel benutzte Online-Portale bringen regelmäßig Kolumnen zum Sprachgebrauch. Radiosender und selbst das Fernsehen wenden sich dem Thema zu.
Wieso solches Interesse aufkam, ist nicht leicht zu erklären. Zweifellos hat die jahrzehntelange Auseinandersetzung um die Reform der deutschen Rechtschreibung, die am Ende doch keine war, erheblich dazu beigetragen, wiewohl es bei Orthographie doch bloß um die schriftliche Darstellung, nicht um die Artikulation von Sprache geht. Ein anderer Anlass waren und sind die Einflüsse des Englischen, die sich teils als alberner Beweis von Weltläufigkeit, teils als Invasion von Begriffen und Wendungen äußern. Belege existieren zur Genüge und werden lauthals beklagt. Jemand erfand das hübsche Wort Angloholismus. Hier wollen wir auf zwei Fälle eingehen, deren angelsächsischer Ursprung sich aufs erste Hinsehen nicht erkennen lässt.
Der eine ist häufig gebrauchte Wendung „einmal mehr“. Sie ist eine Lehnübersetzung des englischen „once more“, korrekteres Deutsch wäre „noch einmal“ oder „ein weiteres Mal“. Das andere ist die derzeit epidemisch auftretende Negativantwort „nicht wirklich“. Sie entspricht dem englischen „not really“ und hieße in korrektem Deutsch „eigentlich nicht“. Wir wollen uns nicht in die donquichoteske Lage begeben, gleich den Untergang unserer Muttersprache zu beschwören. Entweder verschwinden diese Unarten, wie so viele andere, auch weil man sie, wie gerade hier, als Unarten kenntlich macht. Oder wie so viele andere verschwinden sie nicht und werden irgendwann durch Aufnahme in den Duden geadelt.
Gleichwohl, die gellenden Klagen über den Niedergang der deutschen Sprache wollen nicht enden. Dass noch niemals so schlecht gesprochen und geschrieben worden sei wie gegenwärtig, ist die verbreitete Überzeugung. Sie ist nur nicht neu. Ebenso formulierte es Kurt Tucholsky über neunzig Jahren, von dem erwähnten Karl Kraus zu schweigen. Arthur Schopenhauer, nicht nur ein scharfsinniger Philosoph, sondern auch ein vorzüglicher Stilist, beklagte gegen Ende seines Lebens (er starb 1860) die Schändung des Deutschen. Es lässt sich solches Lamento immer weiter zurückverfolgen bis zu den fruchtbringenden Gesellschaften des Barock. Jacob Grimm, Begründer unserer Sprachwissenschaft, war der Überzeugung, wirklich gutes Deutsch man bloß zur Zeit Walthers von der Vogelweide gesprochen.
Dass solche Art Pessimismus keine deutsche Spezialität ist, beweist der Blick auf unsere Nachbarländer. In Frankreich wehrt man sich gegen Einflüsse des Angelsächsischen wie in Deutschland. Selbst der böse linguistische Bube, das Englische, muss sich wehren, nämlich gegen Einflüsse des Amerikanischen, wo man seinerseits gegen Einflüsse des Spanischen kämpft.
Was also ist? Sprachen wandeln sich. Sprachen verlassen ursprüngliche Normen und setzen sich neue. Sie werden von Infektionen heimgesucht, die sie manchmal besiegen und manchmal nicht. Das neue Masseninteresse an Sprachkritik ist geeignet, übelste Verhunzungen zu beseitigen. Es ist Ausdruck eines Bewusstseins, das es früher so nicht gab. Wir haben die Sprache zum Inhalt unseres Patriotismus gemacht. Das ist vorzüglich. Ein Mehr an Patriotismus, auch das noch zu sagen, brauchen wir nicht.
Rolf Schneider stammt aus Chemnitz. Er war Redakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift Aufbau in Berlin (Ost) und wurde dann freier Schriftsteller. Wegen ‘groben Verstoßes gegen das Statut’ wurde er im Juni 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, nachdem er unter anderem zuvor mit elf Schriftstellerkollegen in einer Resolution gegen die Zwangsausbürgerung Wolf Biermanns protestiert hatte. Veröffentlichungen u.a. ‘November’, ‘Volk ohne Trauer’ und ‘Die Sprache des Geldes’. Rolf Schneider schreibt gegenwärtig für eine Reihe angesehener Zeitungen und äußert sich insbesondere zu kultur- und gesellschaftspolitischen Themen.
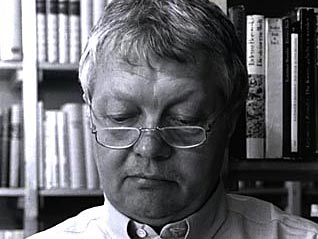
Rolf Schneider, Schriftsteller und Publizist© Therese Schneider