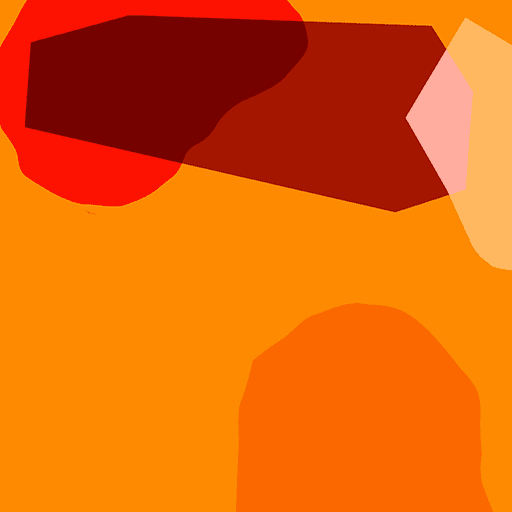"Neue Kraft fühlend"
Wie jedes der letzten Streichquartette Ludwig van Beethovens ist das Werk in a-Moll op. 132 von unverwechselbar individuellem Zuschnitt: nicht zuletzt in der formalen Anlage, die untrennbar ist von den inhaltlichen Intentionen des Komponisten. Am spektakulärsten: der mittlere Variationensatz mit den Überschriften seiner beiden kontrastierenden Teile: "Heiliger Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit, in der lydischen Tonart" sowie "Neue Kraft fühlend".
Dieser Satz bildet das Herzstück und ideelle Zentrum der Komposition, die im Kopfsatz eher ziellos suchend daherkommt, die klassische Sonatenform problematisiert, um im Finale dann doch noch einmal den großen Durchbruch – eine Art "Durch-Nacht-zum-Licht"-Dramaturgie – zu wagen.
Spieltechnisch allesamt auf höchsten Niveau, setzen die Ensembles bei der geistigen Bewältigung des Quartetts recht unterschiedliche Aktente. Grüblerisch ist die Gestaltung durch das Végh-Quartett (1973), zu fast mystischer Versenkung neigt das Busch-Quartett (1937), die vokalen Linien werden mit feinstem Klangsinn vom Hagen (2005)- und vom Leipziger Streichquartett (2002) gezeichnet.
Als Referenzaufnahme kann einmal mehr die des Berg-Quartetts (1984) gelten, aber auch die des Lasalle-Quartetts (1976). Beide Formationen – obwohl um eine Generation voneinander geschieden – stehen sich konzeptionell recht nahe, wenn es darum geht, sowohl offenkundige Abschnitte und Gliederungen des Werks deutlich zu konturieren als auch die "subthematischen" Schichten, das heißt allgegenwärtige, aber unserer Wahrnehmung nicht spontan zugängliche motivische und kontrapunktische Verklammerungen freizulegen.
Spieltechnisch allesamt auf höchsten Niveau, setzen die Ensembles bei der geistigen Bewältigung des Quartetts recht unterschiedliche Aktente. Grüblerisch ist die Gestaltung durch das Végh-Quartett (1973), zu fast mystischer Versenkung neigt das Busch-Quartett (1937), die vokalen Linien werden mit feinstem Klangsinn vom Hagen (2005)- und vom Leipziger Streichquartett (2002) gezeichnet.
Als Referenzaufnahme kann einmal mehr die des Berg-Quartetts (1984) gelten, aber auch die des Lasalle-Quartetts (1976). Beide Formationen – obwohl um eine Generation voneinander geschieden – stehen sich konzeptionell recht nahe, wenn es darum geht, sowohl offenkundige Abschnitte und Gliederungen des Werks deutlich zu konturieren als auch die "subthematischen" Schichten, das heißt allgegenwärtige, aber unserer Wahrnehmung nicht spontan zugängliche motivische und kontrapunktische Verklammerungen freizulegen.