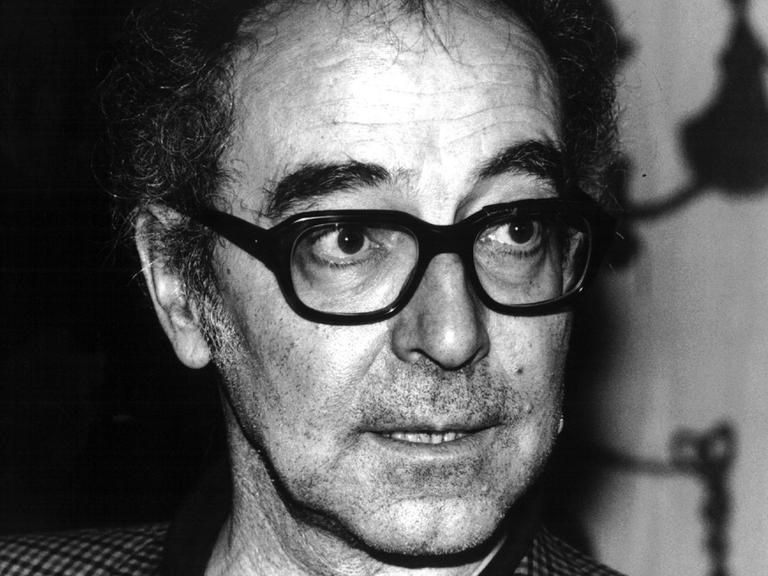Das Model und mörderische Neider

In dem Thriller "The Neon Demon" entpuppt sich die Modebranche als eine Welt voll mörderischer Obsessionen. Und eine norwegische Komödie erzählt von der Entführung des Ikea-Gründers Ingvar Kamprad. Die Kinostarts der Woche.
"The Neon Demon"
"Das ist Jesse."
"Wo ist Deine Karte?"
"Ich hab noch keine."
"Jesse ist neu in der Stadt, wurde aber gerade von Roberta Hoffman unter Vertrag genommen."
"Schon Erfahrungen auf dem Laufsteg?"
"Nicht so richtig."
"Dann zeig uns mal Deinen Walk, Liebes."
Jesse ist gerade erst aus der Provinz nach Los Angeles gekommen, aber die Modewelt ist jetzt schon hingerissen von ihr. Und die anderen Models sind ganz neidisch.
"Ist das Deine richtige Nase?"
"Ja."
"Gott, das Leben ist echt unfair."
"Du hast dich operieren lassen?"
"Bei dir klingt das, als wäre es was Schlechtes. Schönheits-OPs sind nur gute Körperpflege."
Jesse, gespielt vom amerikanischen Jungstar Elle Fanning, ist dieser Jahrmarkt der Eitelkeiten suspekt. Aber sie weiß, was sie will.
"Ich weiß, wie ich aussehe. Frauen würden töten, um so auszusehen wie ich."
Jesse ahnt nicht, wie recht sie damit hat. Der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn führt die Modebranche in "The Neon Demon" als eiskalt-zynischen Betrieb vor, der mörderische Obsessionen weckt - bis hin zu einem Fetischismus der kannibalischen Art.
Wie in seinem in Cannes prämierten Thriller "Drive" und dem Gewaltdrama "Only God forgives" inszeniert Refn extrem gestylte Bildkompositionen und Gewaltszenen von hoch-ästhetisierter Brutalität. Es scheint Refn dabei um die Entlarvung eines skrupellosen Schönheitswahns zu gehen, entfernt erinnert die stilisiert-surrealer Künstlichkeit an David Lynch. Aber "The Neon Demon" fehlt dessen satirische Abgründigkeit, stattdessen wirkt der Film mit seinen voyeuristisch coolen Hochglanzbildern so, als sei er selbst der Oberflächenverliebtheit der Modewelt verfallen.
"Die Frau mit der Kamera"
Gegensätzlicher zu Refns Stilistik könnte das Bildwerk nicht sein, um das es im deutschen Dokumentarfilm "Die Frau mit der Kamera" geht. Die Fotografin Abisag Tüllmann, 1996 im Alter von 61 Jahren verstorben, hatte ab Ende der Fünfzigerjahre unter anderem für "FAZ", "Spiegel" und "Die Zeit" gearbeitet. Als politisch und sozial engagierte Fotojournalistin, die in der Nazizeit als sogenannte Vierteljüdin Verfolgungen ausgesetzt war, fotografierte sie im Auschwitz-Prozess, während der 68er-Proteste, im deutschen Herbst und begleitete fotografisch Aufstandsbewegungen in Afrika. Immer wieder befand sie sich im Zentrum des historischen Geschehens, wie eine Zeitzeugin erzählt:
"Sie hat immer auch sich mit gesellschaftlichen Bewegungen im Entstehen befasst. Was - ich denke - in ihren Fotos oftmals wiederzufinden, ein Momentum, was Künftiges vorwegnimmt. So hatte sie auch eine ungeheure Sensibilität für soziale Bewegungen und ihre Entwicklung, und das war ihr ein Anliegen, weil sie ein Mensch war, der Ungerechtigkeit und Benachteiligung verabscheute."
Tüllmanns unpathetischer, aber ausdrucksstarker Stil traf einen Nerv. Sie war dort, wo sich Geistes- und Künstlerwelt trafen - nahm Heinrich Böll, Romy Schneider oder Arthur Miller, aber auch bevorzugt Obdachlose auf.
Die Filmemacherin Claudia von Alemann lässt in "Die Frau mit der Kamera" Tüllmanns Fotografien, filmische Dokumente und Zeitzeugen sprechen. So entsteht nicht nur ein persönliches Porträt, das die Brüchigkeit im Leben dieser faszinierenden Frau aufscheinen lässt, sondern auch ein vielsagendes Bild der Bundesrepublik von den Sechziger- bis in die Neunzigerjahre. Es ist richtiggehend spannend, gesellschaftlichen Entwicklungen aus Abisag Tüllmanns subjektivem Blickwinkel zu folgen, deren aufregende Bebilderung einer Epoche im Wandel aus heutiger Sicht ikonisch wirkt.
"Kill Billy"
Einen aktuellen gesellschaftlichen Wandel beschreibt tragikomisch die norwegische Romanverfilmung "Kill Billy". 40 Jahre lang haben der ehrenhafte Geschäftsmann Harold und seine Frau Marny ein Möbelgeschäft geführt, und nun eröffnet direkt nebenan Ikea. Ein halbes Jahr später ist das Ehepaar pleite, und Marny wird dement.
In verzweifelter Wut fasst Harold einen Plan: Er will Ikea-Chef Ingvar Kamprad kidnappen. Auf der Fahrt nach Schweden nimmt er eine junge Anhalterin mit und erzählt ihr von seinem Plan:
"Kidnapping? Ist ja voll geil. Cool."
"Was ist daran cool?"
"Ingvar Kamprad, megacool."
"Ich hab nicht gesagt, dass ich ihn kidnappen würde, ich hab nur gesagt, ich spiele mit dem Gedanken, ihn zu kidnappen. Das ist nicht das Gleiche."
So richtig ernst meint es Harold vielleicht auch nicht, aber dann schlägt das Schicksal zu: Als er nachts einen älteren Herren mitnimmt, dessen Wagen eine Panne hatte, stellt der sich als Ingvar Kamprad heraus - und eine kuriose Entführung nimmt ihren Gang.
Der norwegische Regisseur Gunnar Vikene inszeniert "Kill Billy" mit schwarzem Humor und zunächst recht abwechslungsreich als absurdes Roadmovie.
Aber weil die Geschichte über das Scheitern von Lebensplanungen dann doch eine Moral transportieren muss, entwickelt sich aus der anarchischen Idee ein Rührstück, das für die Filmfiguren Läuterung bereithält - und für den Zuschauer irgendwann zähe Langeweile.