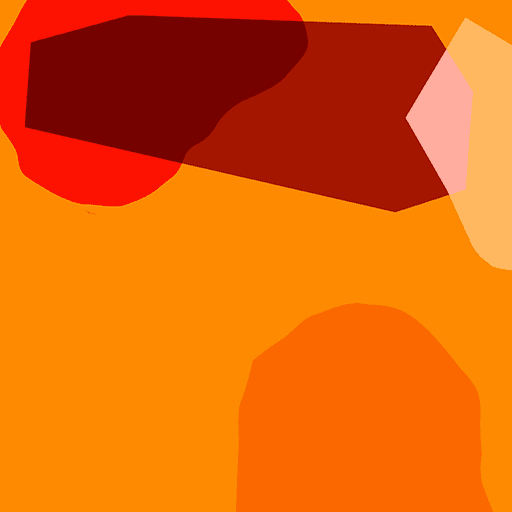"Musik für die Ewigkeit"
Olivier Messiaens "Quartett für das Ende der Zeit" ist als eines der wahrhaft existentiellen Kammermusikwerke in die Geschichte der Moderne eingegangen. Geschrieben unter schwierigsten Bedingungen in deutscher Kriegsgefangenschaft, ist Messiaens Quartett gleichwohl kein Werk der Anklage, sondern eine von unerschütterlichem Gottvertrauen geprägte Meditation über die Letzten Dinge.
Tausende Kriegsgefangene, viele Tote, Schmutz, Kälte und Hunger: Was der französische Komponist, Pianist, Organist und Vogelkundler Olivier Messiaen im Winter 1940/41 als Kriegsgefangener in Görlitz gemeinsam mit drei anderen Musikern aus Frankreich erlebte, übersteigt unsere heutige Vorstellungskraft. Dass ein solch apokalyptisches Erlebnis den hingebungsvollen Katholiken Messiaen zur Offenbarung des Johannes brachte, ist schon eher nachvollziehbar. Dass sich Messiaen davon aber nicht zu einer schreienden Anklage, sondern zu einem abgeklärten Werk über die Ewigkeit in den ungeahntesten Klangfarben inspirieren ließ, gehört zu den großen Wundern der Musik.
Das Quartett für die Görlitzer Gefangenen mit Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier umfasst acht Sätze – die Zahl steht für die Ewigkeit, symbolisiert nicht zuletzt durch die Form der arabischen Ziffer acht. Es ist eine Musik, die Interpreten wie Hörer unmittelbar "anspringt", die aber auch viele Rätsel aufgibt. Neben der stets wesentlichen Frage, inwieweit man als Musiker dem Glauben von Messiaen folgen muss, stehen die Interpreten auch vor ganz praktischen Problemen. Denn Messiaen schreibt nicht nur hochvirtuose Musik, er führt die Musiker auch in extreme, kaum noch zu realisierende Ausdrucksbereiche.
Zum Beispiel fordert er ihnen äußerst langsame Tempi ab – Tempi, die er selbst nicht durchzuhalten vermochte, als er in einer Einspielung seines Quartetts 1956 den Klavierpart übernahm. Unser Studiogast Jörg Widmann kennt die Problemlage von beiden Seiten: Als gefeierter Klarinettist hat er Messiaens "Quatuor pour la fin du temps" oft gespielt. Als begehrter Komponist steht der 1973 geborene Musiker täglich vor der Frage, was er seinen Interpreten zutrauen, zumuten darf und was nicht.
Das Quartett für die Görlitzer Gefangenen mit Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier umfasst acht Sätze – die Zahl steht für die Ewigkeit, symbolisiert nicht zuletzt durch die Form der arabischen Ziffer acht. Es ist eine Musik, die Interpreten wie Hörer unmittelbar "anspringt", die aber auch viele Rätsel aufgibt. Neben der stets wesentlichen Frage, inwieweit man als Musiker dem Glauben von Messiaen folgen muss, stehen die Interpreten auch vor ganz praktischen Problemen. Denn Messiaen schreibt nicht nur hochvirtuose Musik, er führt die Musiker auch in extreme, kaum noch zu realisierende Ausdrucksbereiche.
Zum Beispiel fordert er ihnen äußerst langsame Tempi ab – Tempi, die er selbst nicht durchzuhalten vermochte, als er in einer Einspielung seines Quartetts 1956 den Klavierpart übernahm. Unser Studiogast Jörg Widmann kennt die Problemlage von beiden Seiten: Als gefeierter Klarinettist hat er Messiaens "Quatuor pour la fin du temps" oft gespielt. Als begehrter Komponist steht der 1973 geborene Musiker täglich vor der Frage, was er seinen Interpreten zutrauen, zumuten darf und was nicht.