Moralisches Versagen der Siegermächte
Seit einigen Jahren befassen sich britische Historiker vermehrt mit der Frage, ob die Bombardierung deutscher Städte am Ende des Zweiten Weltkrieges als militärische Notwendigkeit oder als Kriegsverbrechen zu werten ist. Ohne die Opfer gegeneinander aufzurechnen, kommt A.C. Grayling zu dem Schluss, dass auch die späteren Sieger in diesem gerechten Krieg tief gesunken sind.
Seit neuestem übersetzen deutsche Verlage das stete Schrifttum britischer Autoren über den Bombenkrieg. Man erfährt darin viel Interessantes, warum damals eine halbe Million deutscher Zivilisten vernichtet wurde, und viel Überraschendes zur akuten Gefühlslage unserer europäischen Vettern.
Vor zwei Jahren errechnete Frederick Taylor unter großem Applaus, dass die 30.000 bis 40.000 0pfer Dresdens aufzuwiegen seien gegen den 14-tägigen Herstellungsausfall feinoptischer Teile, die irgendwann in U-Booten und Kampfjägern fungiert hätten. Niemand fragte Taylor, wie viele davon denn im März/April 1945 noch im Einsatz waren. Robin Neillands erwähnte, dass immerhin in Dresden auch Zigarettenpapier hergestellt wurde, damit der deutsche Landser seine Energien mit Tabak auffrischen konnte. Und Tabak war bekanntlich bis zur letzten Kriegssekunde in Einsatz.
Von anderer Tendenz und Güte ist das neue Buch des angesehenen Philosophieprofessors A. C. Grayling. Er stellt eine das deutsche wie das britische Publikum umtreibende Frage: Waren die Ziviltötungen aus der Luft eine militärische Notwendigkeit oder ein Kriegsverbrechen? Natürlich könnten sie auch beides zugleich gewesen sein. So hielten viele Militärs, damals wie heute, das Foltern von Kriegsgefangenen unter existentiellen Nöten für unumgänglich. Einverstanden, aber dann wäre es immer noch ein Kriegsverbrechen. Verbrechen sind im Kriege so gewöhnlich wie Bankeinbrüche in Banken. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Im Falle des Zweiten Weltkriegs erscheint das Widerrechtliche, Verworfene indes als das Zeichen der Deutschen Wehrmacht. Die gegnerische Allianz hingegen fühlt sich in allem legitimiert, was irgend der Zerschlagung des Reiches des Bösen diente. Dass die Allianz gewissermaßen am Tage des Sieges zerbrach und ihr westlicher und ihr östlicher Teil sich wechselseitig zu Reichen des Bösen ausriefen, gegen die alles erlaubt sei, zeigt das ganze Dilemma des gerechten Kriegs. Der Gerechte ist man selber und der Ungerechte der andere. Damit kommt kein beide Seiten bindendes Völkerrecht zustande.
Für Grayling hingegen ist, wie für alle Angloamerikaner, die Gerechtigkeit ihres Kreuzzuges prägend - Stalin kommt nicht näher vor und führt den Text zu dem noch nie zuvor so systematisch geprüften Problem: Wie viele Gräuel nimmt der gerechte Krieger auf seine Kappe? Nach wie vielen Millionen Ziviltoten hört er auf, Gerechtigkeitskrieger zu sein? Nach zwei, nach drei, nach dreißig?
Der Dramatiker George Bernard Shaw, ein Ire, schrieb in seinem, offenbar begrenzten, Kenntnisstand das Januars 1944:
"Können wir behaupten, dass die schlimmsten Taten der Nazis schrecklicher seien als das Bersten einer Bombe so groß wie ein Badeofen in einem Kinderhort in Berlin oder Bremen? Unsere Feinde sollten wissen, dass wir nicht alle den Kopf verloren haben und sich einige von uns im klaren sind, wie wir für eine reine Weste sorgen, bevor wir vor einen unparteiischen internationalen Gerichtshof treten."
Ein Gericht über den Parteien kam nie zustande und so gibt es kein Rechtsurteil, nur jede Menge Rechtsansichten. Grayling, der diese fatale Lücke zu schließen meint, baut sein Buch als ein Rechtsverfahren auf: Als erstes kommt die Tatbestandsaufnahme, eine grundsolide, 50-seitige Beschreibung des Bombardements, Schwerpunkt Deutschland, Ergänzung Japan. Danach die Schäden. Zu den Vernichteten und Verstümmelten fügt der Autor etwas selten Erwähntes: die Einäscherung einer Kulturlandschaft zur seelischen Entkernung einer Nation.
Die Verteidigung des Flächenbombardements könnte man sich etwas brillanter vorstellen, zumal sie die Mehrheitsmeinung in England und Amerika spiegelt. Ihre Literatur wird nicht müde, die militärischen Zwänge, Vorzüge und Erfolge der Prozedur darzulegen. Hätten die Westalliierten die Luftfront über den deutschen Städten nicht eröffnet, wäre Stalin etwas später in Berlin angelangt, das ist richtig. Dem Hauptargument der Massentötungsanwälte gönnt Grayling nicht viel Raum: Es habe die Deutschen weit mehr Ressourcen gekostet, eine plattgebombte Innenstadt wieder anzukurbeln als eine zertrümmerte Ölraffinerie. Eine Theorie, die wenig kümmert, was man im Kriege für Quälereien veranstalten darf und nicht darf.
In seiner stärkeren Rolle als Ankläger solcher Praktiken pocht der Autor darauf, dass die fasslichen militärischen Effekte des Bombenkriegs vorwiegend aus den chirurgischen Schlägen auf die Öl- und Verkehrsanlagen rührten. Andererseits verbietet es das Rechtsprinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel, Schlachtorgien um banaler Vorteile willen abzuhalten. Die Nazis ließen Häftlinge, Zwangsarbeiter und Jugendliche die Städte reparieren: dadurch ging dem Kanonen- und Flugzeugbau Zeit verloren, doch wenig. In England ist man aber noch nicht ganz fertig damit, den Gewinn des Städteabwrackens zu beziffern. Dabei tauchen im Nachhinein ständig neue Gründe dafür auf, mit Dresden und Würzburg, mit Halberstadt und Hildesheim Schluss zu machen.
Solch tröstliche Nachricht, dass keine andere Wahl bestanden habe, verweigert Grayling seinen Landleuten. Die Jahre ihrer größten Kriegsnot nämlich überstanden die Briten ohne Massenvernichtungsangriffe. Als sie deren Technik voll beherrschten und einsetzten, hatte die Sowjetarmee den Gegner soeben zerschlissen. Wenn man so will, war der – nach heutigem Geldwert – 150-Milliarden-Dollar-Kredit, der in die Bewaffnung Stalins floss, militärisch wirksamer eingesetzt. Der politische Segen davon machte sich auch prompt bemerkbar.
Zum Schluss betritt Grayling im Richterornat sein Buch und spricht das im Verfahren schon absehbare Urteil: Moralisches Verbrechen und militärisches Versagen in einem. Ein tapferes Verdikt, ein lauterer Mund:
"Es war ein gerechter Krieg gegen verbrecherische Feinde, in dem die späteren Sieger in einigen wichtigen Aspekten genauso tief sanken wie ihre Gegner, eine Tatsache, die inständig bereut werden sollte. Die Dinge ins rechte Licht zu rücken ist alles, was wir heute können. Aber das ist keineswegs wenig!"
Die Zivilisten von heute benötigen Moralisten, die der Gerechtsamkeit von Kreuzzüglern und Gotteskriegern so penetrant am Zeuge flicken. In den Militärhandbüchern der ultramodernen Armeen, vermerkt Grayling, und in den Notwendigkeiten der heutigen Terrornetzwerke, sind die Stadtbewohner Ziele wie damals in Hamburg und Tokio. Die Angreifer wollen sie kurz und blutig in die Knie zwingen:
"In all diesen Fällen geht es im Kern darum, größtmöglichen Schaden, Schock, Zermürbung und Terror zu verursachen."
Das Schwert der Gerechtigkeit ist zornig und ohn' Erbarmen.
A.C. Grayling: Die toten Städte - Waren die alliierten Bombenangriffe Kriegsverbrechen?
Verlag C. Bertelsmann
Vor zwei Jahren errechnete Frederick Taylor unter großem Applaus, dass die 30.000 bis 40.000 0pfer Dresdens aufzuwiegen seien gegen den 14-tägigen Herstellungsausfall feinoptischer Teile, die irgendwann in U-Booten und Kampfjägern fungiert hätten. Niemand fragte Taylor, wie viele davon denn im März/April 1945 noch im Einsatz waren. Robin Neillands erwähnte, dass immerhin in Dresden auch Zigarettenpapier hergestellt wurde, damit der deutsche Landser seine Energien mit Tabak auffrischen konnte. Und Tabak war bekanntlich bis zur letzten Kriegssekunde in Einsatz.
Von anderer Tendenz und Güte ist das neue Buch des angesehenen Philosophieprofessors A. C. Grayling. Er stellt eine das deutsche wie das britische Publikum umtreibende Frage: Waren die Ziviltötungen aus der Luft eine militärische Notwendigkeit oder ein Kriegsverbrechen? Natürlich könnten sie auch beides zugleich gewesen sein. So hielten viele Militärs, damals wie heute, das Foltern von Kriegsgefangenen unter existentiellen Nöten für unumgänglich. Einverstanden, aber dann wäre es immer noch ein Kriegsverbrechen. Verbrechen sind im Kriege so gewöhnlich wie Bankeinbrüche in Banken. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Im Falle des Zweiten Weltkriegs erscheint das Widerrechtliche, Verworfene indes als das Zeichen der Deutschen Wehrmacht. Die gegnerische Allianz hingegen fühlt sich in allem legitimiert, was irgend der Zerschlagung des Reiches des Bösen diente. Dass die Allianz gewissermaßen am Tage des Sieges zerbrach und ihr westlicher und ihr östlicher Teil sich wechselseitig zu Reichen des Bösen ausriefen, gegen die alles erlaubt sei, zeigt das ganze Dilemma des gerechten Kriegs. Der Gerechte ist man selber und der Ungerechte der andere. Damit kommt kein beide Seiten bindendes Völkerrecht zustande.
Für Grayling hingegen ist, wie für alle Angloamerikaner, die Gerechtigkeit ihres Kreuzzuges prägend - Stalin kommt nicht näher vor und führt den Text zu dem noch nie zuvor so systematisch geprüften Problem: Wie viele Gräuel nimmt der gerechte Krieger auf seine Kappe? Nach wie vielen Millionen Ziviltoten hört er auf, Gerechtigkeitskrieger zu sein? Nach zwei, nach drei, nach dreißig?
Der Dramatiker George Bernard Shaw, ein Ire, schrieb in seinem, offenbar begrenzten, Kenntnisstand das Januars 1944:
"Können wir behaupten, dass die schlimmsten Taten der Nazis schrecklicher seien als das Bersten einer Bombe so groß wie ein Badeofen in einem Kinderhort in Berlin oder Bremen? Unsere Feinde sollten wissen, dass wir nicht alle den Kopf verloren haben und sich einige von uns im klaren sind, wie wir für eine reine Weste sorgen, bevor wir vor einen unparteiischen internationalen Gerichtshof treten."
Ein Gericht über den Parteien kam nie zustande und so gibt es kein Rechtsurteil, nur jede Menge Rechtsansichten. Grayling, der diese fatale Lücke zu schließen meint, baut sein Buch als ein Rechtsverfahren auf: Als erstes kommt die Tatbestandsaufnahme, eine grundsolide, 50-seitige Beschreibung des Bombardements, Schwerpunkt Deutschland, Ergänzung Japan. Danach die Schäden. Zu den Vernichteten und Verstümmelten fügt der Autor etwas selten Erwähntes: die Einäscherung einer Kulturlandschaft zur seelischen Entkernung einer Nation.
Die Verteidigung des Flächenbombardements könnte man sich etwas brillanter vorstellen, zumal sie die Mehrheitsmeinung in England und Amerika spiegelt. Ihre Literatur wird nicht müde, die militärischen Zwänge, Vorzüge und Erfolge der Prozedur darzulegen. Hätten die Westalliierten die Luftfront über den deutschen Städten nicht eröffnet, wäre Stalin etwas später in Berlin angelangt, das ist richtig. Dem Hauptargument der Massentötungsanwälte gönnt Grayling nicht viel Raum: Es habe die Deutschen weit mehr Ressourcen gekostet, eine plattgebombte Innenstadt wieder anzukurbeln als eine zertrümmerte Ölraffinerie. Eine Theorie, die wenig kümmert, was man im Kriege für Quälereien veranstalten darf und nicht darf.
In seiner stärkeren Rolle als Ankläger solcher Praktiken pocht der Autor darauf, dass die fasslichen militärischen Effekte des Bombenkriegs vorwiegend aus den chirurgischen Schlägen auf die Öl- und Verkehrsanlagen rührten. Andererseits verbietet es das Rechtsprinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel, Schlachtorgien um banaler Vorteile willen abzuhalten. Die Nazis ließen Häftlinge, Zwangsarbeiter und Jugendliche die Städte reparieren: dadurch ging dem Kanonen- und Flugzeugbau Zeit verloren, doch wenig. In England ist man aber noch nicht ganz fertig damit, den Gewinn des Städteabwrackens zu beziffern. Dabei tauchen im Nachhinein ständig neue Gründe dafür auf, mit Dresden und Würzburg, mit Halberstadt und Hildesheim Schluss zu machen.
Solch tröstliche Nachricht, dass keine andere Wahl bestanden habe, verweigert Grayling seinen Landleuten. Die Jahre ihrer größten Kriegsnot nämlich überstanden die Briten ohne Massenvernichtungsangriffe. Als sie deren Technik voll beherrschten und einsetzten, hatte die Sowjetarmee den Gegner soeben zerschlissen. Wenn man so will, war der – nach heutigem Geldwert – 150-Milliarden-Dollar-Kredit, der in die Bewaffnung Stalins floss, militärisch wirksamer eingesetzt. Der politische Segen davon machte sich auch prompt bemerkbar.
Zum Schluss betritt Grayling im Richterornat sein Buch und spricht das im Verfahren schon absehbare Urteil: Moralisches Verbrechen und militärisches Versagen in einem. Ein tapferes Verdikt, ein lauterer Mund:
"Es war ein gerechter Krieg gegen verbrecherische Feinde, in dem die späteren Sieger in einigen wichtigen Aspekten genauso tief sanken wie ihre Gegner, eine Tatsache, die inständig bereut werden sollte. Die Dinge ins rechte Licht zu rücken ist alles, was wir heute können. Aber das ist keineswegs wenig!"
Die Zivilisten von heute benötigen Moralisten, die der Gerechtsamkeit von Kreuzzüglern und Gotteskriegern so penetrant am Zeuge flicken. In den Militärhandbüchern der ultramodernen Armeen, vermerkt Grayling, und in den Notwendigkeiten der heutigen Terrornetzwerke, sind die Stadtbewohner Ziele wie damals in Hamburg und Tokio. Die Angreifer wollen sie kurz und blutig in die Knie zwingen:
"In all diesen Fällen geht es im Kern darum, größtmöglichen Schaden, Schock, Zermürbung und Terror zu verursachen."
Das Schwert der Gerechtigkeit ist zornig und ohn' Erbarmen.
A.C. Grayling: Die toten Städte - Waren die alliierten Bombenangriffe Kriegsverbrechen?
Verlag C. Bertelsmann
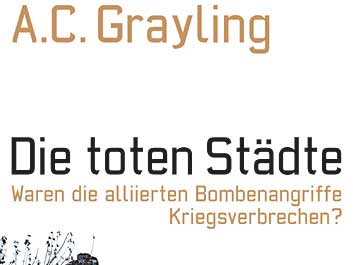
A.C. Grayling: Die toten Städte© Bertelsmann Verlag