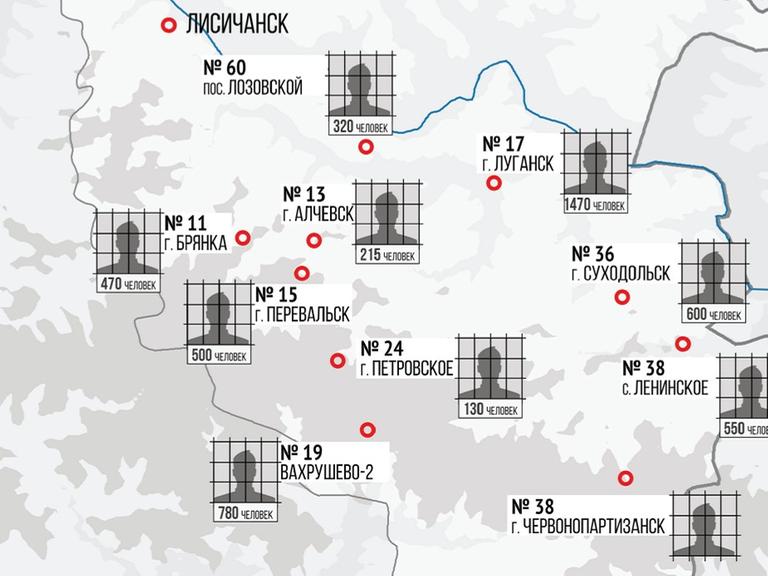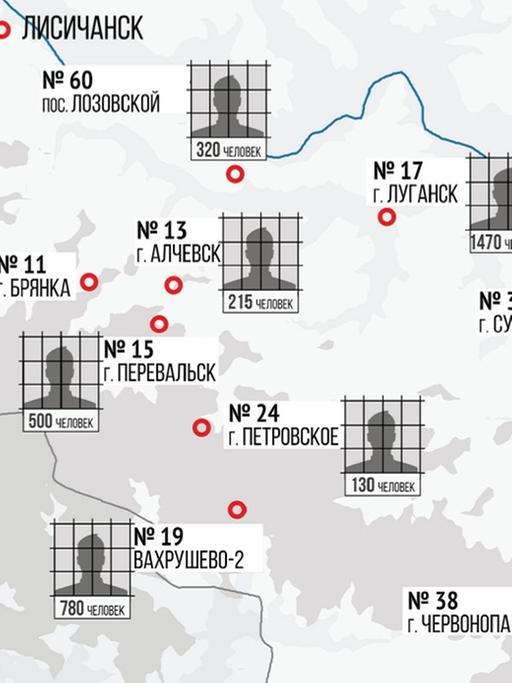Wie der Krieg die Ukraine verändert
29:21 Minuten

Die Ukraine hat kein Team zur Fußball-WM ins Nachbarland geschickt, trotzdem hängen in Kiew unzählige Nationalflaggen - dazu Poster von Soldaten. Die Gesellschaft hat sich verändert durch den Krieg gegen die von Russland unterstützten Separatisten.
Wenn ich derzeit durch Kiew laufe, fallen mir wie immer die vielen Straßenmusiker im Sommer auf, neu sind gerade die Plakate für den ukrainischen Regisseur Sentsov, der in Russland seit über einem Monat im Hungerstreik ist, um für die Freilassung von inhaftierten Ukrainern in Russland zu kämpfen.
Und dann gibt es noch die Plakate mit Soldaten, dazu die unzähligen Nationalflaggen, obwohl die ukrainische Mannschaft garnicht bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Nachbarland mitspielt.
Auch in der Sofijskaja Straße ist es so: Vor dem Eingang einer Pizzeria hängt die ukrainische Fahne. Das Lokal heißt: "Pizza Veterano". Ich gehe rein und treffe Leonid Ostaltsev:
"Es gibt eine gesteigerte Aggressivität, man fühlt sich unverstanden. Eine Kriegserfahrung ist schließlich eine Kriegserfahrung. Man findet keine Gesprächsthemen mit Menschen, die keine Kriegserfahrung haben. Denkweise und Weltanschauung verändern sich erheblich. Prioritäten und Ziele verändern sich. Was früher unwichtig war, wird wichtig. Und andersrum."
Leonid ist der Eigentümer der Pizzeria. Nach einem Jahr an der Front in der Ostukraine kam der gelernte Pizzabäcker nach Kiew zurück und hat sich seinen Traum erfüllt. Leonid wirkt selbstsicher. Der 31-Jährige ist hübsch, durchtrainiert, trägt einen Bart und ein dunkles T-Shirt mit dezentem "Veterano"-Aufdruck. Auf dem rechten Arm ein Tattoo – zur Erinnerung an "die gefallenen Blutsbrüder", wie er sagt.
"Wir hatten unmittelbare Begegnungen mit dem Feind in Sawur-Mohyla, Stepanowka, Miusinsk. Zwei Monate lang haben wir durchgehend gekämpft. Danach war Rotation. Danach war ich in Peski und Donetsker Flughafen. Dann in der Region Debaltsewe. Nach der Rückkehr hat mir persönlich der Umgang mit anderen Veteranen sehr geholfen. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Lokal eröffnet habe. Hierher kommen Jungs, Veteranen, solche wie ich. Hier können sie essen, sich unterhalten, sich Projekte ausdenken und realisieren. So eine Art Interessensgemeinschaft."
Um Mitternacht kommt die Pistole
Hinter dem Tresen von Leonids Pizzalokal hängt eine Auszeichnung an der Wand: "Sozialprojekt des Jahres". Gleich daneben mixt Maxim gerade die Drinks für die Veteranen. Er hat ein kindliches, rundes Gesicht und arbeitet eigentlich als Paramediziner. An der Front war er auch. Wenn er darüber spricht, wirkt sein Lächeln etwas naiv.
"Es gibt viele Verwundete. Schon einer ist einer zu viel. Im Vergleich zum Anfang des Krieges, zu den Kesseln, sind es weniger geworden. Aber es gibt auch Tote. Wenn es heißt, es wären zwei bis drei pro Woche, ist das zu niedrig geschätzt. Aber auch wenn es nur zwei bis drei insgesamt sind, dann sind sie doch gestorben. An der Front. Ich bilde auch paramedizinischen Nachwuchs aus. Neulich ist einer meiner Schüler gefallen durch die Kugel eines Scharfschützen. Ich muss lernen, damit umzugehen."
Mehr als 10.000 Menschen sind in der Ostukraine auf beiden Seiten inzwischen getötet worden, seit Kriegsbeginn 2014.

Der Krieg ist in der Veteranen-Pizzeria allgegenwärtig.© Inga Lizengevic
Einige Relikte dieser Jahre sind auch hier in der Pizzeria zu sehen wie Patronen unter Tischglasplatten. Viele der Gäste haben Kriegserfahrung. Aber längst nicht alle, auch Kinder rennen zwischen den Tischen herum. An der Wand prangt ein riesiges Maschinengewehr. Mich überkommt ein mulmiges Gefühl trotz der lecker duftenden Pizza. Das verstärkt sich noch um Mitternacht. So lange musste ich warten, um mit Leonid ausführlich zu sprechen. Der Laden ist geschlossen, im Hintergrund läuft die Inventur, da meint Leonid, er müsse noch eine Kleinigkeit erledigen. Er breitet eine Plastiktüte aus, ein Tuch darüber, und fängt an, seine Pistole zu putzen.
"Ich mache es ganz vorsichtig. Ich muss sie erst einsprühen und das einwirken lassen."
Ein Wirrwarr von Fragen in meinem Kopf. Warum macht er das? Ist es einfach seine Routine am Abend nach der Arbeit oder wird mir hier gerade etwas demonstriert? Ich versuche, meine Irritation zu verstecken und frage, wie er auf die Idee kam, ein Veteranen-Geschäft aufzumachen.
"Die anfängliche Idee war, einen Veteranenbund zu gründen, nachdem ich 2015 aus dem Krieg kam. Wir haben den anderen Veteranen geholfen. Es ging um Verwundete, um die Familien der Verstorbenen. Und viele Jungs, die zu uns kamen, haben erzählt, dass sie gefeuert wurden, weil sie den Chef geschlagen hätten. Oder einfach keine gemeinsame Sprache finden konnten. Da ist mir klar geworden, dass es dieses Problem gibt, die Arbeitsvermittlung für Veteranen. Und ich bin gelernter Pizzabäcker und hatte lange den Traum, meine eigene Pizzeria aufzumachen. Nach 22 Absagen hatte ich eine Zusage von einem Investor. So fing es an."
Ich gewöhne mich langsam an die Pistole, die 20 Zentimeter vor mir geputzt wird. Das wundert mich und zugleich fange ich an etwas zu verstehen. Es hat sich etwas verändert in der letzten Zeit. Die Menschen in Kiew, auf den Straßen und wohl in der ganzen Ukraine haben sich an den Krieg im Ostteil gewöhnt. Er ist Normalität geworden.
Helden fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos
Das fällt mir überall in der Stadt auf – selbst wenn ich 105 Meter unter die Oberfläche fahre zum U-Bahnhof Arsenalna. Da sehe ich auf der endlosen Rolltreppe Werbebanner mit Soldaten. Mal mit einem Mädchen auf dem Arm, mal mit einer Sportprothese schon in Zivil, oder mit dem Spruch: "Seid Ukrainer. Sprecht die Staatssprache. Wir sind bereits dabei."
Vor dem Palast der Offiziere treffe ich Volodja, 29, einen Kriegsveteran. Ihm steht sein schwarzes Sakko. In seinem dunklen Haar leuchtet das erste Grau durch. Er hat den Kessel von Debaltsewe überlebt. Wir biegen in den Mariinski Park ein.
"Es ist wie in dem alten Song von Tartak: 'Ich will kein Held der Ukraine sein, mein Land schätzt seine Helden nicht.' Seit meiner Rückkehr verstärkt sich - vor allem beim Kontakt mit Volksvertretern - der Eindruck, sie fänden es besser, wenn man dort gestorben wäre. Ist doch alles viel zu anstrengend mit diesen Helden. Man muss die Helden respektieren, man muss sich irgendwie bedanken. Neulich hat jemand aus dem Sozialministerium gesagt, die Kriegsteilnehmer würden ihr Recht auf kostenlose Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln missbrauchen. Ich verstehe das nicht! Wie kann ich mein Recht auf Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln missbrauchen? Es ist schwer ein Held zu sein."
Volodja ist vor fast drei Jahren aus dem Krieg zurückgekehrt. Jetzt engagiert er sich für die Rechte der Kriegsrückkehrer in seinem Heimatstädtchen Hlevakha, 15 Kilometer von Kiew entfernt. Auch ihm haben an der Front Freiwillige geholfen:
"Anfangs war ich sehr skeptisch. Ein freiwilliger Helfer möchte deinen Standort wissen. Wozu? Um dir etwas zu essen zu schicken. Anfangs habe ich einfach den Standort nicht nennen wollen. Später hat es sich geändert. Sie sind gekommen und haben uns leckere Äpfel vorbei gebracht. Fleischkonserven. Nicht solche, wie die bei der Armee, sondern die echten, mit großen Fleischstücken. Und es war gerade schwer mit der Versorgung. Ach, die freiwilligen Helfer, die haben damals so geholfen!"
Die Bewegung der freiwilligen Helfer ist aus den Maidan-Protesten hervorgegangen. Wahrscheinlich nur dank dieser Bewegung konnten die ukrainischen Soldaten an der Front in den ersten Jahren überhaupt überleben.
"Der Westen versteht nicht, warum wir aufrüsten"
Am Nachmittag treffe ich Uliana. Die angehende Filmemacherin führt mich zu ihrem Lieblingslokal in Kiew, das während des Maidans entstanden ist. Uliana ist Anfang 20, sie hat mittellanges schwarzes Haar. Sie trägt einen Lippestift und ein grünliches T-Shirt mit dem Aufdruck "Ukrainian Fighters", sie unterstützt die Soldaten und spürt den Krieg in den Straßen.
"Ja, klar. Angefangen damit, dass viele Menschen durch die Straßen laufen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Man spürt es. Der Krieg ist überall."
Wir bestellen vegetarische Rolls und heißen Sanddornsaft mit Honig. Die riesigen Plakate mit Soldaten darauf findet Uliana gut.
"Ich finde, es ist richtig so. Uns wird von der Schule an beigebracht, dass Krieg schlecht ist. Ich habe es so gelernt. Ich bin auf eine ukrainische Schule gegangen. Und uns wurde beigebracht, dass der Krieg schlecht ist, und dass man sich nicht schlagen darf. Nein zur Gewalt. Nein zum Krieg. Wir sind alle Pazifisten. Wir sind alle tolerant. Wir sind liberal. Und das ist gut so, solange der Nachbar nicht sagt, dass der Krieg gut sei, und er sich holen müsse, was ihm zustünde. Weil er stärker ist. Und dann kommt er und holt sich, was er will, unserer Leben inklusive. Weil er es kann. Das ist ein großes Problem. Und die Menschen im Westen verstehen nicht, dass man sich aufrüsten muss. Sie denken, es sei die Militarisierung. Aber wenn ein Krieg im Land tobt, geht es ja nicht anders."
Während der Maidan-Proteste 2013 gab es hier im Lieblingslokal von Uliana keine Preise, sondern eine Dose, in der man nach eigenem Ermessen Geld hinterlassen konnte.

Am "Tag der Würde und Freiheit" demonstrierten am 21. November 2014 ein Jahr nach dem Beginn der Maidan-Proteste erneut Menschen in Kiew.© picture alliance / dpa / Foto: Nikitin Maxim
Heute sind die Preise festgelegt. Aber die Stammkundschaft fühlt sich hier genauso wohl wie damals.
"Ich würde Mal sagen, vor dem Krieg haben sich 98 Prozent unserer Menschen gar nicht für das Weltgeschehen interessiert. Arabischer Frühling. Krieg in Georgien. Keiner konnte sich überhaupt nur vorstellen, dass es hier so etwas geben könnte. In Afrika. Oder irgendwo, wo eine schlimme Diktatur ist. Aber nicht bei uns. Wir sind doch alle hier so zivilisiert. Bildung, Kultur. Nein, nein, bei uns kann es keinen Krieg geben. Auch bis heute gibt es Menschen, die noch nicht verstanden haben, was passiert ist. Aber jetzt, wo wir diese Erfahrung gemacht haben, spricht man viel mehr über den Syrien-Krieg. Der ist viel näher gerückt."
Als wir das Café verlassen, erzählt mir Uliana noch, wie es dazu kam, dass auch ihre Eltern freiwillige Helfer für die Armee geworden sind.
"Stell dir vor, dein Nachbar muss morgen in den Krieg. Und alle wissen ganz genau, dass die Soldaten mit gar nichts versorgt werden. Weder mit Kleidung, noch mit Schuhen. Kein europäischer Zuhörer wird wirklich begreifen können, dass unsere Armee gar nichts hatte. Gegen russische Granatwerfer ist die ukrainische Armee 2014 vielleicht mit ein paar Maschinengewehren, die noch auf Lager waren, aber ohne Schutzwesten, Helme, Schuhe rausgegangen. Deshalb haben die freiwilligen Helfer selbst Schuhe gekauft für unsere Soldaten - secondhand aus Deutschland. Mittlerweile finanziert das der Staat. Aber damals haben alle zusammengelegt für eine Schutzweste, damit dein Nachbar, Freund oder Bekannter, der in den Krieg muss, nicht gleich erschossen wird."
Ist Poroschenko der richtige Präsident?
Ich laufe am Mikhailovski Dom vorbei. An der Mauer, die das Gelände um den Dom eingrenzt, hängen Portraits der vielen im Krieg gestorben Soldaten. Aus den Jahren 2014, 2015, 2016 und 2017. 2018 ist noch nicht gestaltet. Unter manchen Fotos steht: Die Eltern glauben nicht an den Tod des Sohnes.
Ich spreche wieder mit Volodja – dem 29-Jährigen Veteran, der anderen Kriegsheimkehrern hilft. Mich interessiert, wie er die heutige Regierung einschätzt.
"Ich hätte gerne jemanden, der ehrlicher ist. Der wirklich für die Ukraine einsteht und nicht nur so tut, als ob. Der Präsident kam einmal zu uns an die Front, in Artiomowsk, nach dem wir aus Debaltsewe ankamen. Da schliefen wir im Zelt auf verschneitem Asphalt. Es gab kein Bett und auch nichts, was wir auf dem Boden ausbreiten konnten. Als der Präsident das sah, sagte er, es werde alles gut und fuhr weg. Nichts passierte. Klar, er kann nicht alles selbst kontrollieren. Aber er gefällt mir nicht. Das ist nicht mein Leader. Hört endlich auf Menschen zu wählen, die eigentlich Geschäftsleute sind. Oder Boxer. Oder Mediengesichter. Was zählt denn für einen Geschäftsmann? Der Profit."

Bundespräsident Steinmeier und der ukrainische Präsident Poroschenko auf einer Pressekonferenz in Kiew in diesem Jahr.© SERGEI SUPINSKY / AFP
Auch Leonid, den "Pizza-Veterano"-Besitzer, habe ich beim Putzen seiner Pistole gefragt, was er von den Wahlen in der Ukraine im nächsten Jahr denkt.
"Bis jetzt sehe ich unter den Kandidaten keinen besseren als Poroschenko. Viele beschimpfen den Präsidenten, aber sie machen das, weil sie strohdumm sind und die Situation nicht checken. Wir haben eine parlamentarische Präsidial-Republik. Das Parlament trifft die Entscheidungen. Die Populisten schreien oft, der Präsident hätte irgendwas nicht gemacht. Obwohl dass gar nicht zu seinen Aufgaben gehört und er nicht mal das Recht hat, sich da einzumischen. Die Bürokratie, der Krieg, die Müdigkeit... Das sind die Folgen des Sowjetsystems. In der Sowjetunion musste man nicht denken, alles wurde für die Menschen entschieden. Und unsere Omas und Opas denken immer noch so."
"Ostukraine als Strafe für unsere Passivität"
Leonid hat die Pistole gereinigt und packt sie weg. Er wird sie demnächst beim Training auf dem Schießstand benutzen. Sein Hobby. Mir bleibt noch die Gretchen-Frage: Wie kann es mit der Ostukraine weiter gehen?
"Also, wie stehe ich zu den Bewohnern der Krim, und aus den Gebieten Donezk und Luhansk? Ich verachte sie. Aber ich hasse sie nicht. Wenn sie sich entschuldigen würden, würde ich das annehmen. Wenn sie anerkennen würden, dass sie im Unrecht waren. Wenn sie das nicht wollen, können sie nach Russland auswandern. Keiner hält sie hier in der Ukraine fest. Verkauft doch euer Hab und Gut und fahrt weg. Wo ist das Problem?"
Und was sagt Volodja dazu?
"Es gibt Dinge, für die wir gerade stehen und bezahlen müssen. Wir haben zu unbeschwert gelebt. Wir haben den Zerfall der Armee zugelassen, die Kommunikation zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil vernachlässigt. Ich wusste nicht, dass Donetzk und Luhansk die russischen Sender bevorzugen. Wir haben es versäumt. Wir alle. Wir haben die falschen Menschen gewählt. Donetzk, Luhansk und die Krim sind eine Art Strafe für unsere Passivität."