Mieko Kawakami: "Das gelbe Haus"
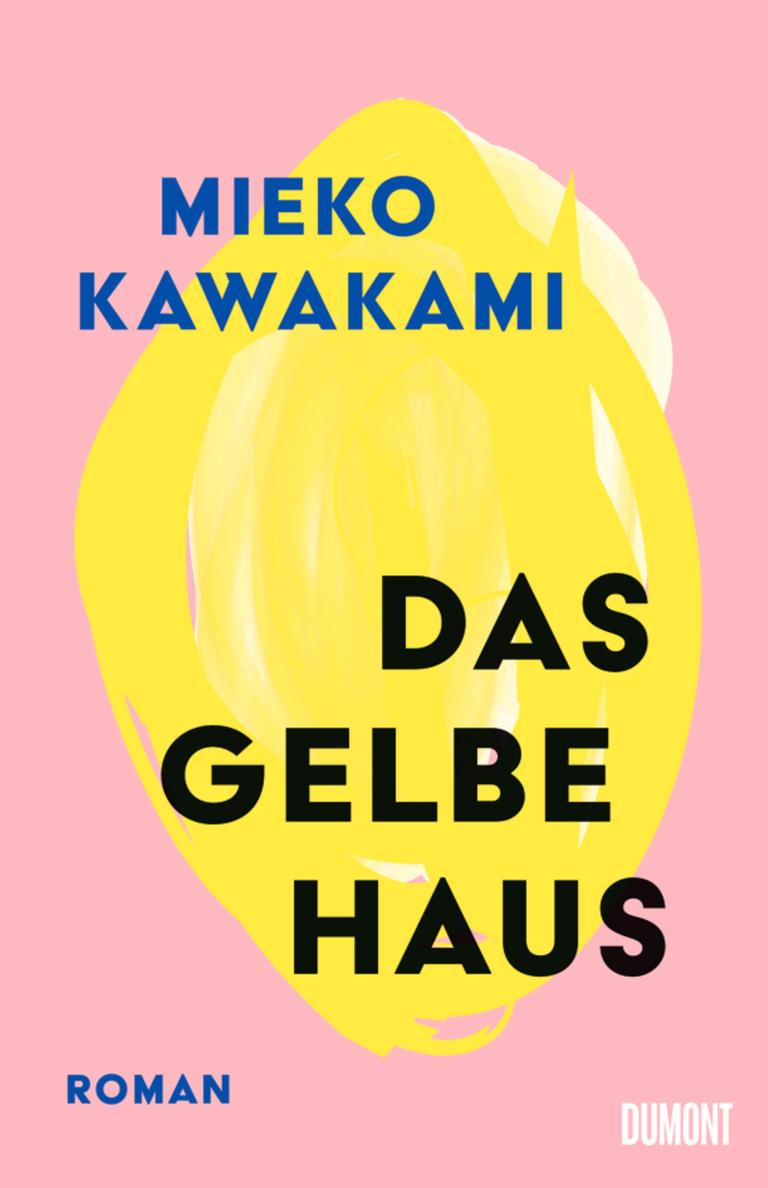
© Dumont
Unsichtbar und für immer nur ein Geldesel
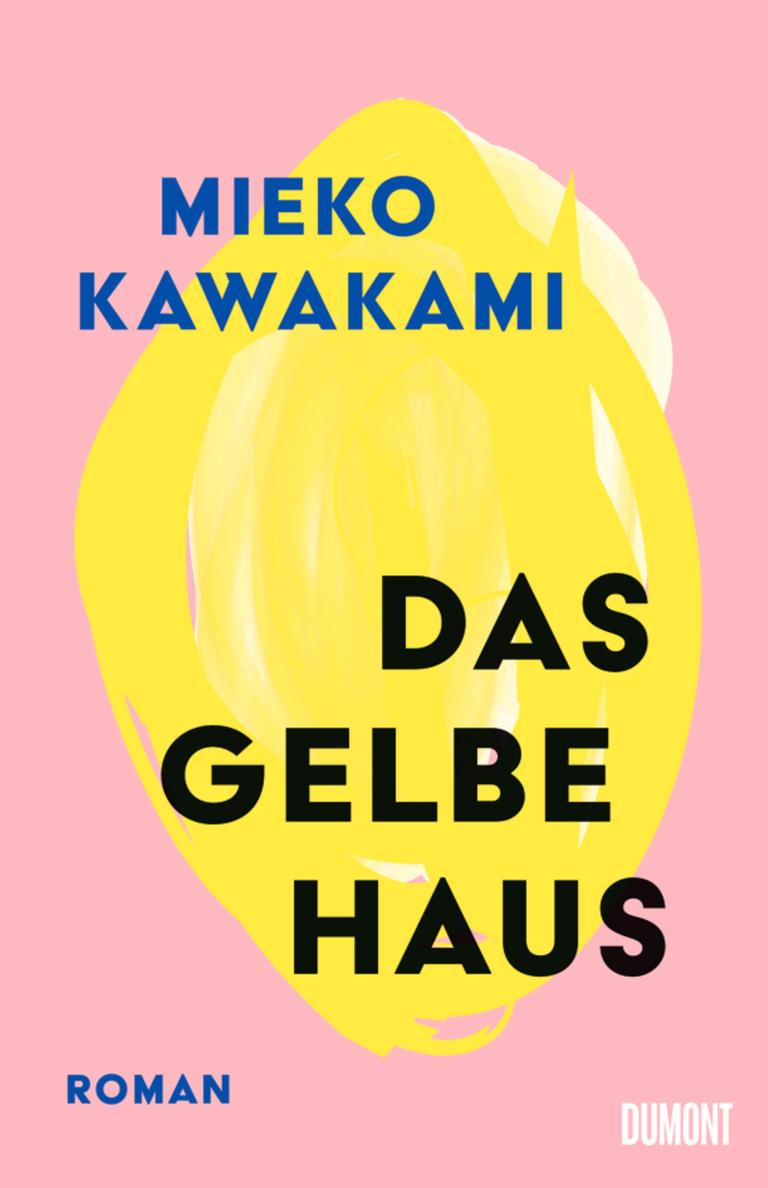
Mieko Kawakami
Aus dem Japanischen von Katja Busson
"Das gelbe Haus"Dumont, Köln 2025528 Seiten
26,00 Euro
Junge Frauen ohne Verankerung im normalen Leben, undurchsichtige Drahtzieherinnen und Mittelsmänner für ergiebige Scheckkartenbetrügereien: Mieko Kawakamis neuer Roman "Das gelbe Haus" verbindet Sozialreportage und Thriller.
Zwanzig Jahre lang hat Hana nichts von jener Frau gehört, die in ihrer Jugend die zentrale, wenn auch rätselhafte Bezugsperson für sie gewesen ist. Nun, als Vierzigjährige, liest sie zufällig, dass diese Kimiko, mittlerweile sechzig, wegen Freiheitsberaubung und Misshandlung einer jungen Frau vor Gericht steht – und alles, was Hana längst vergessen hat, kehrt als Erinnerung zurück – als schmerzhafte und offene Fragen an sich selbst.
Rund fünf Jahre hat Hana mit Kimiko um die Jahrtausendwende herum im Abseits der japanischen Gesellschaft verbracht, hat mit ihr gemeinsam eine Snack-Bar betrieben, dann im großen Stil Scheckkartenbetrügereien durchgezogen. Mit Organisationstalent und unendlicher Energie im Auftrag krimineller Strippenzieher – angetrieben von der Suche nach Anerkennung, Zugehörigkeit und Selbstwertgefühl.
Nach all dem, was ihre Mutter ihr als Kind in dem Verschlag, in dem sie gemeinsam gelebt haben, nie hat geben können oder wollen.
Mädchen voll unartikulierter Wünsche und Sehnsüchte
„Keiner meiner Gedanken, keine meiner Erinnerungen hatte Gewicht. Dinge, an die ich mich hätte erinnern sollen, gab es nicht. Dinge, über die ich hätte nachdenken sollen, gab es vielleicht, aber ich wusste gar nicht, wie man das machte, nachdenken. Streng genommen ließ ich mir also vielleicht gar nichts durch den Kopf gehen.“
Mit fünfzehn ist Hana daher ein Mädchen voll unartikulierter Wünsche und Sehnsüchte – erst als die ältere, schwer durchschaubare Kimiko auftaucht und sich um sie kümmert, öffnet sich für sie ein Fenster zu einem vielversprechenderen Leben. Sie verlässt die Mutter, und erschließt sich eine neue Welt mit neuen Menschen: Solche, die ein bisschen glamourös wirken, aber auch gleichaltrige junge Frauen, denen es nicht besser geht als ihr, denen die Utopie eines gemeinsam bewohnten baufälligen Häuschens genauso verlockend scheint wie Hana.
"Geld ist Macht, Armut ist Gewalt"
Als die Bar bei einem Feuer zerstört wird, werden sie gemeinsam als Team für Scheckkartenbetrügereien angeheuert, machen um die Jahrtausendwende herum viel Geld für Hintermänner und -frauen, deren Motive sie nicht kennen. Wissen also nie, mit wem und auf was sie sich eingelassen haben. Klar scheint nur, dass sie in einer Gesellschaft, die von ihnen nichts wissen will, skrupellos zugreifen dürfen. So wird es Hana zumindest von der Frau erklärt, die für den Nachschub an gefälschten Karten zuständig ist:
„‚Geld ist Macht, Armut ist Gewalt‘, sagte Viv-san. ‚Die Armen wissen nicht, was Prügel sind, weil sie nichts anderes kennen als Prügel. Die werden so lange geprügelt, bis sie nichts mehr in der Birne haben, geschweige denn in den Knochen. So wachsen sie auf. Deshalb wissen sie so wenig. Aber selbst, wenn man nichts weiß, kriegt man irgendwann Hunger, stimmt’s? Und wer Hunger hat, braucht etwas zu essen. Zum Essen braucht man Geld. Und wie kommt man an Geld? (…) Um das Geld der Reichen brauchst du dir keine Gedanken zu machen. (…) Nimm sie ruhig aus. Ihr Geld ist nicht wie unseres. Stell dir einfach vor, es wären Daten. Sind es letztlich ja auch.‘“
Das ist von Seiten der Strippenzieher Zynismus pur – und Mieko Kawakami beschreibt die Möglichkeiten zum Abräumen von fremden Scheckkarten detailliert und als schnelllebiges Gewerbe bei ständigem Wandel der Technik. Sie erzählt parallel von Modernisierung und Ausgrenzung, denn beides gehört zusammen; sie durchleuchtet Strukturen einer japanischen Gegenwart, die Hightech-Verfahren genauso braucht wie jene Randbezirke, in denen die überleben können, die durch alle Raster gefallen sind. Die selbst weder Karten noch Konten haben und das erbeutete Bargeld in Kartons aufbewahren müssen.
Die junge Hana ist klug genug, um all diese Aktionen der Gruppe zu managen - aber sie ist nicht klug genug, um zu verstehen, wie sie sich selbst dabei verändert. Geld zu erbeuten und zu horten wird für sie zum Selbstzweck, sie wird misstrauisch und tyrannisch gegenüber den Kumpaninnen.
Fatale Dynamik der Geschichte
So reicht sie weiter, was ihr selbst auch schon widerfahren ist, verhält sich den Gefährtinnen gegenüber so, wie es ihr ein Mittelsmann, als Strategie der Clans einmal beschrieben hat: Hana und alle ihresgleichen werden nur als „Geldesel“ benutzt.
„‚ (…) weil man alles mit ihnen machen kann. Sie haben keine Familie, keine Verbindung zum normalen Leben, kommen von wer weiß woher, und wenn sie von heute auf morgen verschwinden, kräht kein Hahn nach ihnen. Solche wie die liefen nachts in Scharen herum, in gewisser Weise waren sie Objekte. Vielfältig einsetzbare Objekte. Bestens geeignet für alles, um sie zu melken, anschaffen zu schicken. (…) Das ist leicht verdientes Geld. Die können sich nicht beschweren, niemand hört ihnen zu, für die Welt existieren sie ja nicht.‘“
Das Verlangen nach ein bisschen Zuwendung, diese ständige Bedürftigkeit – das ist die schwache Seite von Hana, deshalb lässt sie sich manipulieren und täuscht sich über die eigene Versehrtheit hinweg. Da sie aber zugleich auch die Ich-Erzählerin im Roman ist – also die äußerst unzuverlässige Zeugin – bleiben Leserinnen und Leser ebenfalls lange im Unklaren über die fatale Dynamik der Geschichte.
So mischen sich die Elemente einer Sozialstudie mit der Spannung eines Thrillers. Aus dem Wunsch nach dem ‚Gelben Haus‘ als einer gemeinsamen Utopie, folgt ein nicht auflösbares Knäuel von Konflikten: Weil Hanas Selbstbild zunehmend weniger zu ihrer wahren Rolle passt, weil Geld nicht nur gehortet, sondern auch benutzt werden will, weil das Business im Ganzen immer gefährlicher wird.



