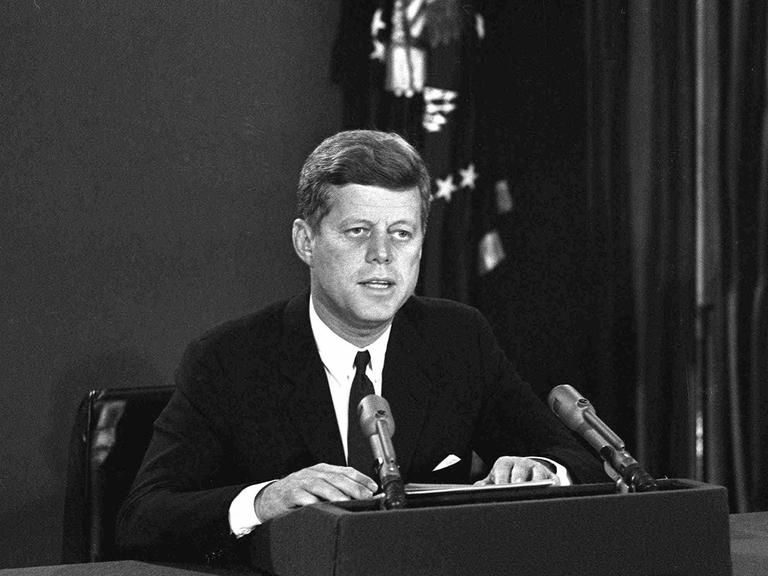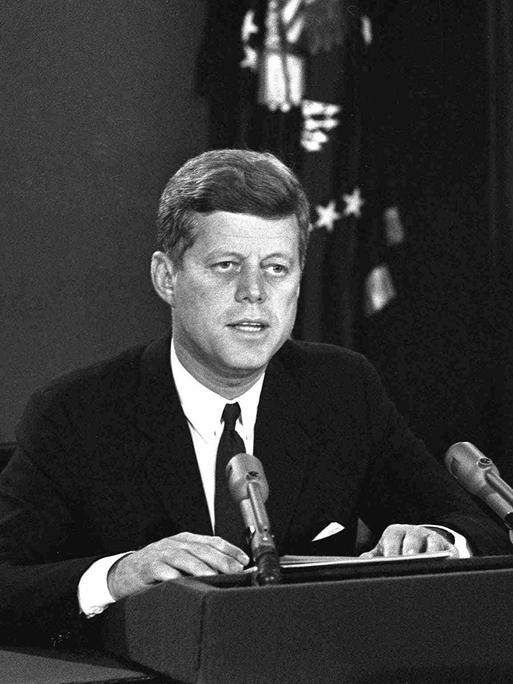Mein 13. August 1961
Der 13. August war ein strahlender Sonntag, die Eltern schliefen noch, als Klaus vor meinem Fenster stand und pfiff. Wir sausten mit den Rädern zum Grenzübergang Düppel. Da war nun wirklich kein Durchkommen mehr, die Bahnschranken runtergelassen, ein paar Bohlen quergelegt.
Unverschämt! Das konnte ja nicht so bleiben! Das würden sich die Kleinmachnower nicht gefallen lassen, die hier täglich hin und her fluteten. Ja, das hat mich damals am stärksten irritiert: Dass niemand etwas dagegen unternahm. Was ist mit den Leuten geschehen in all den Jahren danach. Sie selbst konnten die Veränderung kaum merken, sie kam ganz allmählich und alle waren davon betroffen. Was wurde anders?
Im Märchen von Dornröschen hat die Dauer die Gestalt einer Dornenhecke, sie verleibt das Schloss ein und seine innere Kultur, die Bewohner fallen in eine besondere Art von Schlaf, aus dem sie nur von außen wieder erweckt werden können. Die Innenräume dunkeln allmählich ein, die Hecke lässt den verkehrten Zustand als immer natürlicher erscheinen, die Chancen, je wieder zu erwachen, schwinden, je höher sie wächst, das heißt: je länger sie dauert. Was falsch war, wurde so etwas wie richtig allein durch seine Unabänderlichkeit.
Mein Schulfreund Klaus wohnte im Grenzgebiet, ich durfte ihn nicht besuchen, eigentlich. Seine Mutter hatte nichts dagegen, wenn ich durch den Vorgarten ins Haus schlüpfte, Grenzer kamen selten vorbei. Die Westhäuser waren nur zehn Meter entfernt. Wir konnten sehen, wie die Westmenschen auf dem Balkon saßen, Kaffee tranken, strickten, Zeitung lasen und manchmal zu uns rüberwinkten. Wir sahen die Berliner Doppelstockbusse an ihrer Endhaltestelle ankommen und abfahren, wir sahen die Busfahrer ihr Brot auspacken und reinbeißen.
Wir konnten lange rübergucken und immer wieder. Obwohl da wenig passierte, nichts, das uns in ähnlicher Weise fasziniert hätte, wenn es bei uns im Osten geschehen wäre. Vom vielen Rübergucken wird man krank, hatte die Mutter von Klaus gesagt. Wenn ich den Blick beschreiben soll, mit dem ich damals, als Zehnjähriger rüberguckte, dann scheint mir das Wort "ungläubig" am treffendsten. Die reale Nähe und reale Ferne lagen übereinander und ließen die Bilder schwimmen, steigerten meine Sinneseindrücke von Pausenbrot essenden BVG-Busfahrern ins Sensationelle.
Ich saß auf Klaus' Dachboden und starrte aus dem Fenster, ungläubig. Wenn es Palmen und Zypressen gewesen wären, hätte ich es geglaubt. Aber es waren dieselben Kiefern, die auch auf unserer Seite standen. Das Rüberwollen verbarg sich ringsum in den Häusern. Ich sah, welcher Aufwand nötig war, das Rüberwollen abzuscheiden. Im glatt geharkten Grenzstreifen sammelten sich die Fluchtträume, wurden alt und fingen an zu schimmeln.
Ich hab mich gefragt: Warum lassen sie das mit sich machen. Warum gehen die nicht wie am ersten Mai in einem breiten Demonstrationszug einfach geradeaus auf die Grenze zu, so weit es geht, und bleiben da friedlich stehen und gucken rüber. Was für eine gewaltige Demonstration wäre das gewesen, dies massenhafte Rübergucken. Aber sie waren nur als Einzelne unterwegs, hastig, gesenkten Kopfes, und sie bogen immer ab, wo sie früher drauf zu gegangen waren. Es war allem Anschein nach noch dasselbe Land, in dem sie herumliefen und abbogen. Aber sie selbst waren offenbar dabei, andere zu werden.
Mein Freund Klaus, mit dem ich am 13. August staunend vor dem geschlossenen Grenzübergang gestanden hatte, ist ein paar Wochen später abgehauen, wie man damals sagte, und es sickerte die Nachricht durch, er sei mit seinem Bruder und seiner Mutter durchgekommen, als sein Bruder auch den Vater holen wollte, seinen sie erwischt worden. Nun sei Klaus mit der Mutter im Westen, der Bruder mit dem Vater im Knast. Was sich wohl auch deshalb herumsprach, weil es ein abschreckendes Beispiel war. "Das hat er nun davon", hieß es damals.
Unabhängig von der offiziellen Propaganda legten wir uns Sätze zurecht, die uns aushalten ließen, was wir nicht ändern konnten.
Martin Ahrends, Autor und Publizist, geboren 1951 in Berlin. Studium der Musik, Philosophie und Theaterregie. Anfang der 80er-Jahre politisch motiviertes Arbeitsverbot in der DDR. 1984 Ausreise aus der DDR. Redakteur bei der Wochenzeitung "Die Zeit" und seit 1996 freier Autor und Publizist.
Im Märchen von Dornröschen hat die Dauer die Gestalt einer Dornenhecke, sie verleibt das Schloss ein und seine innere Kultur, die Bewohner fallen in eine besondere Art von Schlaf, aus dem sie nur von außen wieder erweckt werden können. Die Innenräume dunkeln allmählich ein, die Hecke lässt den verkehrten Zustand als immer natürlicher erscheinen, die Chancen, je wieder zu erwachen, schwinden, je höher sie wächst, das heißt: je länger sie dauert. Was falsch war, wurde so etwas wie richtig allein durch seine Unabänderlichkeit.
Mein Schulfreund Klaus wohnte im Grenzgebiet, ich durfte ihn nicht besuchen, eigentlich. Seine Mutter hatte nichts dagegen, wenn ich durch den Vorgarten ins Haus schlüpfte, Grenzer kamen selten vorbei. Die Westhäuser waren nur zehn Meter entfernt. Wir konnten sehen, wie die Westmenschen auf dem Balkon saßen, Kaffee tranken, strickten, Zeitung lasen und manchmal zu uns rüberwinkten. Wir sahen die Berliner Doppelstockbusse an ihrer Endhaltestelle ankommen und abfahren, wir sahen die Busfahrer ihr Brot auspacken und reinbeißen.
Wir konnten lange rübergucken und immer wieder. Obwohl da wenig passierte, nichts, das uns in ähnlicher Weise fasziniert hätte, wenn es bei uns im Osten geschehen wäre. Vom vielen Rübergucken wird man krank, hatte die Mutter von Klaus gesagt. Wenn ich den Blick beschreiben soll, mit dem ich damals, als Zehnjähriger rüberguckte, dann scheint mir das Wort "ungläubig" am treffendsten. Die reale Nähe und reale Ferne lagen übereinander und ließen die Bilder schwimmen, steigerten meine Sinneseindrücke von Pausenbrot essenden BVG-Busfahrern ins Sensationelle.
Ich saß auf Klaus' Dachboden und starrte aus dem Fenster, ungläubig. Wenn es Palmen und Zypressen gewesen wären, hätte ich es geglaubt. Aber es waren dieselben Kiefern, die auch auf unserer Seite standen. Das Rüberwollen verbarg sich ringsum in den Häusern. Ich sah, welcher Aufwand nötig war, das Rüberwollen abzuscheiden. Im glatt geharkten Grenzstreifen sammelten sich die Fluchtträume, wurden alt und fingen an zu schimmeln.
Ich hab mich gefragt: Warum lassen sie das mit sich machen. Warum gehen die nicht wie am ersten Mai in einem breiten Demonstrationszug einfach geradeaus auf die Grenze zu, so weit es geht, und bleiben da friedlich stehen und gucken rüber. Was für eine gewaltige Demonstration wäre das gewesen, dies massenhafte Rübergucken. Aber sie waren nur als Einzelne unterwegs, hastig, gesenkten Kopfes, und sie bogen immer ab, wo sie früher drauf zu gegangen waren. Es war allem Anschein nach noch dasselbe Land, in dem sie herumliefen und abbogen. Aber sie selbst waren offenbar dabei, andere zu werden.
Mein Freund Klaus, mit dem ich am 13. August staunend vor dem geschlossenen Grenzübergang gestanden hatte, ist ein paar Wochen später abgehauen, wie man damals sagte, und es sickerte die Nachricht durch, er sei mit seinem Bruder und seiner Mutter durchgekommen, als sein Bruder auch den Vater holen wollte, seinen sie erwischt worden. Nun sei Klaus mit der Mutter im Westen, der Bruder mit dem Vater im Knast. Was sich wohl auch deshalb herumsprach, weil es ein abschreckendes Beispiel war. "Das hat er nun davon", hieß es damals.
Unabhängig von der offiziellen Propaganda legten wir uns Sätze zurecht, die uns aushalten ließen, was wir nicht ändern konnten.
Martin Ahrends, Autor und Publizist, geboren 1951 in Berlin. Studium der Musik, Philosophie und Theaterregie. Anfang der 80er-Jahre politisch motiviertes Arbeitsverbot in der DDR. 1984 Ausreise aus der DDR. Redakteur bei der Wochenzeitung "Die Zeit" und seit 1996 freier Autor und Publizist.

Martin Ahrends© privat