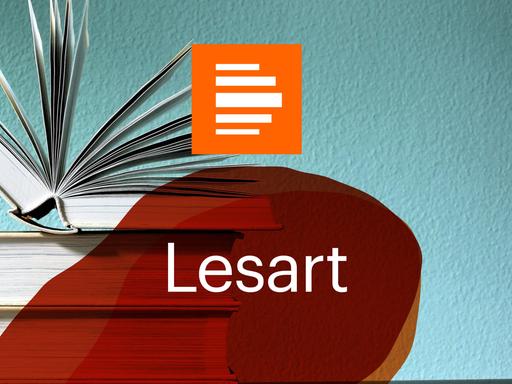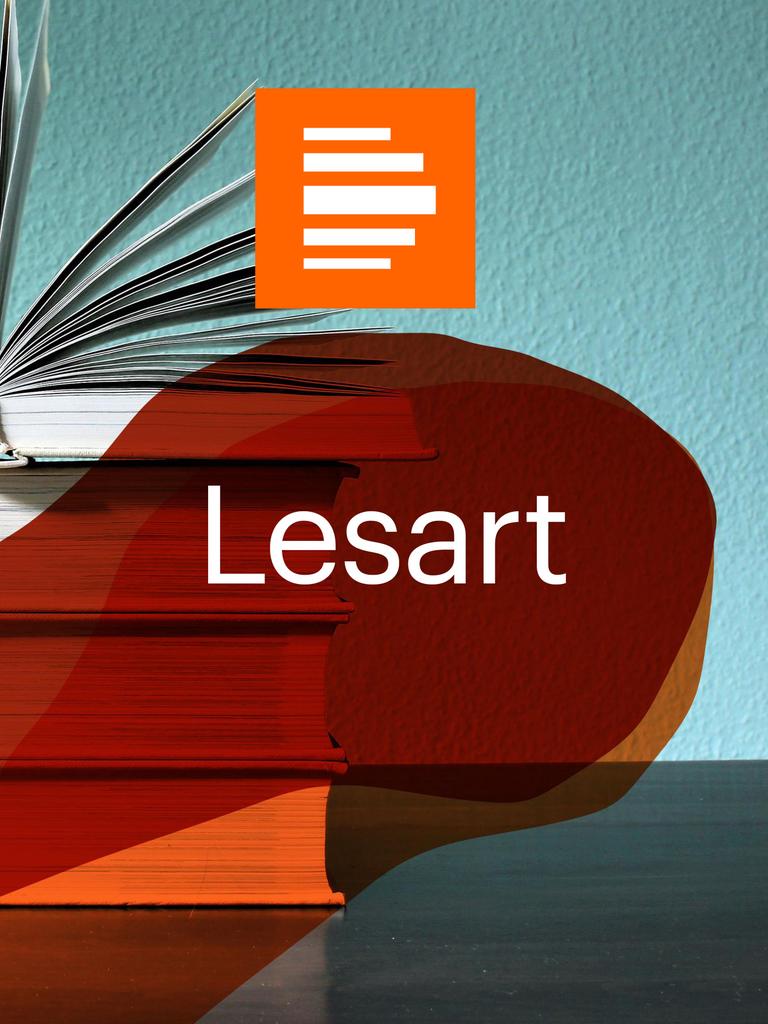Martin Puchner: Kultur – Eine neue Geschichte der Welt
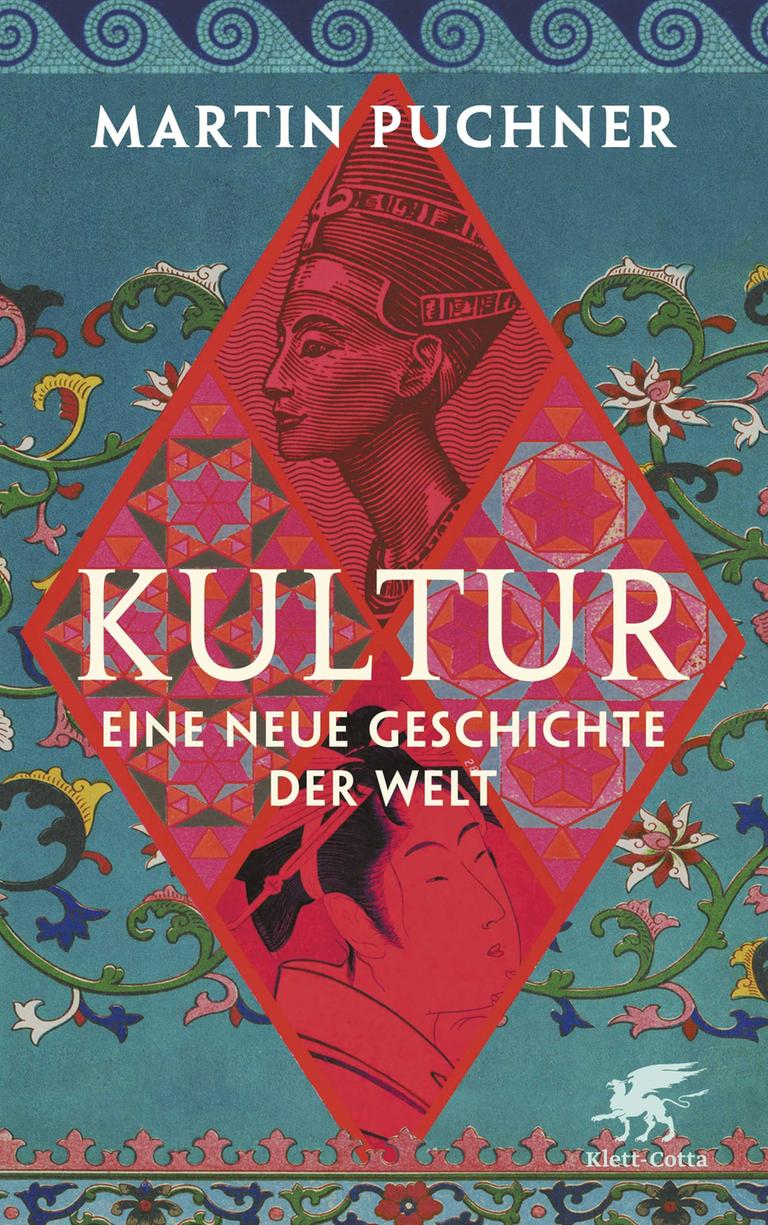
© Klett-Cotta Verlag
Irgendwas mit Kultur!
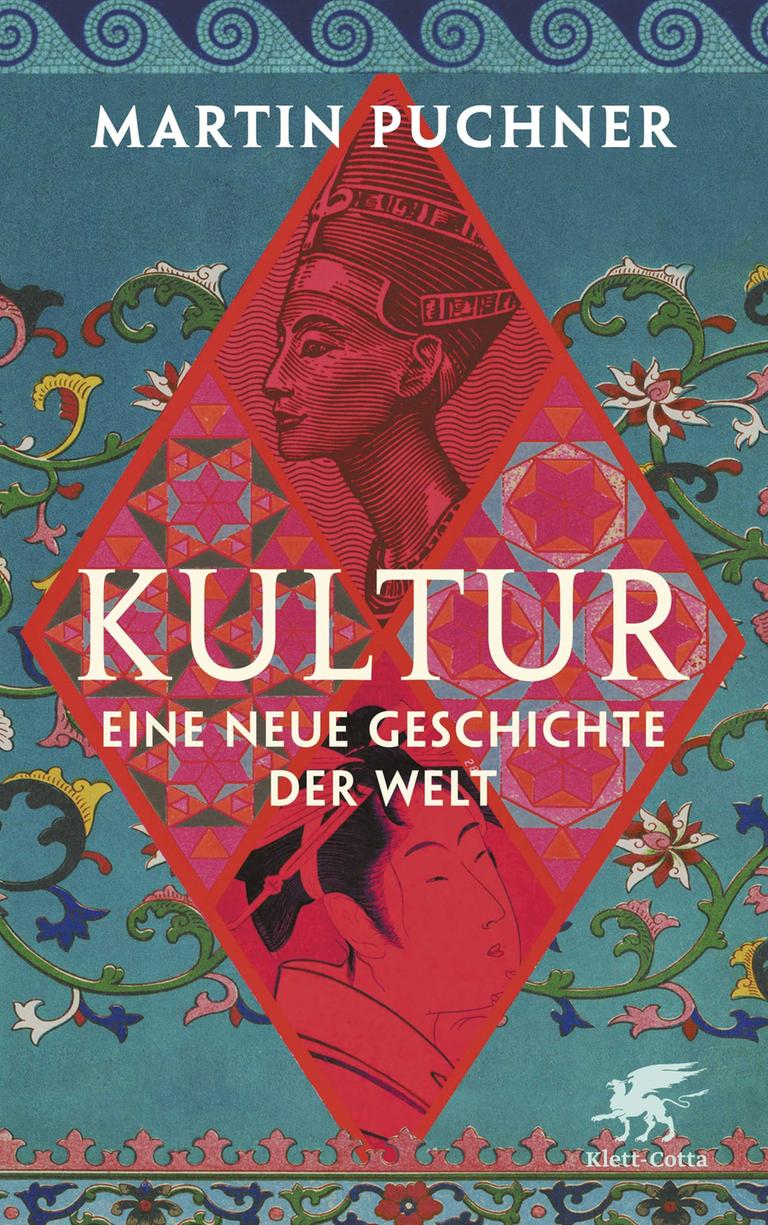
Martin Puchner
Kultur – Eine neue Geschichte der WeltKlett-Cotta Verlag, Stuttgart 2025440 Seiten
35,00 Euro
Kulturgeschichte ist für Martin Puchner immer auch eine Geschichte der Zerstörung. Doch gerade dadurch auch die Geschichte einer neu entstehenden Vielfalt. So will Puchner uns vor dem Irrtum bewahren, dass mit der Kultur etwas nicht stimmt.
Irgendetwas scheint nicht zu stimmen mit der Kultur. Mal gibt sie sich als bedrohte Art und schlägt um sich, nur weil ein Medienmanager in Deutschland Staatsminister für Kultur wird, mal wird sie – wenn es um die Kürzungen von Etats geht – in der politischen Hierarchie als etwas behandelt, das kurz nach Stricken kommt. (Nichts gegen Stricken!) Dann wieder bläst man sie zu einer Leitkultur auf, die man bewahren oder gar verteidigen muss. Alles Quatsch!
Das jedenfalls kann man nach der Lektüre des rasant geschriebenen Buches von Martin Puchner sagen, das sich als eine Kulturgeschichte tarnt, aber vielmehr ist als das. Tatsächlich versammelt der Literaturwissenschaftler Episoden kultureller Entwicklungen von den ersten Höhlenmalereien in der Chauvet-Höhle von 35000 v. Chr. bis in die Gegenwartsliteratur, von der ägyptischen Königin Nofretete und der Ausgrabungsgeschichte ihrer Büste, über die Begegnung etwa von Albrecht Dürer mit der Goldschmiedekunst der Azteken, bis hin zu den Pariser Salons der Aufklärung.
Es geht ihm aber nicht um eine systematische Fortschrittsgeschichte der Menschheit anhand ihrer kulturellen Hervorbringungen. Vielmehr werden seine sehr anschaulich geschriebenen Szenen zu Vignetten einer ständigen, oft unerwarteten, zufälligen kulturellen Erweiterung der Welt.
Kultur ist dabei – wie Puchner schreibt: „Kein Besitz, sondern als Gemeingut dazu bestimmt (..), weitergegeben zu werden.“ Es ist für den Autor nicht wichtig, was wir weitergegeben bekommen, tradieren oder aneignen, sondern wie dies geschieht. Deshalb sind die Heldinnen und Helden dieses Buches allesamt Grenzgänger, Vermittlerinnen, Übersetzer oder Interpretatorinnen.
Die Geschichte eines Mönchs
Zum Beispiel der chinesische Mönch Xuanzang, geschult an den Lehren des Konfuzius Mitte des 7. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Gegen das kaiserliche Verbot von Auslandreisen machte er sich auf, um den Buddhismus als Pilger im Ursprungsort Indien zu studieren. Der Rückzug aus der Welt in eine meditative Innerlichkeit schien Xuanzang attraktiver als der auf den Staatsdienst zugeschnittene Konfuzianismus seiner Zeit.
Sechzehn Jahre lang legt er zu Fuß oder auf Pferderücken Tausende Kilometer auf dem indischen Subkontinent zurück, sammelt kostbare Handschriften, um den Kaiser von der Bedeutung seiner Reise zu überzeugen. Und muss mit ansehen, wie seine Schätze bei der Überquerung des Flusses Indus verloren gehen. Xuanzang trug neue zusammen, die er nach seiner Rückkehr ins Chinesische übersetzte. All das beschrieb er in seinem Reisebericht „Aufzeichnungen über die westlichen Gebiete“, die selbst wiederum zu einem Klassiker kultureller Mobilität wurden. Je mehr der Mönch von der fremden Kultur in sich aufnahm, desto mehr erkannte er auch, „dass seine konfuzianische Bildung seine Reiseerfahrungen (..) grundlegend geprägt hat“.

Martin Puchner lehrt an der Harvard University und ist auch ein gefragter Redner - hier bei einer Konferenz in München© picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand / Hubert Burda Media
Xuanzangs ist nur eine von vielen Geschichten, die Puchner erzählt. Und mit ihnen die Konzepte von Ursprünglichkeit, Originalität und Überlegenheit ad absurdum führt. Ständig wird in diesem Buch etwas ausgegraben, kolonial geraubt, bequemerweise vergessen, missinterpretiert, falsch zugeschrieben, entliehen oder abgekupfert.
Kultur als gewaltiges Recycling-Projekt
Es kommt ständig zu Disruptionen, Traditionsbrüchen oder Zerstörungen. Kulturgeschichte ist für Puchner eben immer auch eine Geschichte der Zerstörung. Aber gerade dadurch auch die Geschichte einer neu entstehenden Vielfalt. „Kultur“, so Puchner, „ist ein gewaltiges Recycling-Projekt, in dem wir nur die Mittelsleute sind, die ihre Bruchstücke zur Wiederverwertung aufbewahren“.
Dass der Buddhismus dann nach Japan hinüberschwappt und zum späteren Exportschlager des Zen-Buddhismus transformiert wird, versteht sich aus einer solchen Perspektive fast von selbst.
So wie Puchner die kulturellen Aneignungs- und Transformationsprozesse zeichnet, entsteht das Bild einer überaus widerstandsfähigen, resilienten, wendigen und anpassungsfähigen Kultur, die allen Bedrohungen gewachsen zu sein scheint.
So ist in dieser anderen Art der Kulturgeschichte auch eine zeitgemäße kleine, rebellische Kulturtheorie eingeschmuggelt, die uns vor dem Irrtum bewahren kann, dass mit der Kultur etwas nicht stimmt.