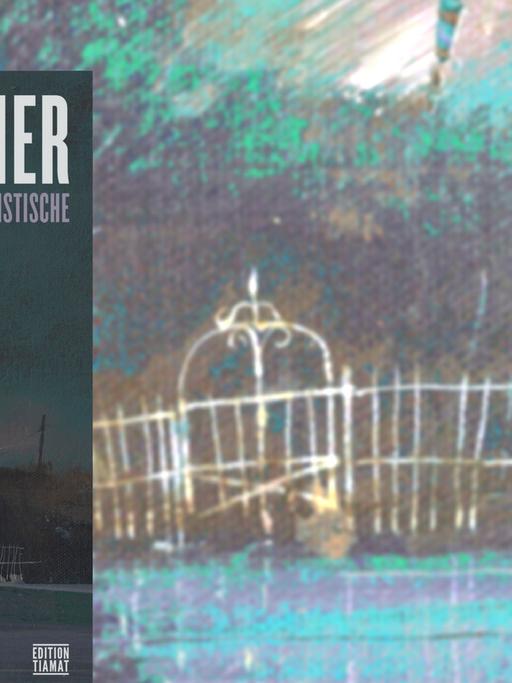Man hat im Grunde das Gefühl, dass man ganz produktiv sein kann. Man kann parallel noch dieses machen und jenes machen, und rein theoretisch könnte man noch nebenbei kochen und Wäsche aufhängen und aufräumen und lesen. Aber im Grunde kriegt man gar nichts mehr geschafft. Ich mache vieles parallel und weiß am Ende gar nichts mehr.
Pop-Philosoph Mark Fisher

Höher, schneller - und wie weiter? Mark Fishers Interesse galt den Schattenseiten der Leistungsgesellschaft. © unsplash / Erik Mclean
Geisterjäger der Leistungsgesellschaft
06:35 Minuten

Cyberspace, Rap und Depressionen: Der Kulturphilosoph Mark Fisher kämpfte in luziden Essays mit den Dämonen des Turbokapitalismus. Vor fünf Jahren setzte der inspirierende Denker zwischen Philosophie, Protest und Pop seinem Leben ein Ende.
„Kapitalistischer Realismus ist die Idee, dass der Neoliberalismus gewinnen wird, ob wir es wollen oder nicht“, erklärte Mark Fisher seine wohl bekannteste Formel. Für den Kulturtheoretiker, Sozialwissenschaftler und Philosophen war der kapitalistische Realismus ein dumpfes kollektives Gefühl, das den Raum der politischen Machbarkeit absteckt: Keine Zukunft ohne Kapital.
Für Robert Zwarg, Gastprofessor für Kritische Gesellschaftstheorie an der Universität Gießen, beweist sich Fishers Theorie an der COVID-19-Pandemie: „Es ist in diesem Sinne ganz bezeichnend, dass die Ebene der Produktion und der Arbeit genau das war, was lange Zeit nicht angetastet wurde, außer in den Bereichen und mit den Mitteln, die sich im Neoliberalismus schon eh seit einer ganzen Weile verbreiten. Also Digitalisierung, Home-Office, die Privatisierung von Stress.“
Leben im Cyberspace
Antriebslosigkeit, Optimierungsdruck, Sparmaßnahmen: Das Büchlein „Kapitalistischer Realismus“ war auch Fishers Versuch, den Wandel der britischen Universitätskultur im Laufe der 2000er-Jahre zu verstehen. Die Universität war für ihn ein Ort, an dem Ursachen und Wirkungen der sozialen Umbrüche am eigenen Leib erfahren und reflektiert werden konnten.
Ariane Linden, die derzeit ihre Bachelorarbeit in Alter Geschichte abschließt, denkt heute über das pandemiebedingte Home-Office-Studium nach:
In den frühen 2000ern prägte Fisher maßgeblich den kleinen Kreis der angelsächsischen Blogger-Intellektuellen. Schon Mitte der 2010er-Jahre kippte aber für ihn die digitale Utopie in das, was er „kapitalistischer Cyberspace“ taufte: „Niemand ist gelangweilt, alles ist langweilig“ heißt ein Text aus dieser Zeit. Sein Thema: das Verschwinden der Langeweile im Zuge der Smartphone-Revolution. Im kapitalistischen Cyberspace zerfasern Raum und Zeit, statt produktiver Langeweile verbreiten sich lähmende Gehetztheit und Depressionen.
Politische Psychologie
Fisher suchte zeitlebens nach einem Ausweg aus dem wachsenden Gefühl der Ausweglosigkeit, den sah er in einer politisierten Melancholie: „Politisierte Melancholie ist die Verweigerung, sich der Gegenwart anzupassen. Zu sagen: 'Das kann ich nicht akzeptieren.' Die Alternative dazu wäre eine Art natürlich gewordene Depression, in der wir einfach akzeptieren, dass nichts Neues mehr passiert, das aber nicht mehr für ein Problem halten“, so Fisher.

Seine Depressionen analysierte er als politisches Phänomen. Am 13. Januar 2017 nahm sich der Kulturphilosoph Mark Fisher das Leben.© Screenshot "Repeater Books"
Er selbst litt bis zu seinem Suizid an schweren Depressionen. Mit Baruch de Spinoza argumentierte er in dem Blog-Eintrag "Emotionale Ingenieurskunst": Ein Organismus sei krank, wenn er das wolle, was ihn umbringt. Das passiere in der Depression. Man möchte und muss leisten, obwohl man nicht kann. Schuld daran seien die Imperative des Kapitalismus, die das Begehren gekapert hätten. Nur eine kalte Vernunft könnte sie wieder vertreiben und es in gesündere Bahnen lenken.
In jeder Zeile Fishers wird klar: Der Kampf gegen Depression ist hart. Aber auch: politisch. Mit kritischem Denken, Überzeugung und ein wenig Ironie lässt sich fast jedes Leid in kollektive Hoffnung verwandeln. Die Grundzüge seiner emotionalen Ingenieurskunst schließt er so: „Ich glaube, man kann ordentlich Asche machen, wenn man aus Spinoza ein Pop-Therapie-Buch zusammenschreibt.“
Pop als Methode
„Eigentlich ist der ja selber Pop“, kommentiert Christoph Jacke Fishers eigenwilligen Stil. „Also, wer einmal nur reinliest, okay, dann huscht das irgendwie vorbei. Wenn man sich genauer darauf einlässt, wird das sehr schillernd und kann einem eine Menge bieten, auch nach vorne. Und dann kippt die Depression in die Progression.“
Christoph Jacke ist Studiengangsleiter für populäre Musik und Medien an der Universität Paderborn. Auch für Fisher-Übersetzter Zwarg eröffnet sich die Einzigartigkeit dieses Denkens erst auf den zweiten Blick: „Ich habe das Gefühl, gerade die These vom 'kapitalistischen Realismus', die eignet sich auch ein Stück weit dafür, sie selbst als Formel zu verdinglichen. Ich glaube, das, was ich spannend oder aktuell finde, ist eine gewisse Herangehensweise, eine bestimmte Methode.“
Ungleiche Leidensgenossen
In seinen Film- und Musikkritiken fand Fisher ungleiche Leidensgenossen, etwa den Rapper Drake. In diesen Auseinandersetzungen zeige sich nicht zuletzt Fishers besonderer Bezug auf die Arbeiterklasse, unterstreicht Zwarg.
Es geht da ja eigentlich nicht darum, dass das kulturell verelendete Massen sind, die man mobilisieren muss, und dann entsteht Sozialismus. Sondern was an Fishers Bezug auf die Arbeiterklasse so interessant ist, ist, wie ernst er die Arbeiterklasse als kulturelle Formation nimmt.
Gegenkultur entstand für Fisher an konkreten Orten, aus konkreten Aufstiegserfahrungen und enttäuschten Versprechen. So erkläre Fisher den Post-Punk aus dem Vorhandensein sozialer Räume, einer sozialstaatlichen Absicherung, die Arbeiterkindern gerade so erlaubt habe, Kunsthochschulen zu besuchen. Fisher habe fasziniert, dass in diesen staatlich subventionierten Schutzräumen „einerseits der hochkulturelle avantgardistische Impuls und andererseits sowas wie Punk zusammenkommen und was Neues bilden“, sagt Zwarg.
Sogar der kapitalistische Realismus war einmal so etwas Neues. In den 60er-Jahren erfanden ihn ein paar Kunststudenten, die ihre Werke nirgends ausstellen durften. Kurzerhand organisierten sie eine Führung durch ein Düsseldorfer Möbelhaus. Der Titel: „Leben mit Pop – eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus“.
Denken Sie daran, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Es gibt Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen: Die Telefonseelsorge bietet Gespräche per Telefon, Chat oder E-Mail. Geistliche Vertreter, Psychologen oder andere Vertrauenspersonen können in persönlichen Gesprächen helfen.