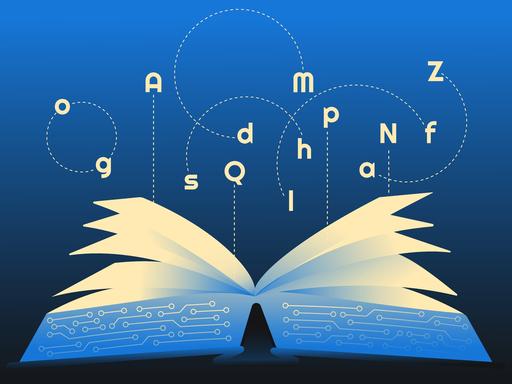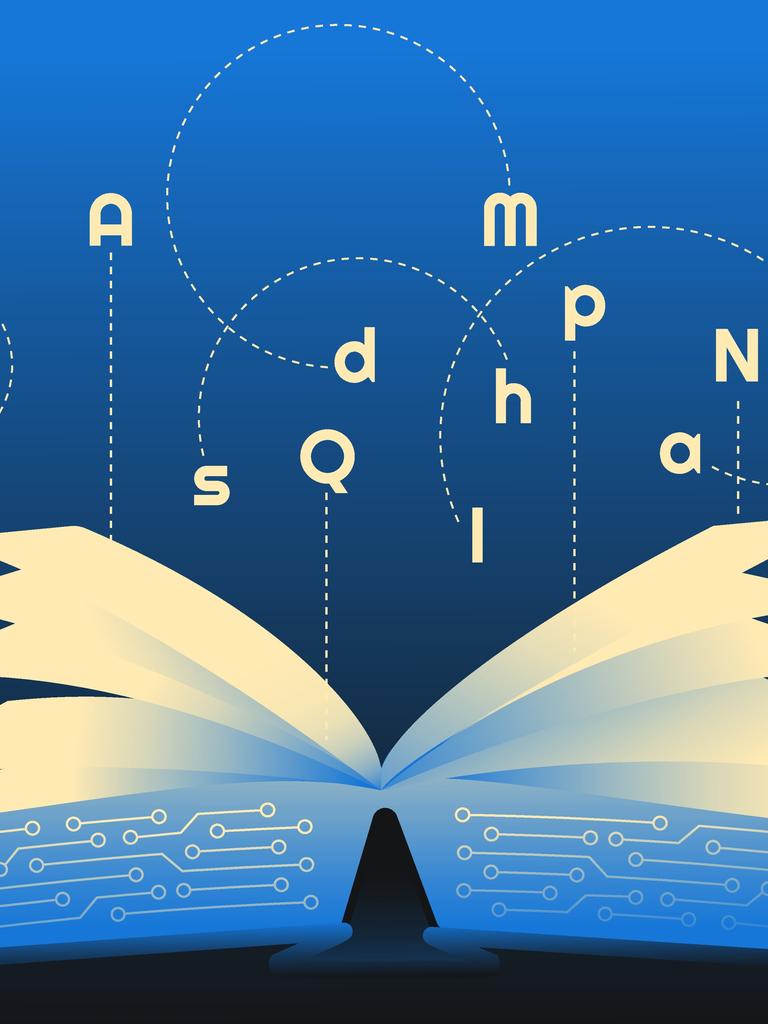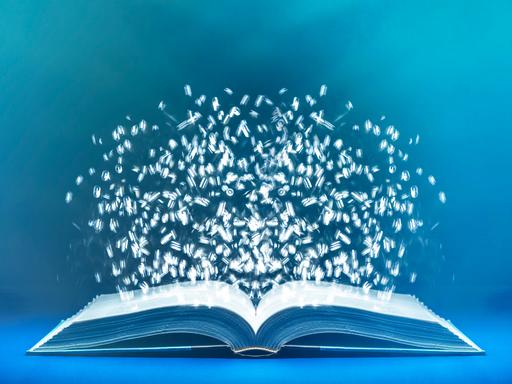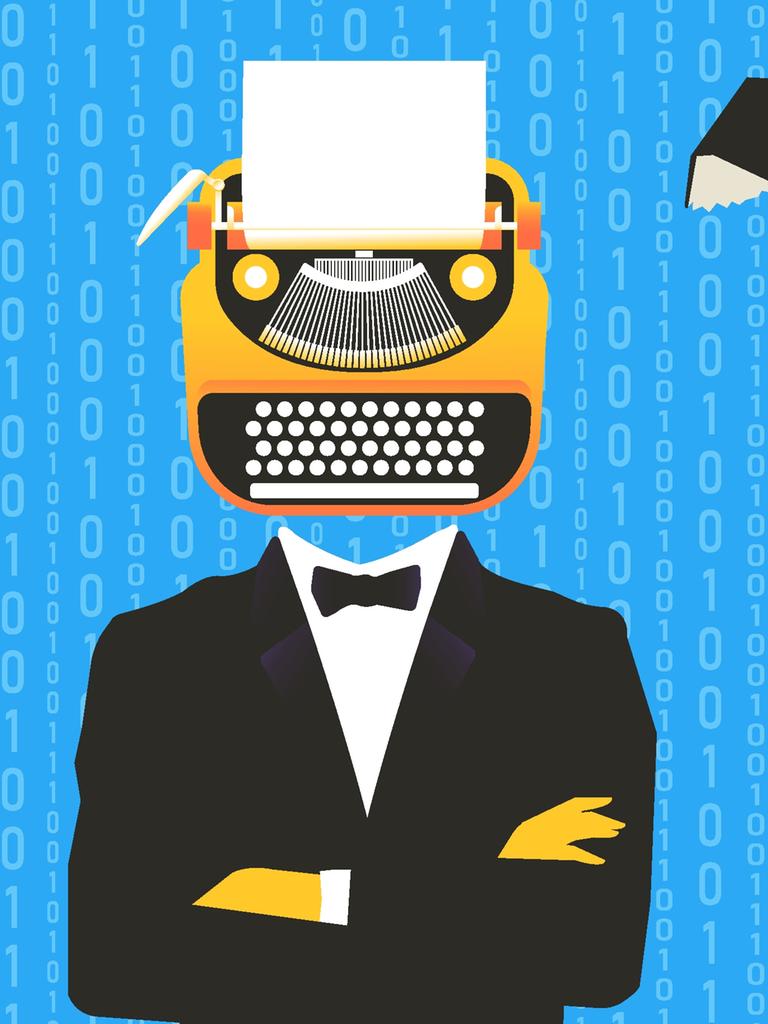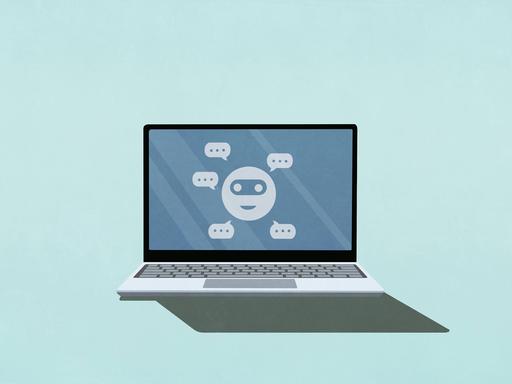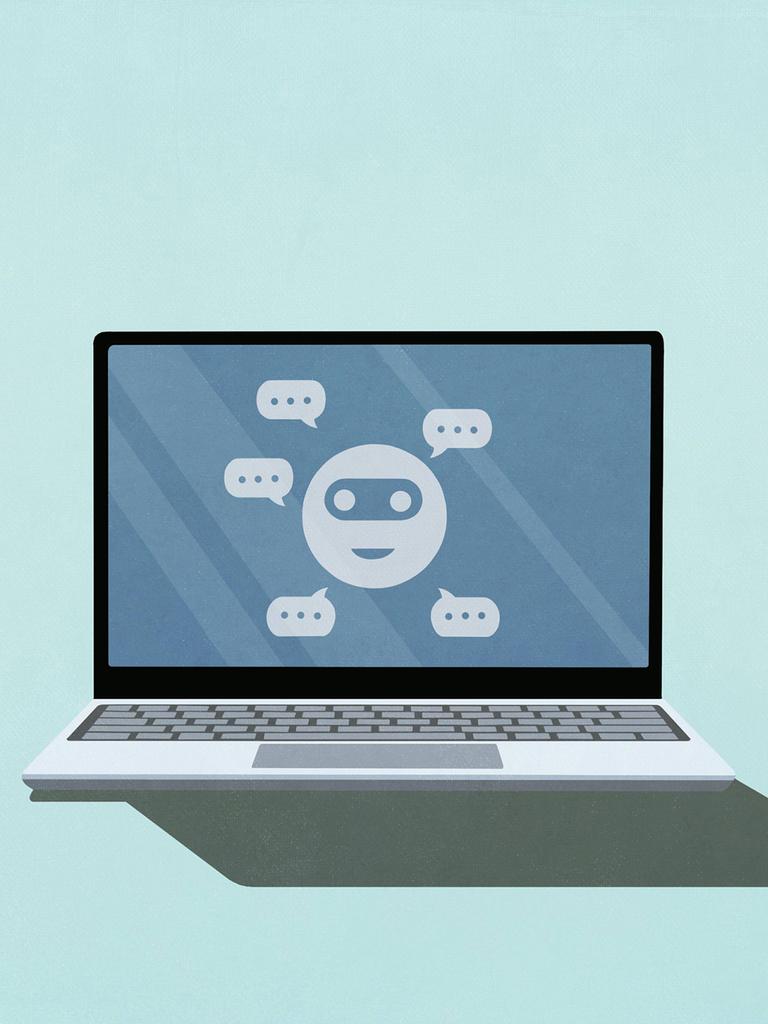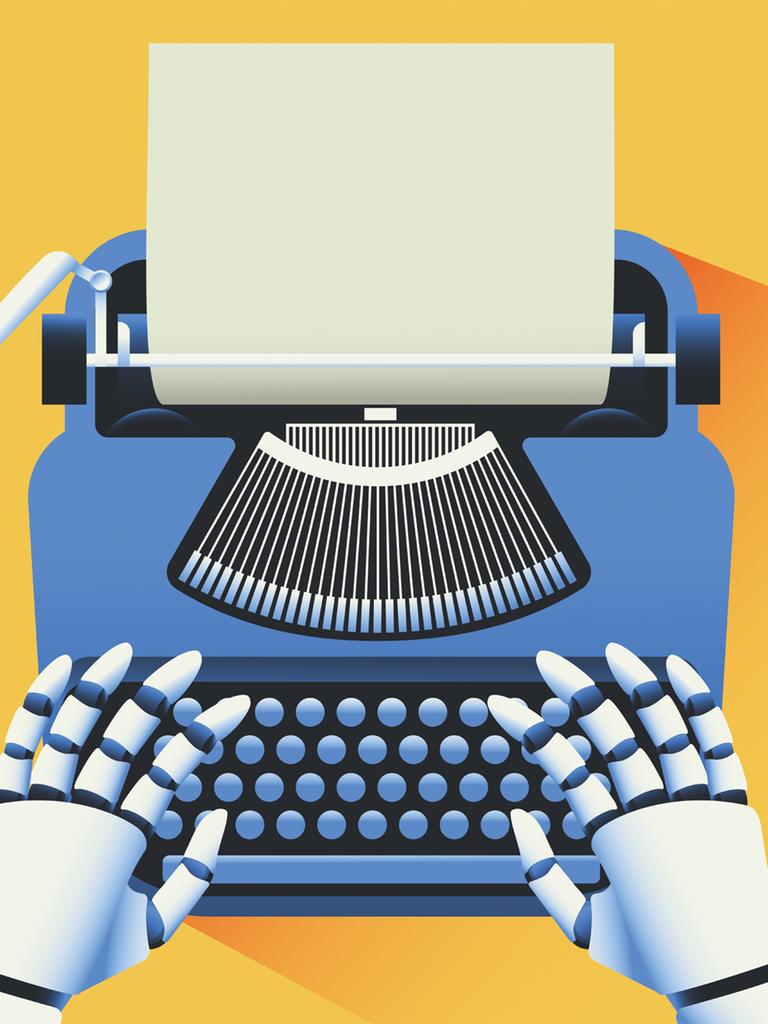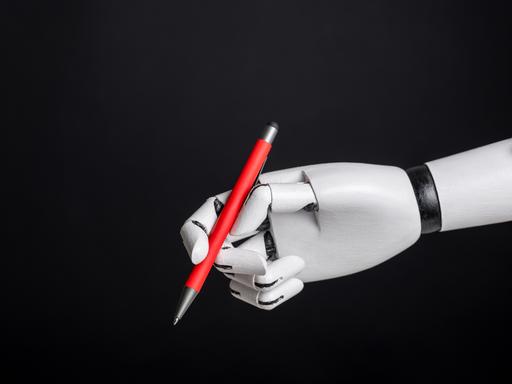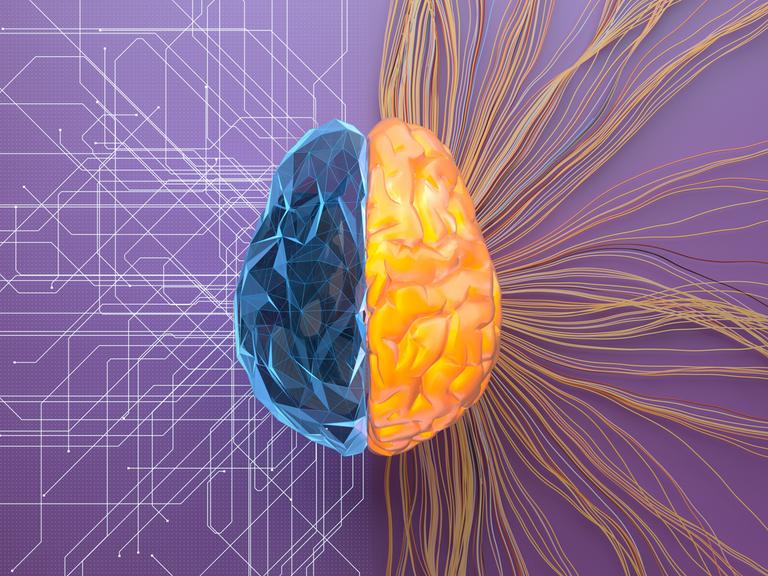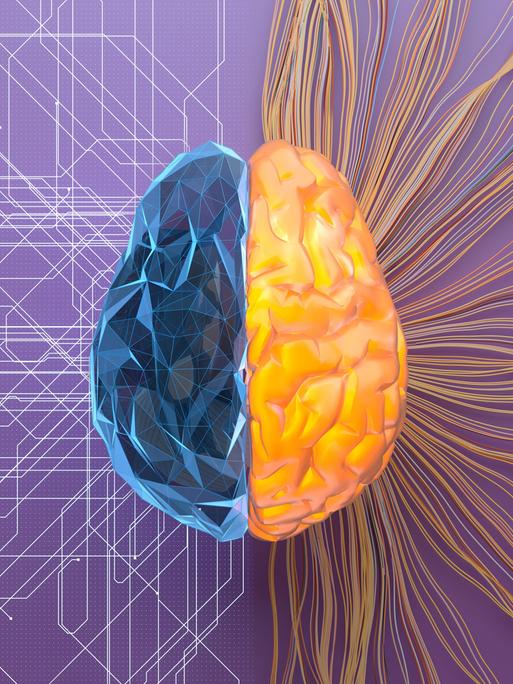Künstliche Intelligenz
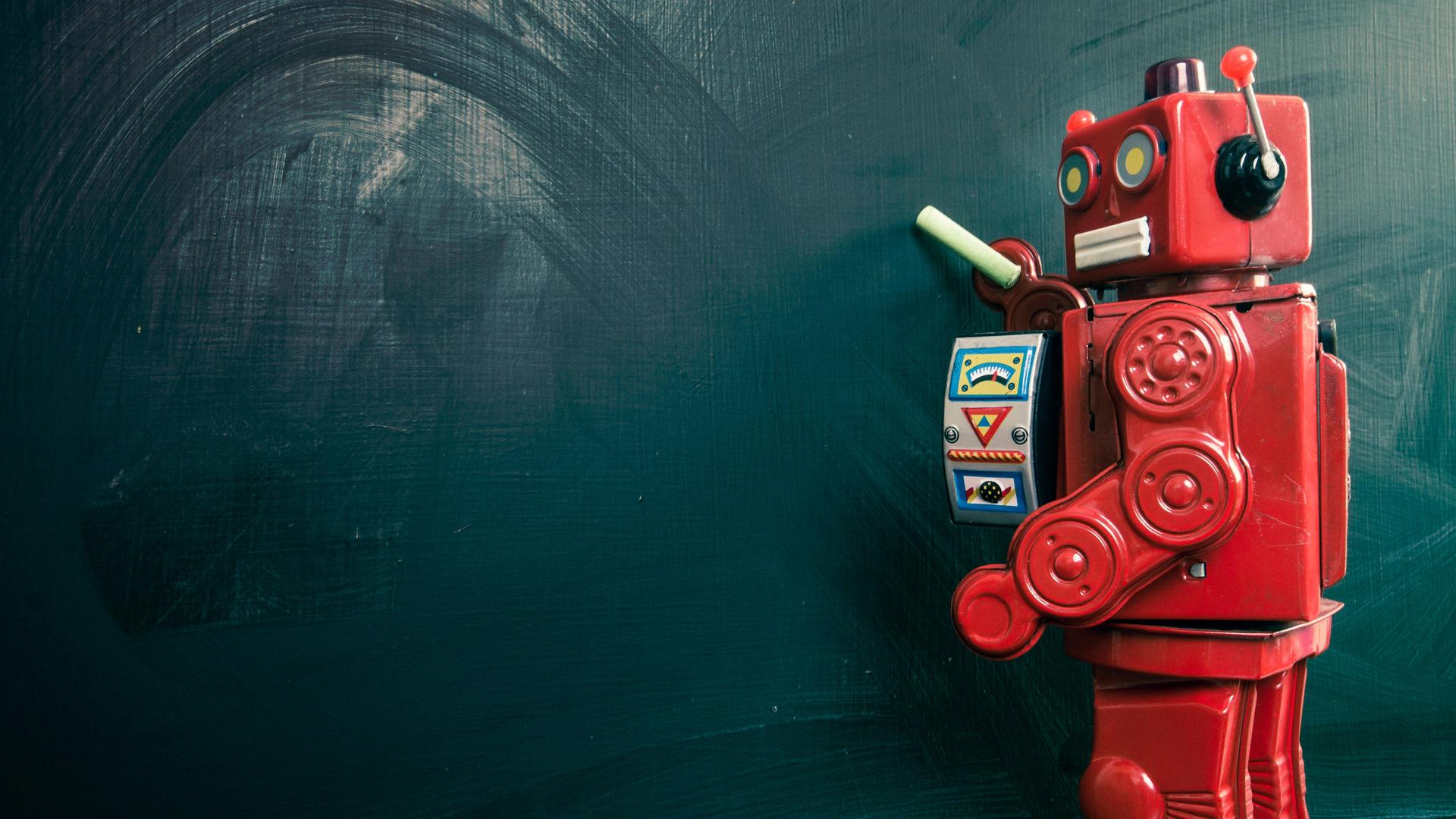
Klappentexte und wissenschaftliche Zusammenfassungen kann KI schon ziemlich gut schreiben. Und sie wird ständig besser. © IMAGO / YAY Images / charles taylor
Wenn Maschinen Bücher schreiben
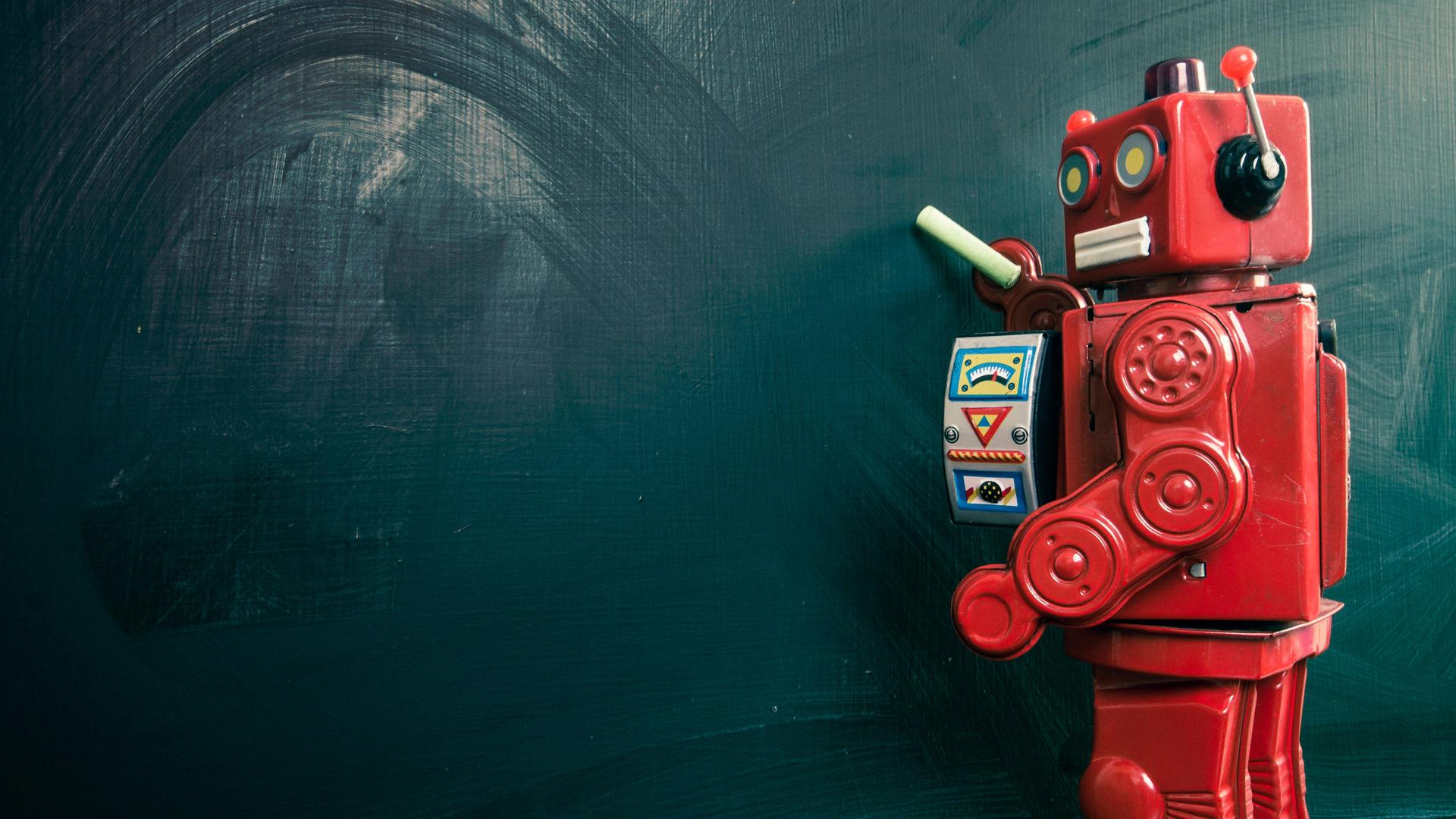
Generative künstliche Intelligenz erstellt auch Texte für die Verlagsbranche. Für Belletristik ist sie noch wenig geeignet, für Fachliteratur aber umso mehr. Welche Chancen und Risiken gibt es, wenn man immer mehr Texte schreiben lässt?
Die Einführung von ChatGPT im November 2022 hat eine Flut von Texten ausgelöst, die mithilfe von künstlicher Intelligenz entstanden sind. Nicht nur Gebrauchstexte, Aufsätze und Hausarbeiten, auch Bücher aller Art. Dadurch wurden noch mehr Menschen zu Autoren: so viele, dass die Plattform Kindle Direct Publishing von Amazon die Zahl der veröffentlichten Bücher pro Autor auf drei pro Tag begrenzen musste. Das ist immer noch sehr viel, wenn man bedenkt, dass das Schreiben eines Buches je nach Aufwand Jahre, Monate oder zumindest Wochen dauern kann.
Doch auch professionelle Autoren und Verlage nutzen die neue Technik oder haben es vor. Doch während sie einerseits viel Arbeit erleichtert, stößt sie in manchen Bereichen an ihre Grenzen und schafft noch mehr Aufwand.
Inhalt
Wie schätzen Verlagsleute KI ein?
Laut einer Umfrage des Börsenvereins des deutschen Buchhandels geben nur neun Prozent der Befragten aus der Verlagsbranche dem Einsatz von KI eine hohe oder sehr hohe Bedeutung. Aber 84 Prozent glauben, dass die Technik in fünf Jahren ein entscheidender Erfolgsfaktor sein wird. Nur ein Drittel glaubt, dass die Chancen die Risiken deutlich überwiegen. Die Hälfte findet, dass sich Chancen und Risiken die Waage halten, während 14 Prozent mehr Risiken sehen.
Wer KI einsetzt, benutzt sie bei Contentgenerierung, also vor allem bei Marketingtexten und Social-Media-Posts. Aber auch für Prozessoptimierung, Content-Recherche, Marketing und Vertrieb, wo auch das größte Potenzial gesehen wird, werden die Tools eingesetzt.
Texte, die ohnehin nie einen Autor genannt haben, wie etwa Klappentexte und Waschzettel (also Buchbeschreibungen für den Handel) können schnell und günstig von KI generiert werden. Das Tool „Demandsens“ von Media Control kann außerdem beispielsweise Absatzprognosen entwickeln, mit einer Genauigkeit von 85 bis 99 Prozent.
Manche Verlage erzeugen bereits personalisierte Empfehlungen basierend auf Kundeninteressen. Es gibt aber auch Ansätze zur Personalisierung von Büchern, etwa indem man Namen von Protagonisten ändert oder unterschiedliche Enden geschrieben werden.
Mittlerweile sind auch automatisch erzeugte hochwertige Cover möglich. Auf den neuesten Taschenbuchausgaben von Thomas Mann im S. Fischer-Verlag finden sich bereits KI-generierte Illustrationen.
Welche Rolle spielt KI beim Schreiben von Literatur?
Hochwertige Literatur bleibt weiterhin Sache natürlicher Intelligenz. Nicht nur, weil KI inhaltsblind und verständnislos sind und deshalb bloß generische, klischeehafte und logisch inkohärente Erzählungen formulieren. Romane basieren auf persönlicher Autorschaft. Darauf vertrauen Buchmarkt und Leserschaft. Doch auch Autoren mit hohem Berufsethos und Qualitätsanspruch experimentieren mit der KI, um sich inspirieren zu lassen, Ideen zu sammeln, Konzepte zu erstellen und Anfangsschwierigkeiten zu überwinden, aber auch vereinzelt für Sprachexperimente.
Wie geht die Wissenschaftsliteratur mit KI um?
In der Wissenschaft ist man offener dafür, Bücher von KI schreiben zu lassen. Hier zählt, was Maschinen am besten können: Effizienz. Man kann mit ihr leichter die Forschungsliteratur sichten und zusammenfassen, aber auch herausfinden lassen, in welche Zeitschrift man einen Aufsatz am besten publiziert. Auch Gutachter für ein Peer-Review-Verfahren lassen sich so einfacher finden. Hier kann man sich die Mustererkennung zugutekommen lassen.
Wie wird KI bei Übersetzungen eingesetzt?
Wissenschaftliche Bücher werden bereits routinemäßig mit KI übersetzt. Bei literarischen Texten funktioniert das noch nicht so gut. „Wir kriegen keine Aufträge mehr unbedingt, um ein ganzes Buch oder einen ganzen Text vom Original als Menschen zu übersetzen“, sagt Übersetzerin Pieke Biermann. „Sondern wir kriegen KI-produziertes Textgewusel und sollen das dann redigieren. Das ist aber nicht zu redigieren.“
Man müsse nicht nur die Fehler der KI korrigieren, sondern auch den Urtext prüfen. „Das ist im Prinzip die doppelte Arbeit.“ Diese wird aber weniger wertgeschätzt und weniger bezahlt. Urheberrechte fallen weg. Außerdem gibt es beim Übersetzen mit KI einen sogenannten Priming-Effekt: Man kommt nicht mehr von selbst auf die Idee, sondern ist bereits durch den Vorschlag der KI vorgeprägt.
Die Qualität von Übersetzungen gründet aber auf der persönlichen Erfahrung. „Was diese Maschinen von Menschen unterscheidet, ist das Gehör“, sagt Pieke Biermann. „Maschinen hören nicht. Ein guter Übersetzer hat ein Gehör für einen Text. Und das ist weit mehr als der Klang. Das ist auch der Rhythmus, das sind 43 verschiedene Schichten von Wörtern, von Emotionalität, von Atmosphäre, von Anspielungen auf Referenzen in alle Richtungen. Das kann eine Maschine nicht.“
Wie wird sich KI auf die Literaturbranche auswirken?
OpenAI-Gründer Sam Altman räumt ein, ChatGPT sei noch nicht sehr gut im Erzählen von Geschichten, kündigt jedoch an, es solle besser werden. Die Sorge, dass Literatur und Sprache durch die KI-generierte Massenware an Wert verlieren, ist jedenfalls groß. Altman sieht den Beruf des Schriftstellers jedoch nicht gefährdet. Menschliche Autoren würden immer noch bei der Ideenfindung überlegen sein. Auch könne KI die menschliche Verbindung zwischen Leser und Autor nicht ersetzen.
Der Schriftsteller Clemens J. Setz ist pessimistischer. Er spricht bei generativer KI von einer bedauerlichen, aber nicht mehr aufzuhaltenden Entwicklung. ChatGPT sei ein zu verführerisches, unwiderstehliches Tool. Schon lange sei das Schreiben etwas für einen kleinen Kreis und spiele keine große kulturtragende Rolle mehr. Künftig werde es eher der Normalfall sein, dass Menschen Texte von KI schreiben lassen.
Die Erstellung von Absatzprognosen mit KI könnte außerdem zu einer Mainstreamisierung des Buchmarktes führen. Schon jetzt entscheiden teilweise Social-Media-Algorithmen, was zum Bestseller werden könnte - und was nicht. Chancen für Außenseiter gibt es da nicht mehr. Werke wie die von Immanuel Kant, Thomas Mann und Annie Ernaux wären wohl so nie gedruckt worden. Denn Romane späterer Nobelpreisträger fangen meist als Lowseller an.
leg