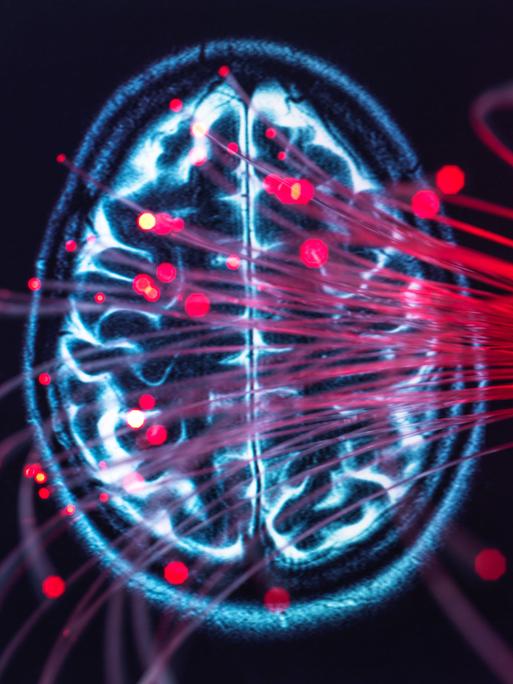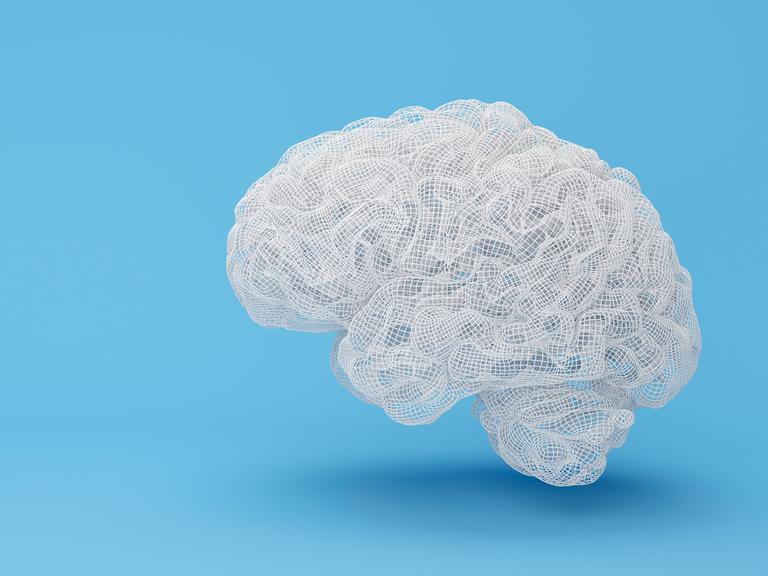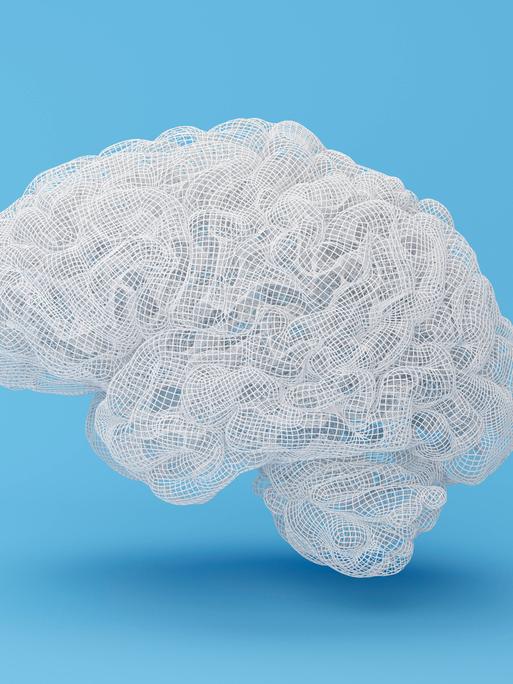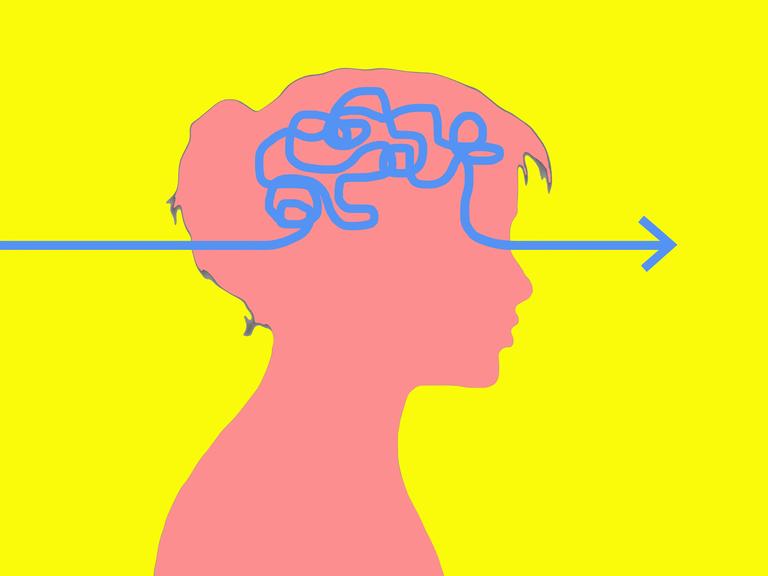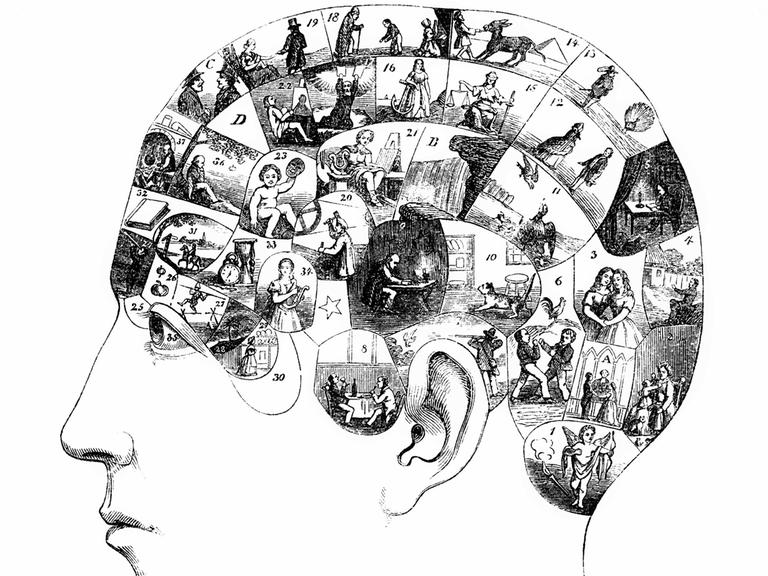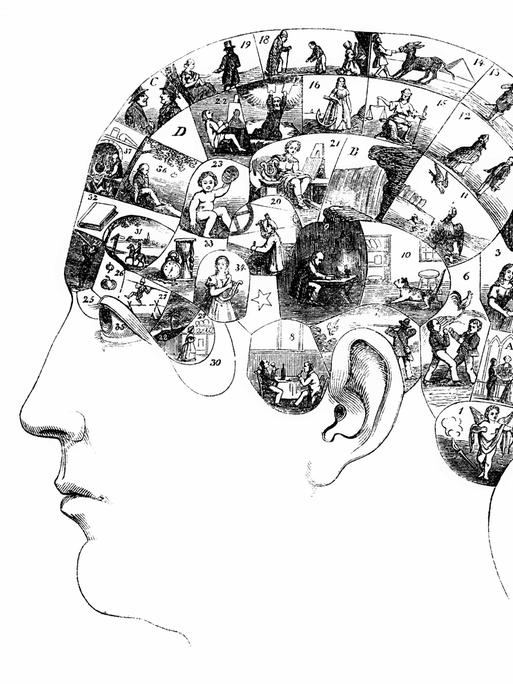Leor Zmigrod: „Das ideologische Gehirn"
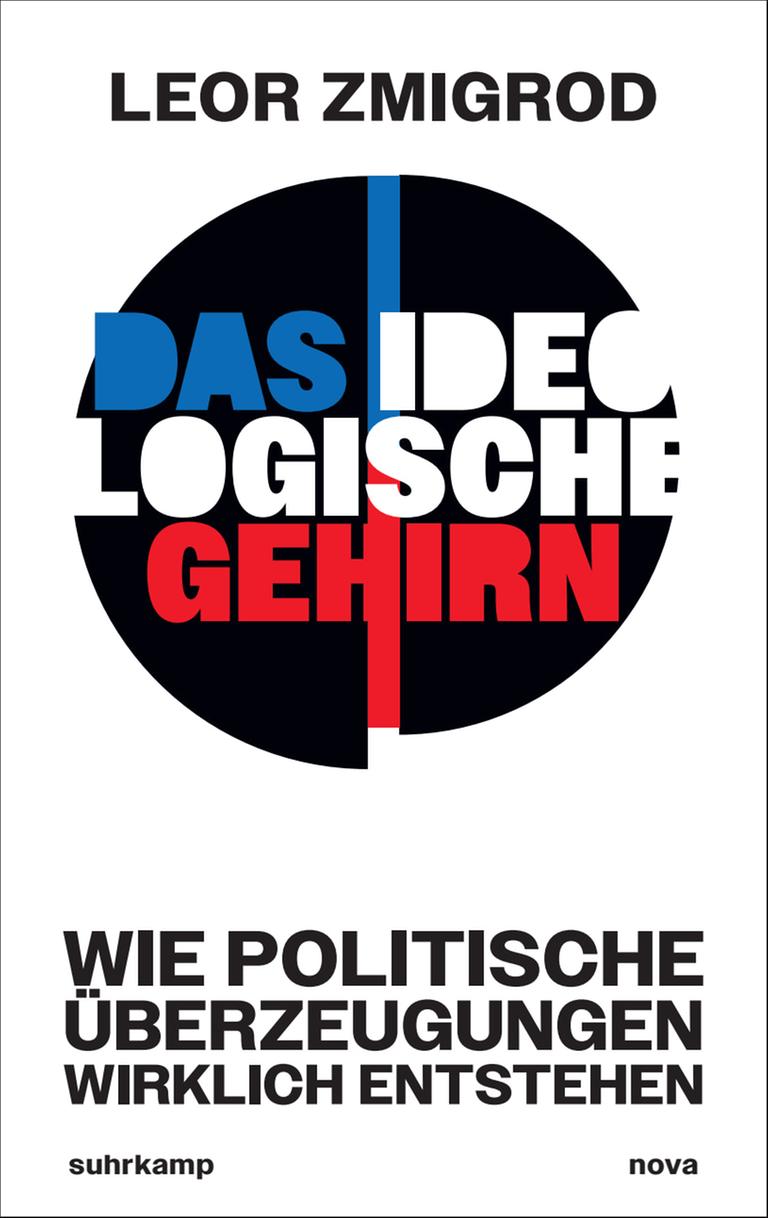
© Suhrkamp Verlag
Wie die Biologie politische Ansichten prägt
06:28 Minuten
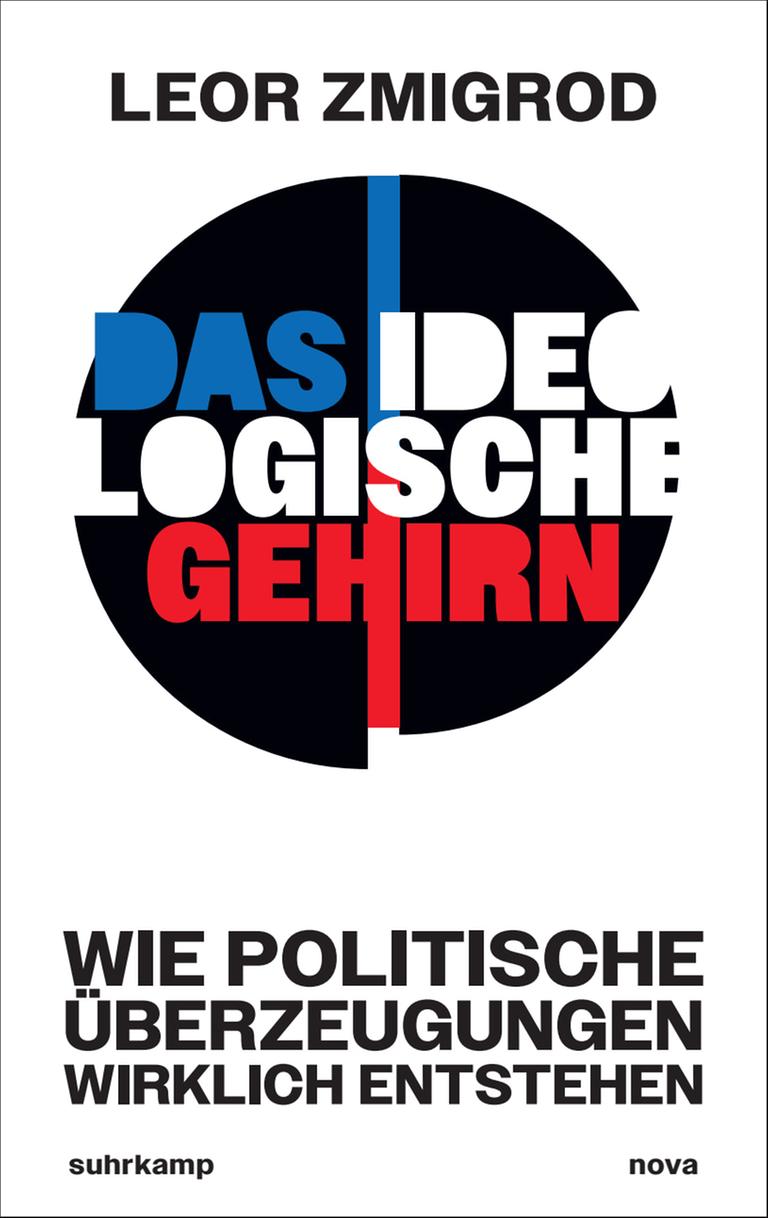
Leor Zmigrod
Matthias Strobel
Das ideologische Gehirn. Wie politische Überzeugungen wirklich entstehenSuhrkamp Verlag, Berlin 2025288 Seiten
24,00 Euro
Wer die Macht von Ideologien verstehen will, sollte sich mit dem Gehirn beschäftigen, findet Leor Zmigrod. Die Begründerin der politischen Neurobiologie erklärt in ihrem Buch, wie bestimmte Veranlagungen empfänglich machen für unsere Überzeugungen.
2015 brachen britische Frauen nach Syrien auf, um sich dem IS anzuschließen. Warum fühlten sich diese Frauen von der islamistischen Ideologie angezogen? Das wollte Leor Zmigrod von der Universität im englischen Cambridge verstehen. Und weil IS-Mitglieder nur selten bereit sind, an wissenschaftlichen Studien teilzunehmen, ging die Hirnforscherin einen Umweg. Schon 2016 bot das Brexit-Referendum die Chance, eine wenn auch ganz andere Art von Ideologie zu erforschen.
Ein einfacher Test
In einem psychologischen Test bat die Hirnforscherin, ihre Probanden Karten zu sortieren. Dabei änderten sich mitten im Test die Regeln. Manchen fiel es leicht, sich umzuorientieren, andere brauchten lange. Leor Zmigord fand heraus, dass „kognitiv rigidere Menschen eher für den Brexit stimmten“.
Für sie ein Schlüsselergebnis: Ein einfacher, psychologischer Test sagt politische Einstellungen besser voraus als beispielsweise soziale Faktoren wie Bildung oder Einkommen.
Im Buch geht es um Islamismus, den Brexit, die erste Trump-Wahl, um Öko-Extremisten und Kommunisten. All diese Ideologien eint, so die Autorin, dass sie die komplexen Probleme der Welt vermeintlich einfach erklären und klar zwischen der eigenen Gruppe und Gegnern unterschieden. Damit würden Ideologien zwei Grundbedürfnisse des Gehirns erfüllen: nach Klarheit und Zugehörigkeit.
Grundbedürfnisse: Klarheit und Zugehörigkeit
„Die neueste Forschung zeigt“, so Leor Zmigrod, „dass das menschliche Gehirn ideologische Überzeugungen geradezu aufsaugt“. Und das gelte ganz besonders für Personen mit einer „sehr rigiden Psyche“.
Flexible Menschen dagegen seien toleranter und könnten daher andere Meinungen besser akzeptieren und seien damit auch Ideologie-resistenter. Auf politischer Ebene würde deshalb die entscheidende Frage lauten: „Wie können wir Gesellschaft so entwerfen, dass Ideologien nicht die naheliegendste Lösung für die Bedürfnisse des Gehirns sind?“
In ihrem Buch spielt sie den Unterschied zwischen flexibel und festgelegt und die damit einhergehende Beziehung zu Ideologien noch mit Hilfe anderer psychologischer Tests durch, erläutert den Einfluss von Genvarianten und die Bedeutung bestimmter Hirnstrukturen.
„Der Glaube an eine rigide Doktrin ist ein Prozess, der sich bis hinein in unsere Neuronen erstreckt, der unseren Körper vereinnahmt“, heißt es an einer Stelle. Das ist immer spannend und nachvollziehbar erklärt.
Neurowissenschaft kann Debatte nicht ersetzen
Leor Zmigrod bezeichnet sich als politische Neurowissenschaftlerin und schreibt: „Diese neue Wissenschaft versucht zu erfassen, wie ideologische Überzeugungen aus der Biologie hervorgehen.“
Ein großer Anspruch, der nur teilweise eingelöst wird. Vor allem auch, weil viele Argumente unscharf wirken. Kann man wirklich eine direkte Linie von Befürwortern des Brexits zu Selbstmordattentätern ziehen? Wie eng ist die Beziehung zwischen psychologischer Rigidität und politischen Überzeugungen?
Es wird zwar auf viele Studien verwiesen, aber im Text selbst werden hier viel zu selten klare Zahlen genannt. Am Ende eröffnet „Das ideologische Gehirn“ einen spannenden neuen Blickwinkel, aber es wird auch klar, dass die Neurowissenschaft die inhaltliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Ideologien nicht ersetzen kann.