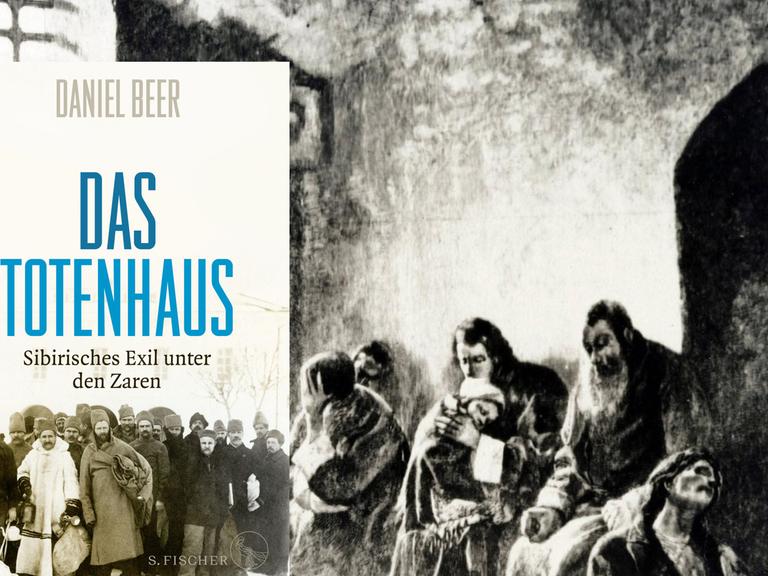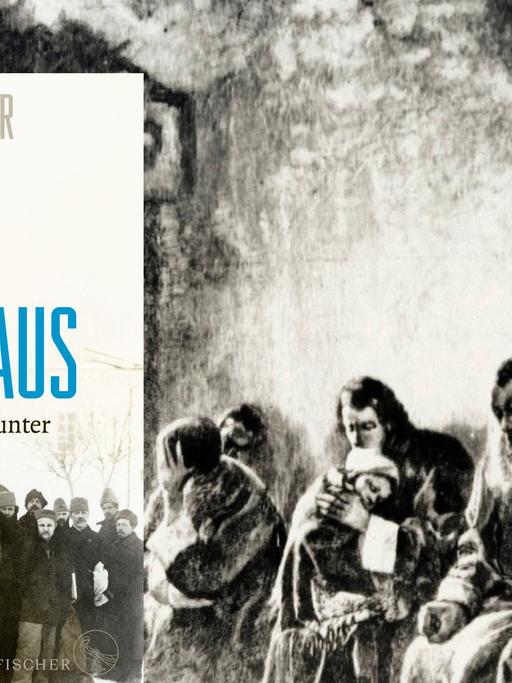40 Grad – minus
25:07 Minuten

Von Gesine Dornblüth · 03.01.2021
Zehn Monate Winter und zwei Monate Mückenplage: am russischen Nordpolarkreis ist das Leben hart. Die meisten Menschen kommen nur zum Arbeiten. Riesige Gasvorkommen werden gefördert, demnächst auch für die Ostsee-Pipeline.
Der Himmel ist schwarz, doch der Schnee am Boden scheint zu leuchten. Es ist sieben Uhr morgens in Nowyj Urengoj am Nordpolarkreis. Das Scheinwerferlicht der Müllabfuhr durchschneidet den Innenhof am Rand der Stadt. Bäume, Sträucher, Laternen sind weiß vereist.
"Heute ist ein toller Tag! Frost, aber nicht so kalt, kein Wind. So ein Wetter macht munter!"
Natalia Yando eilt durch die Eislandschaft an parkenden Autos vorbei zur Bushaltestelle.
"Wir haben 34 Grad!"
Minus, versteht sich. Natalia Yando ist auf dem Weg zu ihrer Arbeit in ein Jugendfreizeitzentrum. Sie trägt Pelzmantel und Pelzmütze. Die kalte Luft beißt in meinen Nasenschleimhäuten, und ich bin froh, dass wir so zügig gehen.
Ein toller Tag bei minus 34 Grad
"Ich habe zwei Hunde, mit denen war ich schon draußen. Es war es toll. Sie lieben den Tiefschnee. Ich muss dann hinter ihnen her kriechen. Aber das ist gesund und eine gute Morgengymnastik!"

Natalia Yando ist Kälte gewohnt. Sie stammt vom Volk der Nenzen, der Ureinwohner der Region. © Gesine Dornblüth
Natalia Yando gehört zum Volk der Nenzen, Ureinwohnern der russischen Polarregion. Die 53-Jährige ist in der Tundra aufgewachsen, ihr Vater war Rentierzüchter.
"Was haben Sie heute an? Ist das Rentierfell?"
"Nein, der Pelzmantel ist aus Nerz. Rentier ist in der Stadt unpraktisch. Die Luft ist hier sehr trocken, Rentierfell bricht dann."
Sie trägt gefütterte Stiefel mit Absätzen.
"Ich habe heute eine Menge Termine, deshalb die Stiefel. Sie sind aus Finnland, die Finnen können Schuhe für den kalten Winter machen. Schuhe aus Rentierfell sind noch wärmer, aber wenn du drinnen bist, lädt sich das Fell auf, und das Kleid und alles andere wird elektrisch. Deshalb ziehe ich Schuhe aus Rentierfell nur an, wenn ich lange Zeit an der frischen Luft bin."
Natalia Yando muss nicht lange in der Kälte warten. Ihr Bus kommt nach wenigen Minuten.
"Mit dem öffentlichen Nahverkehr bin ich sehr zufrieden, die Busse kommen hier immer pünktlich."

Nowyj Urengoj ist erst in den 60er-Jahren gebaut worden. © Gesine Dornblüth
Zur Arbeit muss Yando einmal quer durch die Stadt fahren. Der Mond steht noch hoch am Himmel. Scheinwerfer und der weiße Schnee lassen die Stadt in hellblauem Licht erscheinen: mehrstöckige, eintönige Wohnhäuser. Die Stadtverwaltung. Auf dem Platz davor Eisskulpturen. Die mächtige Zentrale eines Gasunternehmens.
Höhere Löhne, früher in Rente
Nowyj Urengoj ist eine junge Stadt. Ende der 60er-Jahre entdeckten Ingenieure hier eines der größten Gasfelder der Welt. Kurz darauf entstand eine erste Siedlung. Heute gilt Nowyj Urengoj als Gashauptstadt Russlands. Und die Arbeiter kommen aus dem ganzen Land und sogar aus den Nachbarstaaten. Die Löhne sind höher als im Rest Russlands, und wer in der Polarregion arbeitet, kann fünf Jahre früher in Rente gehen. Dafür sorgen Gesetze.
"Im Norden sind die heißen Tage das schlimmste. Den Frost kann man gut aushalten, in der Tundra sagen wir, du kannst dich richtig anziehen. Aber wenn es heiß ist, kannst du die Haut nicht ablegen. Besonders für die Rentierzüchter ist ein heißer Sommer das schlimmste. Die Trockenheit, das Ungeziefer. Die Mücken lassen dich nicht in Ruhe."
Aber der Sommer ist nur kurz, noch im Juni kann Schnee fallen, im September schon wieder, und im wärmsten Monat, im Juli, liegen die Temperaturen im Schnitt gerade mal bei 14 Grad. Plus, immerhin.

Obst und Gemüse müssen von weit hergebracht werden und sind teuer.© Gesine Dornblüth
Ein paar Straßenecken weiter in einem der wenigen Hotels in Nowyj Urengoj. Eine Gruppe Deutscher und ihre Dolmetscherin stehen unschlüssig im Foyer herum. Auf einer Sitzgruppe stapeln sich Klamotten: Schals, Mützen, Thermolatzhosen und dicke Jacken.
Draußen eisig, drinnen überheizt
In der Mitte steht Ingo Neubert, das blasse Gesicht ein wenig verschwitzt.
"Im Norden wird gut geheizt, und es ist sehr viel wärmer als in einer typischen deutschen Wohnung."
Die Deutschen sind aufgeregt. Die meisten sind das erste Mal in einer so kalten Gegend. Keiner weiß so richtig, was er anziehen soll. Draußen minus 38 Grad. Aber erst einmal geht es in einen geheizten Bus.
Ingo Neubert arbeitet für Achimgaz, ein deutsch-russisches Joint Venture, das in der Polarregion Gas fördert.
"Wir warten noch auf zwei Personen, dann fahren wir, sagen wir, 17 Minuten mit dem Bus und fliegen dann gleich mit dem Hubschrauber 'ne halbe Stunde."
Neubert lebt seit acht Jahren in Nowyj Urengoj und hat das Unternehmen mit aufgebaut. Er hat die Journalistengruppe eingeladen, auch mich. Für Ausländer gelten in Nowyj Urengoj Sonderregeln. Neubert hat uns alle beim russischen Geheimdienst angemeldet und unterschrieben, dass keiner von uns gegen Gesetze verstoßen wird.
"Man hilft sich gegenseitig, man kennt sich."
Eine Mitarbeiterin der Presseabteilung begleitet mich deshalb zu fast allen Terminen. Sie hat auch die meisten Gesprächspartner ausgesucht, gemeinsam mit der Stadtverwaltung.
Im Bus zeigt ein Laufband die Temperatur an. 24 Grad plus. Auch der Hubschrauber ist geheizt.
Ich sitze auf einer Pritsche direkt über dem Heizungsgebläse. Jacke aus, Gehörschutz auf die Ohren.
Ruckelnd hebt der Hubschrauber ab. Allmählich wird es draußen heller. Durch die Fenster ist endloses Weiß zu sehen. Dazwischen, wie einzelne Zahnstocher, Strom- und Funkmasten, ein paar Nadelbäume. Ab und zu eine Straße.
"Dort, wo wir jetzt konkret fliegen, war vor einem Jahr noch nichts, alle Wege sind erst in diesem Jahr entstanden."
Ingo Neubert kniet zwischen den Journalisten. Er freut sich, zeigen zu können, was hier in der Abgeschiedenheit unter extremen Bedingungen geleistet wird.
"Ich arbeite sehr gern mit den Menschen zusammen. Das ist eine enge Zusammenarbeit. Die ist deshalb enger, weil man weiß, dass man alle Probleme selbst lösen muss, man hilft sich gegenseitig, man kennt sich, die Zusammenarbeit setzt sich in der Freizeit fort."

Sein Zuhause ist das Fitness-Center: Konstantin Pawlow.© Gesine Dornblüth
Freizeit, das heißt in Nowyj Urengoj vor allem Sport.
Vormittags im Fitness-Center "Zvezdnyj". Ein Mann und eine Frau wärmen sich auf Laufbändern auf. Es riecht nach kaltem Schweiß und Putzmittel. Im Nachbarraum hebt ein stämmiger kleiner Mann Gewichte auf eine Stange.
Konstantin Pawlow ist mehrfacher Weltmeister im Powerlifting und arbeitet hauptberuflich als Fitnesstrainer.
"Powerlifting ist eine amerikanische Erfindung. Es gibt diesen Sport seit etwa 60 Jahren, und er umfasst drei Disziplinen: Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. In anderen Regionen sieht man Betrunkene auf den Straßen. Hier nicht. Hierher kommen die Leute zum Arbeiten."
Sporthallen gibt es mehr als genug
Sport ist in Nowyj Urengoj wichtig. Und er findet überwiegend drinnen statt, wegen der Kälte.
"In Nowyj Urengoj werden ständig neue Hallen gebaut, damit die Leute Sport treiben. Und sie tun das auch."
Mit Erfolg. Die Volleyball-Damen und -Herren von "Fakel Nowyj Urengoj" spielen in der russischen Superliga, gesponsert unter anderem von der örtlichen Gazprom-Tochter und von Achimgaz. Pawlow trägt weitere Gewichte herbei. Seine Schritte sind kurz und schnell, er geht sehr aufrecht. Eigentlich stammt er aus Kemerowo.
"Das ist auch in Sibirien, eine Bergarbeiterstadt. Aber bei uns in Kemerowo gibt es vier Jahreszeiten, hier ist fast immer Winter. Einmal habe ich bei einem Wettkampf den Trainer aus Nowyj Urengoj getroffen. Er lud mich zu einem Wettkampf hier her ein. Es war Dezember, grimmiger Frost, noch kälter als heute, so um die minus 58 Grad. Aber es hat mir gefallen, und im Jahr 2000 bin ich hierher gezogen."
Eine Frau kommt, Pawlow nickt ihr zu, schließt einen Schrank auf, reicht ihr Trainingsgerät. Man kennt sich.
Stalin wollte eine Eisenbahnlinie quer durch das Eis
Die ersten Arbeiter, die das heutige Nowyj Urengoj erreichten, kamen nicht freiwillig. Hier verlief Stalins Irrsinnsprojekt, die "Tote Trasse", eine Eisenbahnlinie 1500 Kilometer quer durch das Eis, den Nordpolarkreis entlang bis zum Fluss Jenissej. Gebaut ab 1949 von Gulag-Insassen, lange, bevor das große Gasfeld entdeckt wurde.
Tausende Arbeiter starben. Der Bau scheiterte, nur eine Teilstrecke nach Nowyj Urengoj wurde fertiggestellt, das Projekt nach Stalins Tod begraben. Unvorstellbar, wie Menschen in der unwirtlichen Region überleben und arbeiten konnten, ohne Schutzkleidung, ohne vernünftiges Essen.
"Ich verstehe das auch nicht. Ich bin ja erst 1973 geboren, da war das Leben schon komfortabler. Auch wie die Bohrarbeiter bei minus 70 Grad arbeiten konnten, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe mal mit einem gesprochen, der hat mir gesagt: Du musst viel zwinkern, damit die Augen nicht einfrieren."

Autorin Gesine Dornblüth, witterungsbedingt dick eingepackt© Gesine Dornblüth
Der Hubschrauber mit der Journalistengruppe ist auf einer Baustelle gelandet. Sand ist aufgefahren, zwei Meter hoch, auf einer Fläche, groß wie mehrere Fußballfelder. Wir sind rund 200 Kilometer nördlich von Nowyj Urengoj. Am Horizont geht milchig die Sonne auf.
Hier soll demnächst Gas aufbereitet werden, um nach Westeuropa zu strömen, unter anderem durch die Ostsee-Pipeline.
Ein Kipplaster bringt noch mehr Sand, eine Planierraupe walzt ihn platt. Ein eisiger Wind bläst die Abgaswolken der Fahrzeuge waagerecht davon. Die Arbeiten müssen im Winter gemacht werden. Von Juli bis August taut der Permafrostboden an, die Eislandschaft verwandelt sich in eine Schlammwüste, wird unbefahrbar.
Vitamine sind wichtig, aber Frisches ist schwer zu bekommen
Ingo Neubert stellt sich mit dem Rücken zum Wind.
"Ich bin im Grunde jede Woche hier draußen, es ist wichtig, Präsenz zu zeigen, Probleme sofort zu lösen…"
An Neuberts Wimpern bilden sich Eiskristalle.
"Ja, man muss schon drauf achten, auf seine Ernährung, man muss sich ausreichend bewegen, gesund bewegen, man muss aufpassen, dass man nicht krank wird. Ich mache alle möglichen Arten von Sport. Im Sommer hab ich mir mittlerweile ein Fahrrad zugelegt und fahre viel umher. Ich gehe joggen, selbst im Winter, das geht bis etwa minus 25 Grad, ich fahre viel Ski. Vitamine, das ist das Wichtigste, gesunde, frische Produkte."
Das mit den Vitaminen ist nicht so einfach. Alle Lebensmittel müssen Tausende Kilometer nach Nowy Urengoj transportiert werden, mit dem Flugzeug, per LKW. Die Äpfel in den Läden sind klein und schrumpelig, frisches Gemüse ist teuer.
Alle haben es sehr eilig, zurück in den Hubschrauber zu kommen, denn der Wind schneidet in die Wangen.
Ich muss an meinen letzten Aufenthalt in der Gegend denken. Meine Nase fror mir ein. Ich hatte es gar nicht gemerkt, doch ein Einheimischer sprach mich damals an, ich solle sofort in die Wärme gehen und mal in den Spiegel schauen. Erfrierende Haut färbt sich weiß. Später pellt sie, wie bei einem Sonnenbrand. Das will ich nicht noch mal riskieren.
Und jetzt freue ich mich über das Heizungsgebläse. Es dauert, bis ich wieder warm werde.

Die Zelte der Nenzen sind der wichtigste Schutz in der lebensfeindlichen Umgebung. Innerhalb weniger Stunden können die Behausungen ab und aufgebaut werden und haben Form und Struktur in 3000 Jahren nicht verändert.© Jan Lieske
Im Jugendfreizeitzentrum ist es kalt. Natalia Yando, die Nenzin, hat ihren Nerzmantel abgelegt. Darunter trägt sie ein kurzärmliges Kleid. Immerhin hängt sie sich eine Stola über die Schultern. Am Vormittag sind noch keine Kinder da, und so führt sie mich ein bisschen herum.
"Wir bringen den Kindern die Traditionen, den Alltag und die Kultur der indigenen Völker der Region nahe."
Die Nenzen sind das Urvolk des Nordpolarkreises
In der Ecke des Raums steht eine Art Indianerzelt, bespannt mit Rentierfellen. Ein Tschum. So heißt das Zelt der Nenzen. In Vitrinen Handtaschen aus Rentierfell, Püppchen aus Knochen, geschnitzte Reusen, Wildtierfallen aus Holz. Yando zeigt das lederne Gewand eines Schamanen, über und über behängt mit Glöckchen, Tierzähnen, einer Bärentatze.
Sie glaubt an die Gesetze ihres Volkes.
"Nenzen kennen zum Beispiel kein Wort für 'man darf nicht'. Sie sagen stattdessen 'kíwy'. Das heißt, ‚es ist verboten, sonst passiert ein Unheil‘."
Yando findet, dass die Kinder in Nowyj Urengoj viel von den Nenzen lernen können.
"In der Tundra werden Kinder niemals bestraft, stattdessen gehen die Erwachsenen mit gutem Beispiel voran. Ein Nenze darf zum Beispiel nicht fluchen, andernfalls, heißt es, bekommt er Mundgeruch, und niemand mag mehr mit ihm reden. Man darf auch nichts ins Wasser werfen, keinen Schnee, keine Steine – sonst blendet man die Wasserlebewesen und erblindet selbst."
Yando bückt sich, kriecht in den Tschum und holt eine Tasche hervor, sorgfältig gearbeitet aus vielen Fellstreifen in unterschiedlichen Beige- und Brauntönen. Die hat sie von ihrer Mutter geerbt.
"Jeder Streifen zeigt die Harmonie zwischen Tag und Nacht, zwischen Gut und Böse. Die Rückseite ist aus einem Stück Pelzmantel, bei dem das Fell schon abgerieben, das Leder aber noch in Ordnung war. In der Tundra wird alles weiterverwertet. Mit der Natur wird sparsam gehaushaltet."
Die Schwester ruft an. Sie ist Fischerin und lebt noch in der Nenzensiedlung, in der auch Natalia Yando zur Welt kam, rund 300 Kilometer nordöstlich von Nowy Urengoj. Die beiden sprechen Nenzisch miteinander.
Die Nenzen passen sich den Pipelines an, nicht umgekehrt
Natalia Yando kam mit acht Jahren in ein Internat. Zwangsweise. Beamte sammelten sie und die anderen Kinder zum Schuljahresbeginn mit dem Hubschrauber ein. Auch heute wachsen die Kinder der Nomaden in Internaten auf, verbringen nur die Sommerferien bei ihren Familien. Natalia Yando blieb nach der Schule in der "Zivilisation", wie sie es nennt. Ihre 14 Geschwister sind in die Tundra zurückgekehrt. Das Leben dort verändert sich, auch unter dem Einfluss der Gas- und Ölindustrie.
"Dort, wo ich geboren wurde, wird jetzt eine neue Gasförderstätte gebaut. Meinen Verwandten sagen, sie sehen dadurch mehr Vor- als Nachteile. Erstens haben sie es nicht mehr so weit zum Einkaufen. An den Bohrstellen werden die Arbeiter verpflegt, und unsere Leute können dort Brot und Sprit für ihre Schneemobile kaufen oder gegen Fleisch tauschen. Die Nachteile… Mittlerweile halten sich die großen Betriebe an die Umweltauflagen und hinterlassen keinen Müll mehr. Das war anfangs ein großes Problem. Alles blieb in der Tundra zurück, Metall, Glas. Jetzt wird es fortgeschafft."

Die Nenzin Galina beim Zerteilen von Fleisch© Jan Lieske
Was bleibt, sind Öl- und Gas-Pipelines. Sie durchschneiden die angestammten Routen der Nomaden. Jeden Sommer ziehen sie mit ihren Rentierherden hunderte Kilometer hinauf noch weiter in den Norden.
"Die Pipelines sind sicher ein großes Minus. Aber mittlerweile sind die Rentiere sozialisiert, sie können die Pipelines leicht überwinden: Im Sommer laufen sie darunter durch, im Winter sind die Röhren mit Schnee bedeckt und leicht zu überqueren. Und der moderne Nenze richtet seine Routen nach den Pipelines aus. Er treibt sie längs der Röhren, eine Familie auf der einen, eine Familie auf der anderen Seite. Sie verstehen, dass sich die Region ohne Gas und Öl nicht entwickeln kann."
Manche sind aus freien Stücken im Eis geblieben
Es ist zwei Uhr und wird schon wieder dunkel.
Viktor Selivjorstov bekommt davon nichts mit. Er beugt sich beim Licht einer Neonlampe über ein Stück Holz und schnitzt Linien heraus. Späne fliegen. Die Konturen eines Mammuts sind zu erkennen.
"Das ist ein gefragtes Souvenir. Was kann man schon aus dem Norden mitbringen? Mammuts."
Selivjorstovs Werkstatt ist in einer fensterlosen Garage, einer dieser gemauerten Boxen, wie sie überall in Russland in langen Reihen neben den Hochhausblöcken stehen. Von der Decke hängt ein Heizstrahler, es ist sehr warm.

Der Künstler Viktor Selivjorstov hat sich an die Kälte gewöhnt – und ist geblieben.© Gesine Dornblüth
Selivjorstov kam mit 23 Jahren als Ölarbeiter nach Nowyj Urengoj, 1979 war das, und hat an unzähligen Bohrungen mitgewirkt. Mittlerweile ist er Rentner und immer noch hier. Eine Ausnahme. Die meisten Menschen verlassen die Polarregion wieder, sobald sie in Rente gehen.
Selivjorstov bietet Tee und Kaffee an. Dazu stellt er ein Glas Marmelade auf die Werkbank. Selbstgemacht.
"Diesen Sommer bin ich mit einem Freund den Fluss Tas hochgefahren, 300 Kilometer weit hinein in die wilde Natur. Dort waren gerade die Heckenkirschen reif."
In den Regalen lagern Skulpturen, Fratzen, hockende Gestalten, mal Tier, mal Mensch, mit kugeligen Bäuchen und dicken Nasen, aus Holz, aus Rinde, aus Elfenbein. Selivjorstov räumt einen Karton zur Seite und holt sehr vorsichtig ein etwa ein Meter langes gelbliches geschwungenes Ding hervor.
"Man könnte es für ein Stück Holz halten. Aber das ist der Stoßzahn eines Mammuts. Zehn Kilo schwer. Der ist wie ein Stein."
Einst haben am Nordpolarkreis Mammuts gelebt.
"Solche Stoßzähne werden hier immer mal wieder zufällig gefunden. Von Anglern, Jägern und den Ureinwohnern der Tundra. Wenn im Frühjahr die Flüsse ansteigen, waschen sie die Ufer aus. Der Boden taut dann ein wenig an und bröckelt. Manchmal kommen dann Stoßzähne zum Vorschein. Diesen hat mir ein Kunde gebracht."
"Wenn die Heizung einfriert, ist es zu Ende"
Selivjorstov ist berühmt, wird zu Ausstellungen und Wettbewerben in ganz Russland eingeladen. Oft fährt er mit dem Auto. Nach Salechard zum Beispiel, das liegt auch so hoch im Norden.
"Nach Salechard gibt es keine richtige Straße, sondern nur einen Simnik, eine Wintertrasse. Sobald der Boden gefroren ist, wird der Schnee glatt geschleppt, und dann fährst du mitten durch die Tundra. Das ist furchteinflößend. Ich fahre die Strecke nie ohne einen Vorrat an Benzin, warme Kleidung und ausreichend Lebensmittel. Wenn du unterwegs liegenbleibst, kannst du zehn oder zwölf Stunden warten, bis ein Auto vorbeikommt."
Bei Frost unter 40 Grad werden die Straßen gesperrt, Wagen nur in Kolonnen aus der Stadt gelassen.
"Es gab hier so einen lokalen Zusammenhalt. Wenn du in dieser Gegend lebst, weißt du, wenn deine Heizung einfriert, ist es zu Ende. Es ist eben extrem. Du musst dich aufeinander verlassen können. Anders hätten wir diese Stadt nicht aufbauen können. Es hat wirklich jeder dem anderen geholfen. Jetzt hat sich die Situation ein bisschen geändert. Vielleicht haben die bequemeren Lebensbedingungen dazu geführt. Diebstahl und unsoziales Verhalten gibt es jetzt auch hier, wie in allen großen Städten, in allen Ländern."
Trotzdem will Selivjorstov in Novyj Urengoj bleiben.
"Ich könnte weggehen, in angenehmere Breiten, nach Simferopol, in die Türkei. Aber für mich ist das nichts. Die Hitze ertrage ich nicht mehr, und ich finde es nicht interessant dort. Diese Stadt ist vor meinen Augen gewachsen. Ich habe daran mitgearbeitet. Ich habe hier sehr viele Bekannte. Und was wohl am wichtigsten ist: Ich fühle mich hier gebraucht. Ich kann wahrscheinlich gar nicht mehr ohne Novyj Urengoj. Ich bin wohl selbst schon ein Mammut."
Es ist vier Uhr nachmittags. In der Tundra ist es stockfinster. Die Journalistengruppe steht an einem Bohrturm. Die letzte Station an diesem Tag. Scheinwerfer tauchen das metallene Gerüst in gelbes Licht. Ingo Neubert zieht seine Fellmütze tiefer ins Gesicht:
"Wir sind jetzt auf einem der Plätze, bei denen die Achimgaz neue Bohrungen errichtet. In 4000 Meter Tiefe befindet sich unsere Lagerstätte, aus der wir in etwa einem Jahr fördern wollen."
Die Tage vergehen mit Arbeiten und Schlafen
Der Wind ist immer noch schneidend. Zum Glück gibt es eine Halle, die wir besichtigen. In der Halle leben die Arbeiter. In Wohncontainern, die dicht nebeneinander stehen. Der Boden ist gefroren. Niemand ist zu sehen, alle sind entweder draußen bei der Arbeit, oder sie schlafen. Schichtbetrieb eben.

Es gibt Kohl für die Arbeiter. Gemüse und Obst sind teuer. © Gesine Dornblüth
In einem Container brennt Licht, und die Scheibe ist beschlagen. Hier ist der Arbeitsplatz von Galina Netschajewa. Sie winkt mich herein. Die 52-Jährige rührt in einem riesigen Kochtopf mit Kohl, darin garen große Stücke Hammelfleisch. Das Abendessen. Ihr Gesicht strahlt unter der weißen Haube. Galina Netschajewa kocht für 50 Personen.
"Ich arbeite seit fünf Jahren hier im Norden. Immer zwei Monate, einen Monat bin ich zu Hause. Ich wohne im Altaj-Gebiet. Bei uns gibt es auch solche Minustemperaturen. Aber bei uns windet es nicht so."
Der Altaj liegt nahe der Mongolei. Galina Netschajewa fährt mit der Bahn zur Arbeit, drei Tage dauert das.
"Ein Flugticket wird nicht erstattet. Damit wäre ich in zwei Stunden hier. Das wäre natürlich besser. So geht eine Woche für die Hin- und Rückfahrt drauf, und ich habe nur drei Wochen zu Hause. Drei Wochen sind sehr wenig."
Trotzdem kommt sie immer wieder.
"Ich habe einen Sohn und eine Enkeltochter. Wenn ich nach Hause komme, kaufe ich für sie ein, Kleider, Schuhe. Ich helfe natürlich finanziell. Und wir bauen ein Haus. Bei uns sind die Löhne niedrig. Ein Koch verdient 12 bis 15.000 Rubel. Hier bekomme ich 35.000. Die Bedingungen sind gut. Die Bahnfahrt wird bezahlt, die Verpflegung, die Unterkunft."
Die Tage vergehen mit Arbeiten und Schlafen. Warum vor die Tür gehen, wenn es dauernd kalt und dunkel ist?
"Im Sommer gehen wir raus. Wir sammeln Pilze und Heidelbeeren. Du kriegst ja Kopfschmerzen, wenn du immer nur im Container sitzt."
"Jedes Mal sage ich mir: Ich fahre nie wieder in den Norden"
Am Küchentisch lehnt Abdunasar Abdualimov. Er behält seine Wollmütze auch in dem überheizten Container auf. Er lächelt. Abdualimov kommt aus Usbekistan, immer für ein halbes Jahr.
"Ich bin schon zum dritten Mal hier."
Auch Abdualimov kommt des Geldes wegen, er muss vier Kinder ernähren. In der Containerhalle arbeitet er als eine Art Hausmeister, sorgt für Ordnung. Er will mir einen Wohncontainer von innen zeigen.

In solchen Wohncontainern sind die Arbeiter untergebracht.© Gesine Dornblüth
"Als ich zum ersten Mal hier ankam, habe ich gedacht: Wo bin ich bloß gelandet. Aus dem Flugzeug heraus war überall nur Sumpf zu sehen. Ich habe richtig Angst bekommen, als ich runter geschaut habe. Dann habe ich mich daran gewöhnt. Hauptsache, die Arbeit stimmt."
Der Wohncontainer ist unterteilt: Ein kleiner Flur mit Waschbecken, Regalen. Rechts und links je eine Tür.
Vorsichtig drückt Abdualimov die Klinke herunter. Im Halbdunkel sind zwei Pritschen zu sehen. Zwei Männer schlafen. Stickige Luft schlägt uns entgegen. Der Raum ist nur wenig größer als ein Bahnabteil.
"Die beiden sind morgens um 4 Uhr aufgestanden und ruhen sich jetzt aus. Sie könnten eigentlich mal aufstehen."
"Jedes Mal sage ich mir: Noch mal fahre ich nicht in den Norden. Jetzt muss ich noch bis zum Frühjahr aushalten. Dieses Mal war bestimmt das letzte Mal."
Wahrscheinlicher ist: Er kommt wieder. So wie die meisten hier. Weil die Löhne stimmen, aber vielleicht auch einfach, weil sie der Polarkreis nicht wieder los lässt.
Die Reportage wurde am 17. Februar 2019 erstmals ausgestrahlt.