Sendung
Kulturpresseschau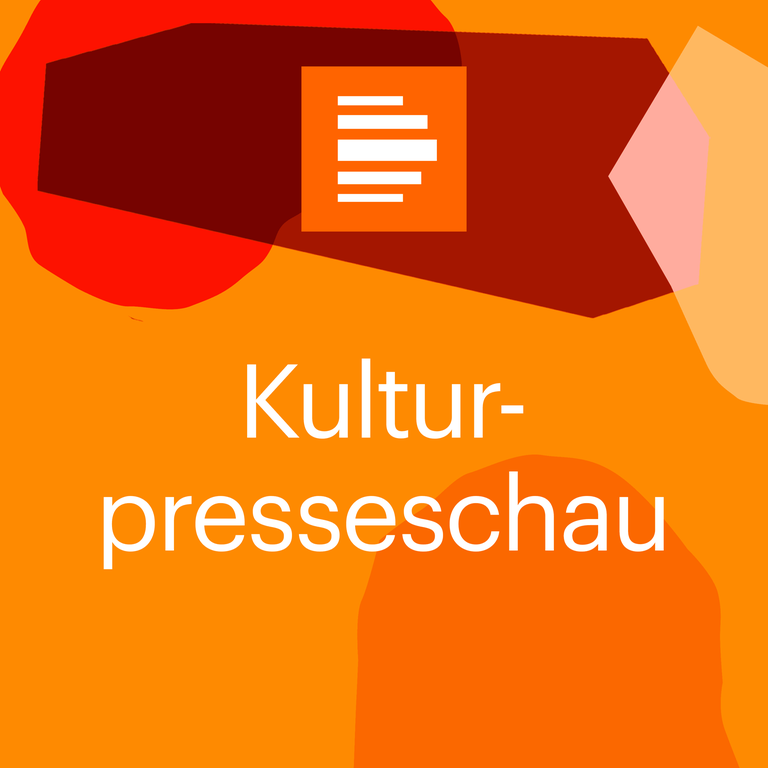
Montag - Freitag • 05:50 Uhr und 23:50 Uhr | Samstag und Sonntag • 23:50 Uhr
Playlist zur SendungUnser Blick in die Feuilletons des Tages.
Sendung
Kulturpresseschau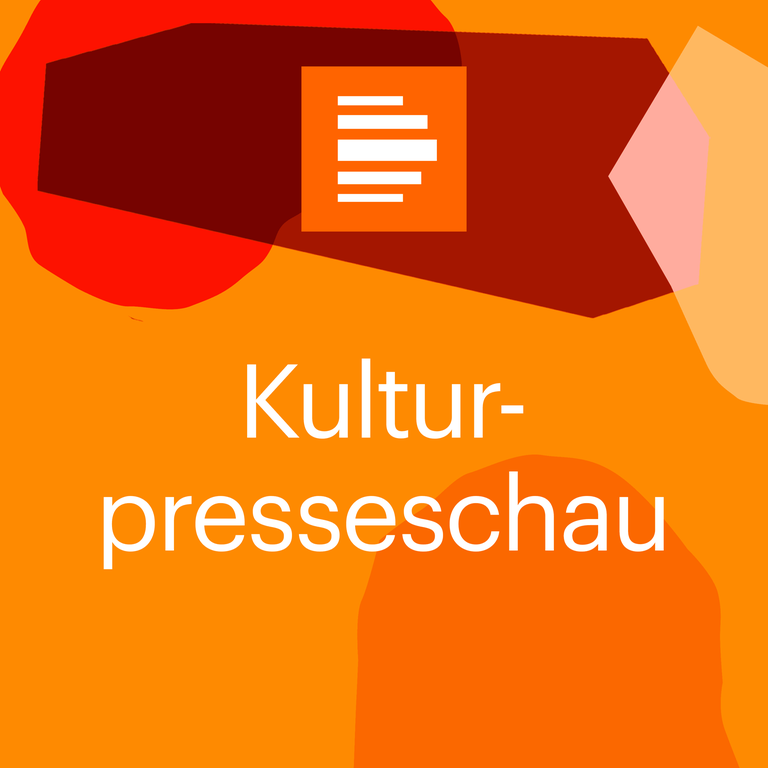
Montag - Freitag • 05:50 Uhr und 23:50 Uhr | Samstag und Sonntag • 23:50 Uhr
Playlist zur SendungUnser Blick in die Feuilletons des Tages.