Taina Tervonen: „Die Reparatur der Lebenden“
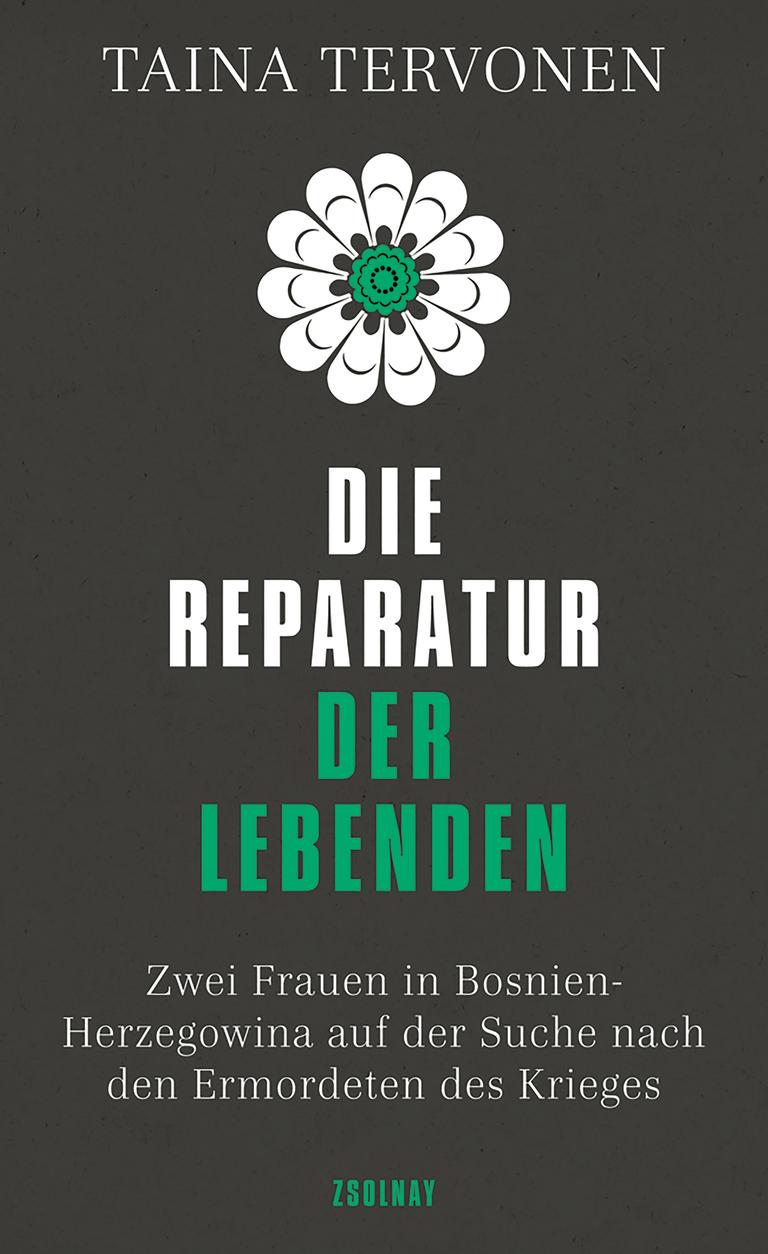
© Hanser Literaturverlage/Zsolnay
Den Toten des Bosnien-Kriegs einen Namen geben
07:07 Minuten
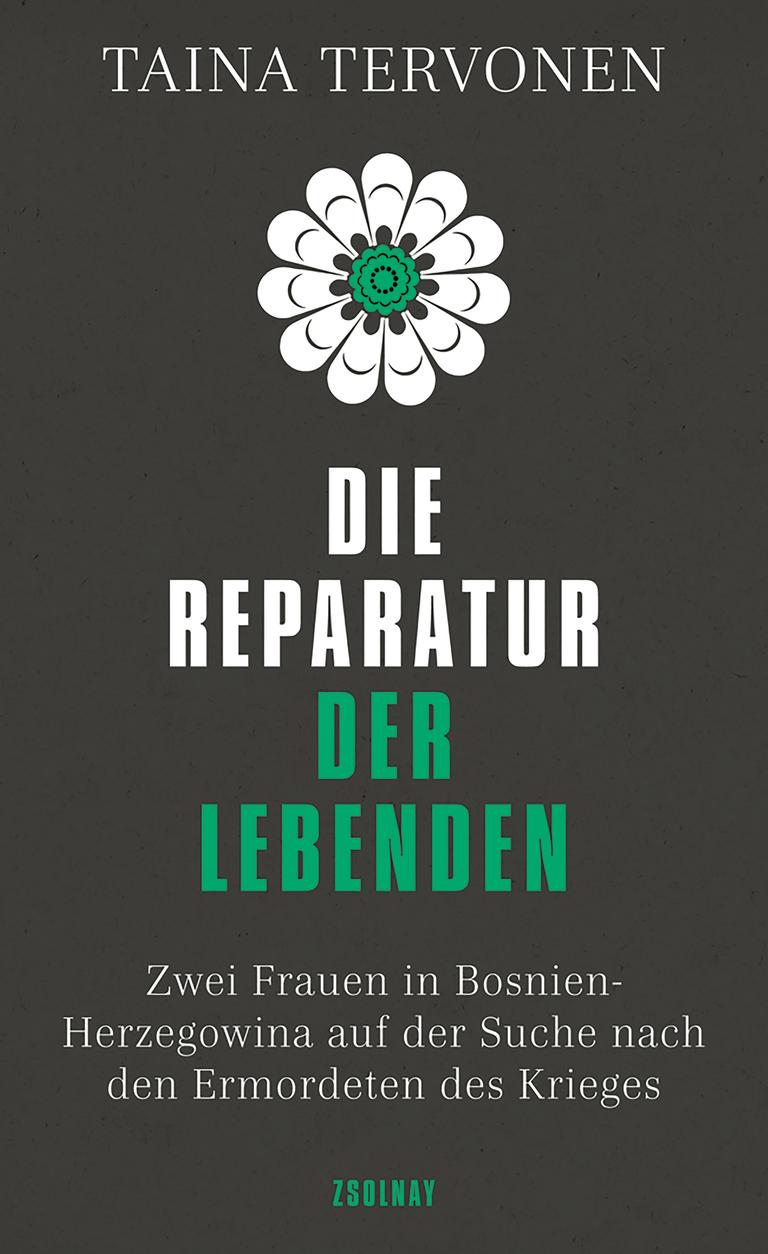
Taina Tervonen, Übersetzt von Patricia Klobusiczky
Die Reparatur der Lebenden: Zwei Frauen in Bosnien-Herzegowina auf der Suche nach den Ermordeten des KriegesPaul Zsolnay Verlag, Wien 2025208 Seiten
25,00 Euro
Im Bosnien-Krieg starben 110.000 Menschen. 30 Jahre später sind noch immer Tausende Leichen nicht identifiziert. Wie eine Anthropologin das ändern wollte, erzählt das Buch „Die Reparatur der Lebenden“ beeindruckend und lesenswert.
Gleich zu Beginn fragt sich die Autorin:
„Wie soll man gleichzeitig um seine Großeltern, seinen Vater und seinen jugendlichen Bruder trauern, wenn doch jeder einzelne Tod an sich schon schrecklich ist?“
Die Angehörigen von Mirsad wurden 1992 im Bosnien-Krieg ermordet. Doch bestatten kann er sie erst 22 Jahre später.
Es ist eine der Geschichten in dem beeindruckenden und lesenswerten Buch „Die Reparatur der Lebenden“. Im Bosnien-Krieg, der von 1992 bis 1995 anhielt, starben 110.000 Menschen, überwiegend Zivilisten, mehrheitlich muslimische Bosniaken. 30.000 der Ermordeten wurden damals zunächst vermisst; 8.000 von ihnen bis heute. Ihre Leichen fehlen und den Angehörigen die Gräber, um zu trauern.
Von der Suche nach diesen Vermissten erzählt Taina Tervonen. Sie arbeitet in Paris als Dokumentarfilmerin und Journalistin für französische und finnische Medien. Zwischen 2010 und 2020 reiste sie immer wieder nach Bosnien-Herzegowina und begleitete die Anthropologin Senem sowie die Ermittlerin Darija.
„Mit jedem geborgenen Knochen, jedem gesammelten Blutstropfen stellen Senem und Darija in geduldiger Kleinarbeit das Band wieder her, das immer dann reißt, wenn die Toten ihrer Würde beraubt werden und den Lebenden der Abschied verwehrt bleibt, ohne den sie kaum weitermachen können.“
Senem arbeitete damals für die Internationale Kommission für Vermisste Personen, kurz ICMP, in Bosnien. 2013 gruben sie und ihr Team fast 400 Leichen aus einem Massengrab bei Tomašica aus, im Nordosten von Bosnien-Herzegowina. Die Toten waren tief in der Erde verborgen, um Kriegsverbrechen zu kaschieren. Präzise und nüchtern beschreibt Tervonen die Arbeiten. In der Leichenhalle wurden später die menschlichen Überreste gereinigt, sortiert; alles wurde dokumentiert.
Viele Tatorte: Nicht nur Srebrenica wird beleuchtet
Mit den Geschichten der Angehörigen im Buch verdichten sich die Gräueltaten des Bosnien-Krieges. Im Juli 1995 ermordeten bosnisch-serbische Soldaten in Srebrenica mehr als 8.000 muslimische Jungen und Männer. Der Genozid steht für den Bosnien-Krieg, aber eben nicht allein. Tervonen erzählt von kleinen, unbekannten Dörfern, deren muslimische Bevölkerung ermordet oder vertrieben wurde. Es ist ein großes Verdienst des Buches, auch diese Tatorte zu beleuchten.
Es erschien 2021 auf Französisch und wurde mittlerweile in verschiedene Sprachen übersetzt, auch ins Bosnische. 2020 veröffentlichte Tervonen vorab einen Dokumentarfilm dazu.
Als Buchautorin ist sie eine großartige Erzählerin; auch die Übersetzung aus dem Französischen ist ausgezeichnet. All das Wissen, um die komplizierte Identifizierung der Toten zu verstehen; die verschiedenen Orte und historischen Rückblicke verwebt die Autorin gekonnt mit den Geschichten der Angehörigen sowie von Senem und der Ermittlerin Darija.
„Darija entwirrt keine Knochen, sie sondiert Familiengeschichten und die Erinnerungen der Lebenden.“
Auch Darija arbeitet für die ICMP, Abteilung Blutproben. Sie fährt quer durchs Land und besucht die Hinterbliebenen; sie nimmt Blutproben und sammelt Informationen zu den Vermissten: Gewicht, Haarfarbe, Datum des Verschwindens. Nur so lassen sich die Toten identifizieren, die Senem ausgräbt.
So nah die Autorin den Protagonisten kommt, verfällt sie nie in Schwarz-Weiß-Antworten, um den Krieg zu erklären. Zugleich beschreibt sie die anhaltenden Ressentiments und das Leugnen. Das Massengrab von Tomašica wurde in der Republik Srpska gefunden, einer Teilregion von Bosnien-Herzegowina.
„In dieser Gegend, in der eine Mehrheit von Serben lebt, schweigen alle. Niemand erwähnt, was vorgefallen ist, weder die Täter noch die Opfer. Offenbar ist Schweigen der Preis, der gezahlt werden muss, damit alle wieder nebeneinander existieren können. Für die Überlebendenverbände ist es sehr schwer, sich zu konstituieren und überhaupt Gehör zu verschaffen“, so die Autorin.
Massive sexualisierte Gewalt wird nur angedeutet
Was dem Buch fehlt, ist ein Info-Text, der den Bosnien-Krieg und die Folgen skizziert. Das Abkommen von Dayton beendete 1995 den Bosnien-Krieg – und gab Bosnien-Herzegowina seine komplizierte föderale Ordnung. Auch deutet Tervonen nur einmal im Buch die massive sexualisierte Gewalt an, die den Krieg kennzeichnete, ohne die Verbrechen explizit zu nennen.
30 Jahre nach Kriegsende sind die nationalistischen Töne zurück und werden immer lauter: Führende bosnisch-serbische und serbische Politiker leugnen den Genozid von Srebrenica.
Umso wichtiger ist das Buch „Reparatur der Lebenden“, das überzeugend die Arbeit von Senem und Darija einfängt: Wie sie improvisieren, weil mal wieder Gelder fehlen; wie belastend ihre Arbeit ist – und sie genau wissen, warum sie ihre Arbeit tun. Die so wichtig ist, findet Tervonen.
Umso wichtiger ist das Buch „Reparatur der Lebenden“, das überzeugend die Arbeit von Senem und Darija einfängt: Wie sie improvisieren, weil mal wieder Gelder fehlen; wie belastend ihre Arbeit ist – und sie genau wissen, warum sie ihre Arbeit tun. Die so wichtig ist, findet Tervonen.
„Solange sich Leute finden, die diese Arbeit auf sich nehmen, die das reparieren, was vernichtet und mit Füßen getreten wurde, bleibt etwas von unserer Menschlichkeit erhalten, unser aller Menschlichkeit.“
Die Kriege auf dem Balkan in den 1990er-Jahren waren eine Zeitenwende – noch vor dem Ukraine-Krieg. Der Bosnien-Krieg war der schlimmste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg – bis zum russischen Überfall auf die Ukraine 2022.
Das Buch erinnert an diesen Krieg und die anhaltende Aufarbeitung. Dazu gehören auch die Suche nach den Ermordeten, die Geschichten der Angehörigen und die Arbeit von Senem und Darija.
Das Buch erinnert an diesen Krieg und die anhaltende Aufarbeitung. Dazu gehören auch die Suche nach den Ermordeten, die Geschichten der Angehörigen und die Arbeit von Senem und Darija.












