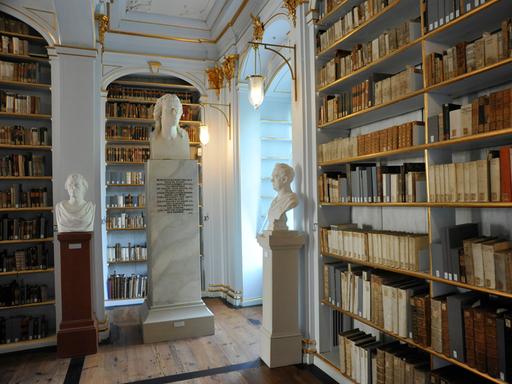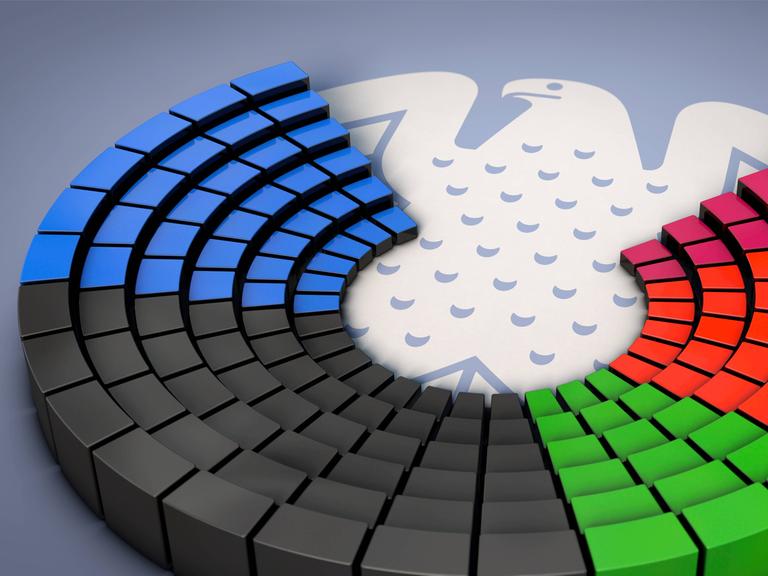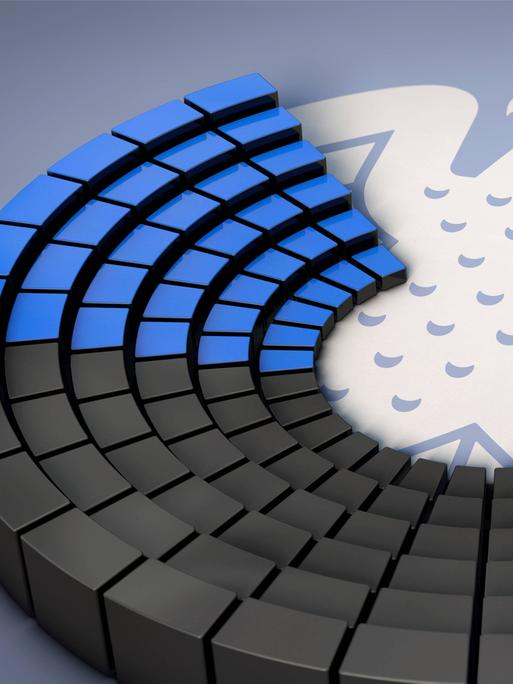Zwischen altbacken und bewahrend

Wie hat sich Konservatismus im Laufe der Zeit verändert? Bietet diese Geisteshaltung Vorteile in einer Welt im Umbruch? © Getty Images / CSA Images
Was heißt konservativ sein heute?

Die einen deuten das Wort negativ – als „altbacken“, andere sehen darin ein positives Bekenntnis zu Werten und zum Menschen. Was bedeutet es heute, konservativ zu sein? Jedenfalls ist es mehr, als nur das Bestehende zu bewahren.
Konservatismus – für viele mag das nach Blockade klingen, nach Rückwärtsgewandtheit und womöglich sogar nach rechter Ideologie. Aber kann „konservativ sein“ nicht auch Orientierung und Stabilität bedeuten, in einer Zeit rasanter Veränderungen?
Inhalt
„Konservativ“ heißt was genau?
Der Begriff „konservativ“ leitet sich vom lateinischen Wort für „konservieren“ (conservare) ab. Im wörtlichen Sinne kann man das Adjektiv zum Beispiel mit „am (Alt)Hergebrachten festhaltend“ erklären. Es wäre aber falsch, den politischen Konservatismus auf diese Eigenschaft zu beschränken. Laut dem Politiklexikon der Bundeszentrale für politische Bildung bilden Gesellschaften aus konservativer Sicht „ein organisches Ganzes“, das „durch Gewohnheiten und Gebräuche zusammengehalten wird.“ Weiter heißt es dort zum Konservatismus: „Fortschritt und Veränderung werden nicht grundsätzlich ausgeschlossen, bedürfen zunächst aber allgemeiner Zustimmung und Bewährung.“
Doch die eine allgemeingültige Definition von Konservatismus gibt es nicht, stattdessen viele unterschiedliche Interpretationen und Auslegungen.
Für Autor und Journalist Uli Hufen bedeutet „konservativ“ keinesfalls nur „bewahren“, sondern die bestehende Realität anzuerkennen – „und zwar als etwas, das geworden ist und das man nun aber nicht einfrieren will, weil es so schön ist, sondern sorgsam fortführen.“
Hufen: „Also, der Wandel ist ein Fakt. Es geht darum, ihn klug zu moderieren, auch mal zu verzögern.“
Ist der Konservatismus menschenfreundlich?
Der Leiter der Denkfabrik „Republik 21“, Andreas Rödder, bezeichnet sich selbst als einen Konservativen. Für den Geschichtsprofessor zeichnet sich der politische Konservatismus vor allem durch ein bestimmtes Menschenbild aus. „Und das geht vom fehlbaren Menschen aus. Und deswegen wendet es sich gegen Absolutheitsansprüche, (…) auch gegen Utopien.“
Im Konservatismus, sagt Rödder, gebe es eine bestimmte Haltung zum Wandel. „Der Konservatismus hat diese menschenfreundliche, zugewandte Seite und will die Dinge so verändern, so verbessern, dass die Menschen mitkommen und davon nicht überfordert werden.“
Die Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi sieht das teilweise anders. Denn eine menschenfreundliche Haltung kann die Autorin des Buchs „Verbinden statt spalten. Eine Antwort auf die Politik der Polarisierung“ zumindest im politischen Konservatismus nicht erkennen. Stattdessen aber ein stark ausgeprägtes Freund-Feind-Denken.
Sahebi: „Wenn man sich anschaut, wie der Bundestagswahlkampf geführt wurde von Friedrich Merz und Jens Spahn und Carsten Linnemann und diese konstante Abwertung von Menschen: Die Linken haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder: Menschen, die gendern, sind so und so. Das wäre ja nach Andreas Rödders Definition nicht konservativ, weil die Abwertung von Menschen sollte damit nicht einhergehen.“
Was unterscheidet "konservativ" von "rechts"?
Historiker Rödder warnt davor, die Begriffe „konservativ“, „rechts“ und „rechtsextrem“ leichtfertig gleichzusetzen. Aber wo genau verläuft die Grenze zwischen „konservativ“ und „rechts“?
Ganz pragmatisch unterteilt Rödder das politische Spektrum erst einmal in eine rechte und in eine linke Hälfte. Ihm zufolge teilt sich die rechte Hälfte wiederum in eine liberalkonservative rechte Mitte und in eine Rechte. Das konservative Spektrum sieht Rödder in der rechten Mitte beheimatet.
Die eigentliche Trennlinie verläuft in den Augen des Historikers aber eher zwischen zwei unterschiedlichen Menschen- und Gesellschaftsbildern: Während das konservativ-bürgerliche Denken auf dem menschlichen Individuum basiere, gehe die Rechte meist von einem (ethnischen) Kollektiv aus.
Darüber hinaus gibt es in der Frage „Konservativ oder rechts?“ noch eine weitere Unterscheidung, sagt Rödder: „Steht man zur liberalen Demokratie im Sinne von Mehrheitsprinzip, Minderheitenschutz, Rechtsstaatlichkeit, friedlichem Regierungswechsel und politischer Öffentlichkeit? Stehe ich also in diesem Sinne zur liberalen Demokratie oder neige ich autoritären Staatsformen zu?"
Politologin Gilda Sahebi unterscheidet hingegen zwischen „konservativ“ und „autoritär“. Ihr zufolge erkennen Konservative den Wert des Menschen generell an, Autoritäre jedoch nicht.
Sahebi: „Das Autoritäre hierarchisiert den Wert von Menschen. Das tut das demokratische Spektrum nicht und auch die meisten Menschen, ob sie konservativ wählen oder sozialdemokratisch wählen oder wie auch immer wählen, die werden den menschlichen Wert nicht hierarchisieren, wie das die Autoritären tun – nach Herkunft, nach sexueller Orientierung und allem Möglichen.“
Welche möglichen Chancen bietet der Konservatismus?
Liegt im Begriff „Konservatismus“ nicht auch eine Chance, den Dialog zu finden? Zum Beispiel zwischen linker und rechter Mitte, weil sich beide nicht an den politischen Rändern aufhalten?
Gilda Sahebi hat diese Erfahrung selbst schon gemacht. „Ich kenne schon seit Längerem zum Beispiel Abgeordnete aus der Union, mit denen ich sehr intensive, kontroverse Debatten geführt habe. Und ich fand diese Debatten immer super spannend“, sagt sie.
Andreas Rödder sieht in Zeiten der Polarisierung vor allem deshalb eine große Chance im Konservatismus, weil dieser die Menschen nicht umerziehen wolle, „sondern sie so nimmt, wie sie sind.“
Konservativ und Klimaschutz – ein Widerspruch?
Eine lebenswerte Umwelt zu erhalten, sprich zu konservieren, wird allgemein eher weniger als konservatives Anliegen wahrgenommen.
Dabei kamen die ersten Umweltschützer aus genau diesem gesellschaftspolitischen Spektrum. Als im 19. Jahrhundert die Industrialisierung mit all ihren Neuerungen das bisher gekannte Lebenstempo stark umkrempelte, formierte sich Widerstand vor allem auf Seiten der Konservativen. Natur- und Umweltschutz rückten ins Zentrum konservativer Ideologie, es gründeten sich Pfadfinder, Turn- und Wandervereine.
Dabei kamen die ersten Umweltschützer aus genau diesem gesellschaftspolitischen Spektrum. Als im 19. Jahrhundert die Industrialisierung mit all ihren Neuerungen das bisher gekannte Lebenstempo stark umkrempelte, formierte sich Widerstand vor allem auf Seiten der Konservativen. Natur- und Umweltschutz rückten ins Zentrum konservativer Ideologie, es gründeten sich Pfadfinder, Turn- und Wandervereine.
Auch heute noch müssen eine konservative Einstellung und Klimaschutz keinesfalls ein Widerspruch sein, sagt Sozialwissenschaftler Markus Kollberg:
„Wer zum Beispiel Besitzer einer Wärmepumpe ist, ist von Schwankungen am globalen Energiemarkt erheblich unabhängiger als jemand, der eine Gasheizung im Keller hat. So etwas bringt ökonomische Sicherheit und Sicherheit ist ein urkonservativer Wert. Aber was auffällt, ist, dass diese Komponente im öffentlichen Diskurs quasi keine Beachtung findet.“
jma