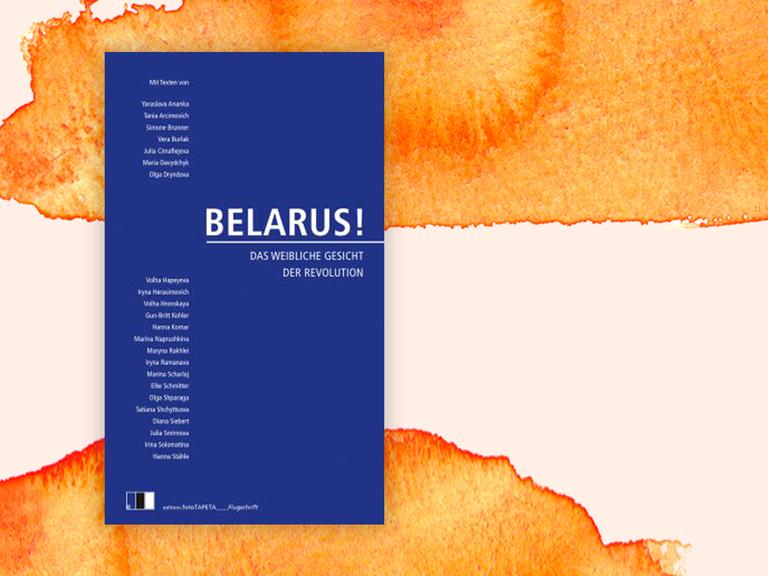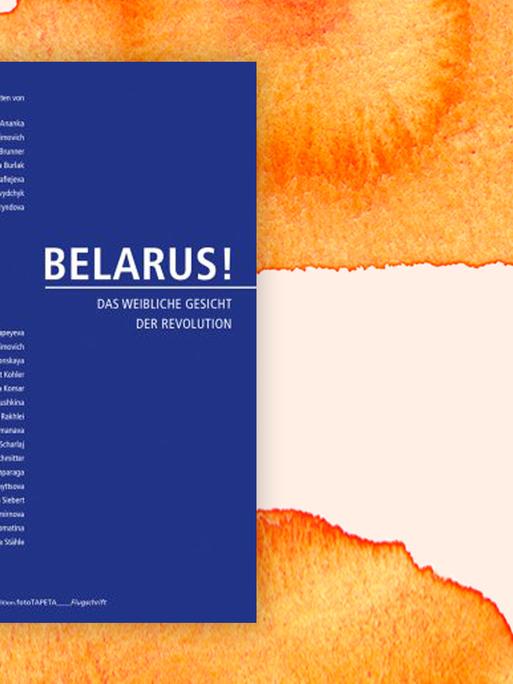Artur Klinaŭ: "Acht Tage Revolution"
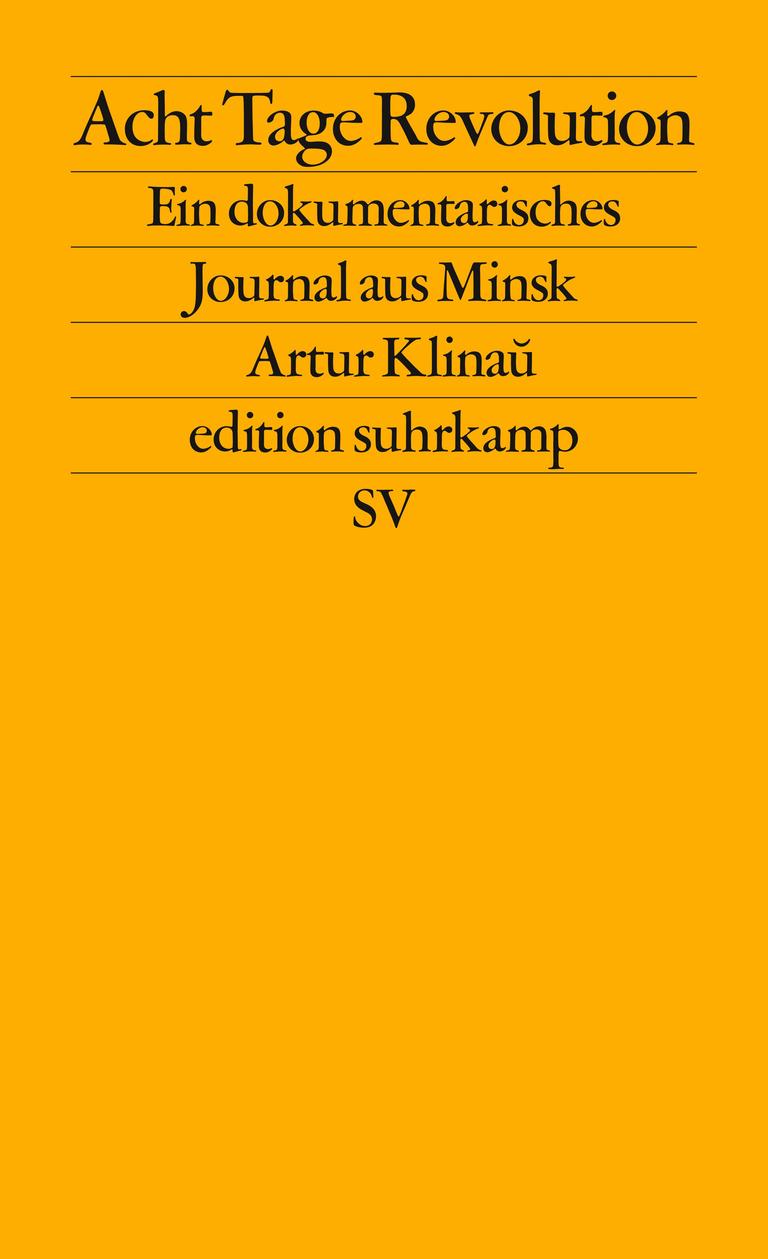
© Suhrkamp
Parallelwelt der Opposition in Belarus
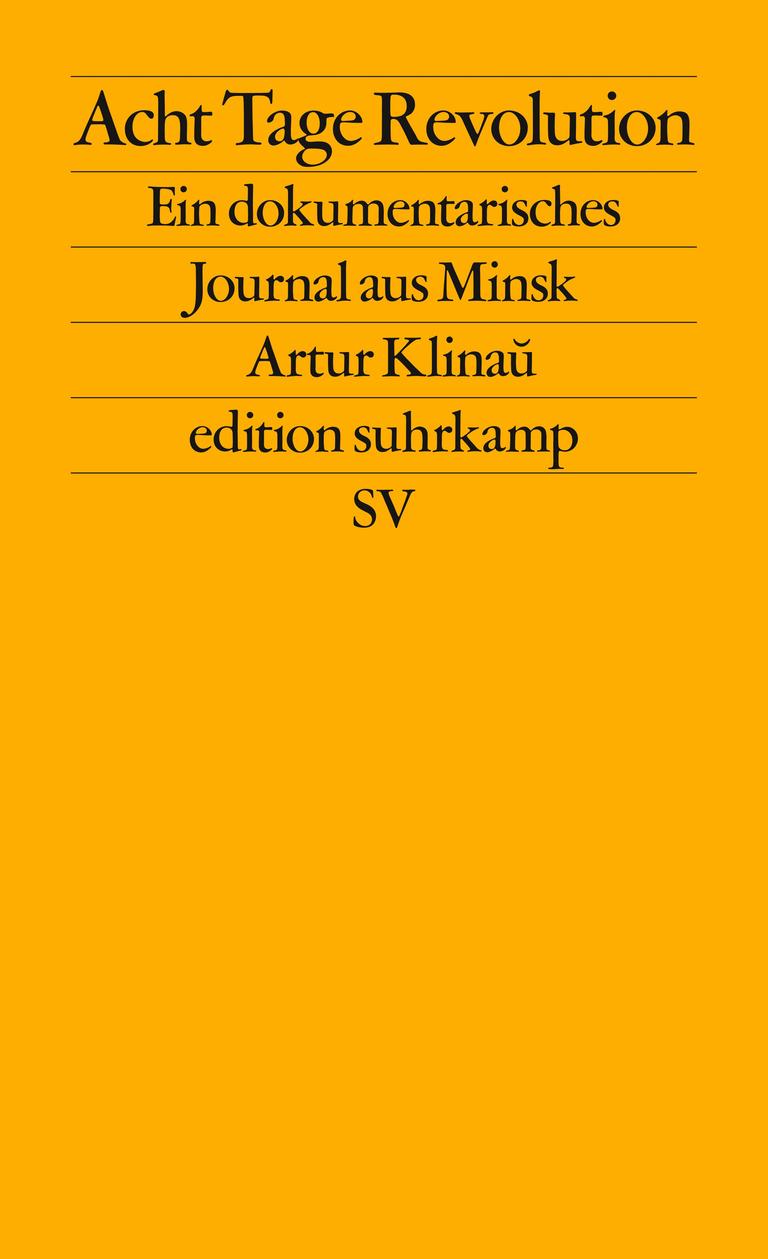
Artur Klinaŭ
„Acht Tage Revolution. Ein dokumentarisches Journal aus Minsk“Suhrkamp, Berlin 2021266 Seiten
18,00 Euro
Die Tochter des Schriftstellers Artur Klinaŭ wird kurz vor der Wahl in Belarus verhaftet und verschwindet. Der Vater macht sich inmitten der landesweiten Proteste gegen Lukaschenko auf die Suche und taucht in eine höchst kreative revolutionäre Parallelwelt ein.
Frauen stehen im Widerstand gegen Belarus‘ Diktator Lukaschenko an vorderster Front. Die 25-jährige Marta, Dokumentarfilmerin und unabhängige Wahlbeobachterin, wird unmittelbar vor der Wahl im August 2020 verhaftet. Ihr Vater, der Schriftsteller und Konzeptkünstler Artur Klinaŭ, hat sein Buch über die Suche nach der einige Tage spurlos Verschwundenen „Acht Tage Revolution“ genannt. Es ist aus dem Manuskript übersetzt worden, einen belarussischen Verlag gibt es nicht.
Dissident auf Lebenszeit
Der Vater bettet die Suche nach der Tochter ein in zwei Erzählstränge: Einer folgt den Protesten, von deren Kreativität und Mut sich Klinaŭ anstecken lässt, der andere geht zurück in die Vergangenheit. In ihm erläutert Klinaŭ seine Haltung zum Diktator und dessen Beziehungen zu Russlands Präsident Putin. Er ist „Dissident auf Lebenszeit“, seit er Lukaschenko in den 1990er-Jahren auf einem Gemälde porträtiert hat. Klinaŭ hat sich wie Teile seiner Generation in einer Parallelwelt eingerichtet, einer oppositionellen Nische mit einer eigenen Infrastruktur von Verlagen, Buchhandlungen, Kultureinrichtungen.
Diese Parallelwelt erinnert deutsche Leser an vergleichbare Arrangements in der DDR der 1980er-Jahre oder an die altbundesrepublikanische Subkultur. Sie sei noch nicht stark genug, um dem Diktator entgegenzutreten, meint Klinaŭ und verurteilt die Ungeduld seiner Tochter und ihrer Generation. Martas tagelanges Verschwinden, dann ihre Verurteilung und die tägliche brutale Repression, bei der die Polizei bewusst Tote in Kauf nimmt, bilden den Anlass einer politischen Lagebestimmung.
Der Diktator ein Künstler
So schockierend sich die Zeugenaussagen über den Polizeiterror lesen – am erstaunlichsten fällt Klinaŭs Darstellung von Lukaschenko aus. Er zeigt ihn als gealterten Politiker mit „fuchtigem Schnauz“, einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber den letzten Vertretern des Bürgertums, begrenzten geistigen wie rhetorischen Fähigkeiten und gravierendem Realitätsverlust. Der Diktator sei „ein Künstler“ mit einer Vorliebe für Braun: Belarus sei seine Schöpfung in 1001 Brauntönen, dieses „Gemälde“ gleiche einem braunen Ziegelstein. Kann sich der Konzeptkünstler Klinaŭ der Realität nur noch mit ästhetischen Kategorien nähern?
Der andere große „Künstler“ ist für ihn Putin. Der „Starze im Kreml“ male an einem schwarzen Quadrat, das er mit dem braunen belarussischen Gemälde und einem ukrainischen zu einem Triptychon erweitern wolle. Nur habe Lukaschenko bereits das Diptychon verweigert, die Union von Russland und Belarus, die Putin dank einer neuen Verfassung die ersehnte Amtsverlängerung beschert hätte.
Puppentheater und Verschwörungstheorie
Die Unionspläne verfolge der „Starze“ jedoch weiter: Die drei Oppositionskandidaten des Jahres 2020 seien Handlanger Russlands. Dass sie kurz vor der Wahl von drei Frauen abgelöst wurden und sich die Belarussen dann so sehr über Lukaschenkos Wahlbetrug und seine Leugnung der Coronapandemie empörten, sei allerdings im „Drehbuch des Kreml“ nicht vorgesehen gewesen.
All das wirkt wie eine Mischung aus Puppentheater und Verschwörungstheorie. Präzisere Informationen und kühlere Analysen über die Proteste in Belarus bietet Olga Shparaga in „Die Revolution hat ein weibliches Gesicht“. Aber als Einblick in typische belarussische Denkmuster, insbesondere zum Einfluss Russlands, ist das Buch interessant. Und als Aufkündigung einer friedlichen Koexistenz von Diktatur und Opposition.