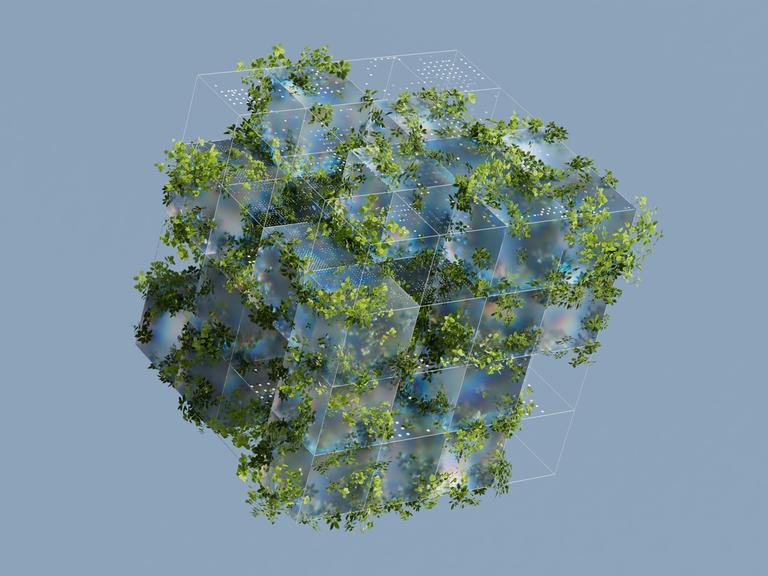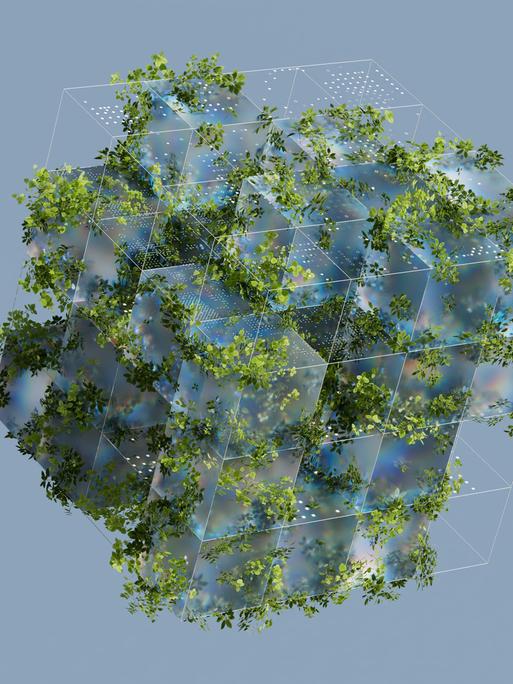Kommentar: Ernährung und Klima

So wie die meisten von uns sich heute ernähren, ruinieren wir die Umwelt als auch unsere Gesundheit, meint die Journalistin Annette Jensen. © picture alliance / dpa / Patrick Pleul
Warum die Grillparty hochpolitisch ist

Jeder soll essen, was er will, sagen die einen. Wenn wir uns weiterhin so ernähren wie jetzt, ruinieren wir Umwelt, Klima und unsere Gesundheit, sagen die anderen. Zu ihnen gehört die Autorin Annette Jensen, die für einen radikalen Wandel plädiert.
„Sage mir, wie Du heute isst und ich sage Dir, wie Du zu unserer Umwelt stehst!“ So wie die meisten von uns sich heute ernähren, ruinieren wir die Umwelt und damit auch die Zukunft der Menschheit. Zugleich ist unser Ernährungssystem extrem ungerecht für Menschen mit wenig Geld - und darüber hinaus auch noch sehr ungesund. Etwa ein Drittel der klimaschädlichen Gase ist auf unsere heutige Art der Lebensmittel-Produktion zurückzuführen.
Transport des Futters belastet das Klima
Viel zu viele Tiere fristen ihr trauriges Dasein in engen Ställen. Sie fressen Kraftfutter aus Soja, das auf riesigen Feldern in Brasilien und Argentinien wächst. Wälder und Savannen müssen weichen – und damit einmalige Lebensräume.
Der Transport des Futters belastet das Klima ebenfalls. Außerdem benötigt der Anbau große Mengen an Kunstdünger. Den herzustellen ist außerordentlich energieintensiv. Und natürlich sind da auch noch die nicht zu unterschätzenden Methanemissionen von Millionen furzender und rülpsender Kühe, die nicht mehr grasen dürfen.
In unseren Supermärkten gibt es alles – immer. Papayas, Mangos und Ananas kommen mit dem Flugzeug. Wo sie wachsen, bauten Menschen früher ihre eigene Nahrung an. Doch exportorientierte Unternehmen kaufen weltweit Ackerflächen auf. Fast jeder zehnte Mensch hungert. Ausgerechnet in ländlichen Regionen leben die meisten, die nicht genug zu essen haben.
Das muss nicht sein. Wissenschaftler haben ausgerechnet: Auch eine wachsende Menschheit ließe sich gut ernähren, ohne dass wir den Planeten weiter ruinieren. Das allerdings muss politisch gewollt sein.
Übergewicht und soziale Herkunft
Hinzu kommt: Auf unseren Tellern liegen immer mehr hochverarbeitete Lebensmittel. Konzerne wie Nestlé, Unilever und Coca-Cola beliefern Supermärkte weltweit. Müsliriegel, Tiefkühlpizza, Fertiggerichte, Chips, Ketchup und Energy-Drinks - all das lässt sich schnell zubereiten oder sofort konsumieren.
Die meisten Produkte enthalten viel Zucker – denn Zucker ist ein billiger Füllstoff. Dabei macht er süchtig und verursacht Übergewicht. In Deutschland sind davon etwa zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen betroffen. Besonders erschreckend ist die rasante Zunahme von Adipositas bei Kindern.
Aber wenn es ihnen doch schmeckt? Was sie in sich hineinschieben, sollen die Leute doch bitteschön selbst entscheiden, fordert die Lebensmittelindustrie.
Doch es geht nicht um freie Auswahl. Eindeutig ist der Zusammenhang von Übergewicht und sozialer Herkunft. Mädchen und Jungen aus benachteiligten Familien sind viel häufiger dick. Schließlich sind hochkalorige Lebensmittel billiger als frisches Obst und Gemüse.
Volkswirtschaftliche Kosten durch Adipositas
Die viel zu vielen Pfunde, die sich Kinder in jungen Jahren anfuttern, werden sie ihr Leben lang nicht wieder los. Das ist nicht nur für sie selbst eine schwere Last, sondern auch für die Krankenkassen. Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Gicht und Knieprobleme nehmen zu. Laut einer Studie der Uni Hamburg summieren sich die volkswirtschaftlichen Kosten durch Adipositas auf 63 Milliarden Euro im Jahr – Tendenz steigend.
Was auf die Teller kommt, ist keine Privatsache. Die Politik muss dafür sorgen, dass es einfach und für alle bezahlbar ist, sich gut zu ernähren. Trinkwasserbrunnen in Schulen und auf öffentlichen Plätzen wären ein Anfang. Der vom Bundestag eingesetzte BürgerInnenrat fordert hochwertiges, kostenfreies Mittagessen in allen Kitas und Schulkantinen.
Und das heiß begehrte Nackensteak? Das sollte künftig von Weidetieren stammen, die gut gelebt haben. Für 3,69 Euro ist es dann allerdings nicht zu haben.