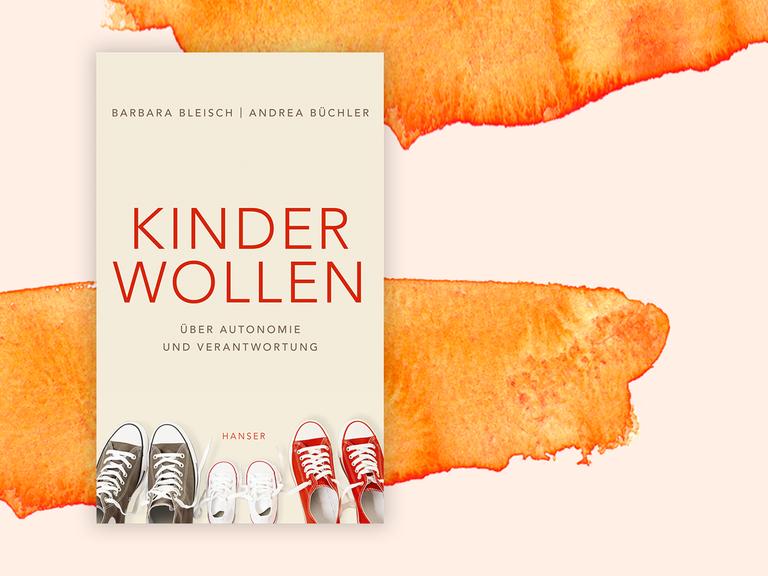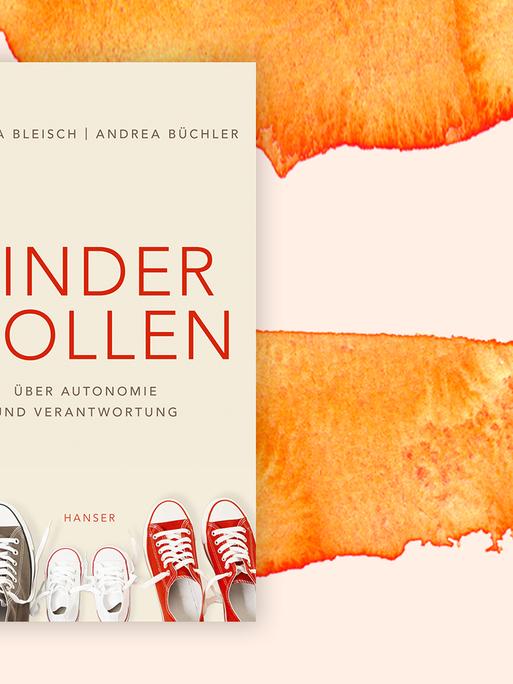Barbara Bleisch und Andrea Büchler: "Kinder wollen. Über Autonomie und Verantwortung"
Hanser Verlag, München 2020
304 Seiten, 22 Euro
Wie viel Machbarkeit ist wünschenswert?
42:20 Minuten

Früher schien das Kinderkriegen eine Sache des Schicksals. Heute stellen uns alternative Lebensformen und neue Technologien vor ungekannte Möglichkeiten: Vieles ist machbar – aber was ist auch wünschenswert?
Noch immer gilt manchen das Kinderkriegen als "natürlichste Sache der Welt". Wie falsch diese Einschätzung ist, verdeutlicht eine Zahl: Zwischen zwölf und 25 Milliarden US-Dollar werden jährlich für verschiedene Hilfeleistungen rund ums Kinderkriegen ausgegeben.
Mit dem Fortschritt des Machbaren stellt sich umso dringender die Frage nach dem Wünschbaren, also nach der Ethik des Kinderkriegens: Wer sollte, auf welche Weise, welche Kinder bekommen können? Wie brisant diese Fragen sind, zeigt sich zum Beispiel in den jüngsten Debatten um Eizellenspenden, Leihmutterschaft oder Pränataldiagnostik.
Wer soll Kinder kriegen dürfen?
Gleichzeitig betreffen diese Auseinandersetzungen sehr persönliche und intime Fragen. Die Entscheidung darüber, ob, wann und mit wem man Kinder bekommt, ist "ein wesentlicher Aspekt der menschlichen Freiheit" und deshalb auch menschenrechtlich geschützt, erklärt Andrea Büchler: "Reproduktive Autonomie meint allgemein, dass es Personen vorbehalten sein soll, selbstbestimmt über die Verwirklichung ihrer Kinderwünsche zu entscheiden."
Negativ verstanden garantiert uns dieses Recht die Freiheit von staatlicher Bevormundung – etwa durch Vorenthaltung von Verhütungsmitteln oder die Verweigerung von Schwangerschaftsabbrüchen, aber auch durch eine verordnete Ein-Kind-Politik, wie sie lange Zeit in China durchgesetzt wurde.

Die Schweizer Rechtswissenschaftlerin Andrea Büchler.© Dominique Schütz
Neu und nach wie vor umstritten sei hingegen das Prinzip einer positiven Autonomie der Fortpflanzung, also die Frage, ob auch jeder Mensch einen Anspruch auf ärztliche Behandlungen hat, um einen Kinderwunsch zu erfüllen, führt Blücher aus: "Hat man Zugang zur Reproduktionsmedizin, wem soll diese zur Verfügung stehen – zum Beispiel die Eizellenspende oder die Präimplantationsdiagnostik?" Klar sei lediglich, "dass der Staat uns nicht daran hindern sollte, Maßnahmen zu ergreifen, um den Kinderwunsch zu verwirklichen".
Natürlichkeit ist ein schlechtes Argument
Umstritten bleibt die Reproduktionsmedizin auch deshalb, weil ihre Möglichkeiten zunehmend kulturelle Muster herausfordern. Während etwa die Samenspende längst akzeptiert ist, ist die Spende von Eizellen in Deutschland und der Schweiz immer noch verboten. Das liege auch an unterschiedlichen Vorstellungen von Mutterschaft und Vaterschaft. Denn: "Dass der genetische Vater rechtlich nicht die Verantwortung für sein Kind übernimmt", das akzeptiere etwa das schweizerische Recht als "Erfahrungstatsache" und rücke die Samenspende damit in die Nähe des Natürlichen und Legitimen, erklärt Blücher. Die Eizellenspende werde hingegen als unnatürlich wahrgenommen, weil sie mit der menschheitsgeschichtlich neuen "Spaltung in eine genetische und eine austragende Mutterschaft" einhergehe.
Warum der Verweis auf eine vermeintliche Natürlichkeit als Argument aber nicht tauge, erläutert Barbara Bleisch: "Selbst, wenn etwas nicht naturgemäß wäre: Was sollte daraus folgen? Denn tatsächlich ist die Geschichte der Menschheit immer auch eine Geschichte gewesen, in der wir versucht haben, die Grenzen der Natur zu dehnen oder zu sprengen."
Wie dürfen wir Kinder kriegen?
Besonders umstritten – und in Deutschland ebenfalls verboten – ist die Leihmutterschaft, die etwa unfruchtbaren oder homosexuellen Paaren die Möglichkeit gebe, ihr Kind von einer anderen Frau austragen zu lassen. Dagegen werde oft die Befürchtung geäußert, dass es dem Kind schaden könne, wenn die biologische und die soziale Mutter nicht dieselb Person seien.
Dahinter stehe die Annahme, dass die Schwangerschaft eine besonders enge Beziehung zwischen Mutter und Kind stifte, die durch die Leihmutterschaft in Mitleidenschaft gezogen würde: Weil die Leihmutter das Kind nach Geburt abgeben muss oder weil sie sich im Wissen darum nicht auf eine emotionale Beziehung zum Ungeborenen einließe.
Dem hält Bleisch entgegen: "Da können wir einfach auf empirische Studien verweisen, die belegen, dass es Kindern in den ersten Lebensjahren nicht schlechter geht, die aus solchen Verhältnissen entstammen."

Die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch.© Mirjam Kluka
Ernstzunehmender sei die Sorge um eine mögliche Instrumentalisierung der Leihmutter. Aber auch die sei nicht zwangsläufig gegeben, betont Bleisch und verweist auf Immanuel Kants Selbstzweckformel, "die besagt, dass man andere und sich selbst nie bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck behandeln soll".
Diese Möglichkeit bestehe auch bei der Leihmutterschaft, selbst wenn die Leihmutter ihre Dienste gegen Geld anbiete: "Dieses gegenseitige Benutzen hat nichts moralisch Anstößiges, solange sich beide immer auch als Zwecke betrachten."
Entscheidend sei der Kontext – etwa, dass die Leihmutter nicht von den Wunscheltern oder einer Klinik abhängig sei, und die Frage, "ob die Leihmutter für die Wunscheltern austauschbar ist oder sie wirklich auch als Person wertgeschätzt wird". Wenn dies der Fall ist, sei Leihmutterschaft durchaus "moralisch legitim".
Letztlich könne man das aber nur von Fall zu Fall beurteilen, geben Bleisch und Büchler zu bedenken. Ihr vorsichtiges Plädoyer: Leihmutterschaft erlauben, aber in Verbindung mit umsichtigen gesetzlichen Regularien, die die Würde der Leihmutter schützen.
Welche Kinder sollen wir kriegen?
Unter dem Eindruck technologischer Neuerungen verändert sich nicht nur die Art und Weise, wie wir Kinder bekommen, sondern auch welche Kinder wir bekommen. Durch die Pränataldiagnostik lassen sich vorgeburtlich immer mehr genetische Abweichungen feststellen, die auf mögliche Erkrankungen hindeuten. Laut einer Studie des Deutschen Bundestages entscheiden sich im Schnitt 92 Prozent der Eltern gegen einen Embryo, bei dem Trisomie 21 diagnostiziert wurde.
Steht das nicht im Widerspruch zum Ideal gesellschaftlicher Vielfalt und Inklusion? Bleisch sieht hier nicht unbedingt einen Konflikt, weil es sich um zwei verschiedene Ebenen handele: Die Entscheidung, eine Schwangerschaft abzubrechen, sei eine sehr persönliche, bei der es legitim sein sollte, auch Fragen der individuellen Lebensführung miteinzubeziehen. Angehende Eltern müssten für sich beantworten, ob sie sich das Aufziehen eines Kindes mit schwerer Beeinträchtigung zutrauen und ob sie sich dieser Verantwortung gewachsen sehen. "Dann können wir nicht kommen und sagen: Naja, aber die Gesellschaft ist daran interessiert, dass es möglichst viel Inklusion gibt."
Grenzen der Optimierbarkeit
Vielmehr sei es Aufgabe der Gesellschaft, "die Rahmenbedingungen so zu stecken, dass kein Paar einen solchen Entscheid fällen muss, weil es befürchtet nicht unterstützt zu werden". Hier sei schon viel erreicht, findet Bleisch. Trotzdem sollten wir uns noch stärker um eine inklusive Gesellschaft bemühen, auch um unserer selbst willen:
"Weil sie uns vielleicht ein bisschen erlöst von unserer Leistungsfixierung und unserem Optimierungswahn. Und uns zeigt: Wir sind alle auch verletzliche Wesen, letztendlich auch alle voneinander abhängig. Das Zarte, das Zerbrechliche, auch das Kranke ist Teil der Menschheit."
In diesem Sinne gibt Blücher werdenden Eltern den Rat, "nicht zu vergessen, dass es, trotz aller Planbarkeit, einiges gibt, was sich nicht bedenken lässt und was schlicht unverfügbar ist". Und das sei auch gut so.
Außerdem in dieser Ausgabe von Sein und Streit:
Bibliotheken und Büchereien während Corona: Bedrohte Biotope sozialer Vielfalt
Was geht wieder, was noch nicht? In der Diskussion um die Coronamaßnahmen vergessen wir die öffentlichen Lesesäle. Dabei sind sie besonders schützenswerte Räume, findet die Philosophin Andrea Roedig.