Kevin Kuhn: Liv
Berlin Verlag, Berlin 2017
492 Seiten, 22,00 Euro
Zwischen Aufbruch und Endzeitgefühl
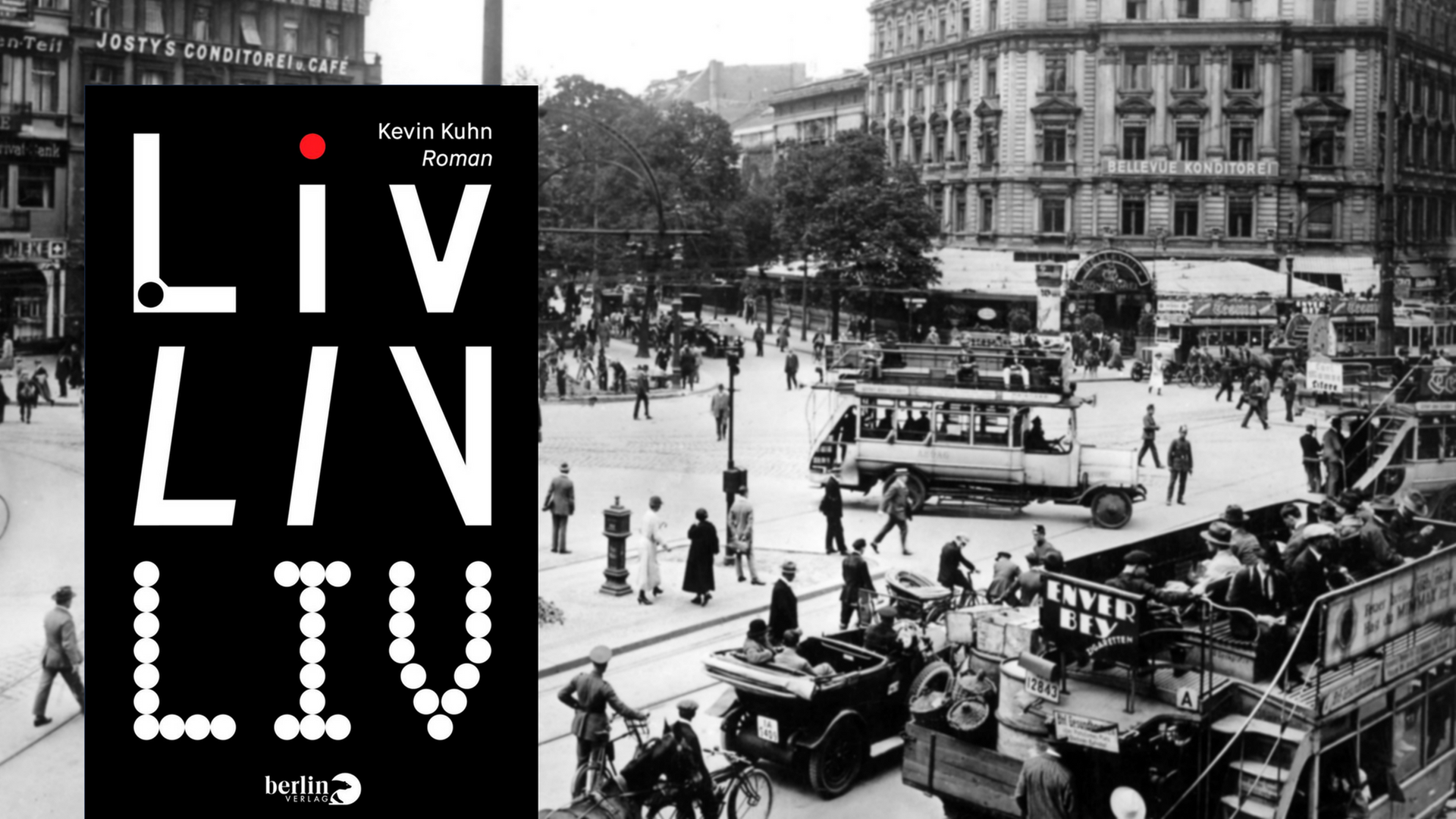
Innovation, Kreativität und Laster - Kevin Kuhns neuer Roman "Liv" spielt im Berlin der späten 1920er-Jahre und in der Gegenwart. Er greift ein Zeitgefühl auf, das beide Epochen verbindet. Doch Kuhns Brückenschlag misslingt.
Der 1981 geborene Autor und wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Hildesheim wurde 2012, nach Veröffentlichung seines Debütromans, zu den 20 besten deutschsprachigen Autoren unter 40 gezählt. Darin ging es um den gesellschaftlichen Rückzug eines jungen Mannes, der immer stärker in virtuelle Welten abdriftet.
In "Liv" präsentiert Kevin Kuhn nun erneut zwei Protagonisten, die aussteigen, bevor sie richtig eingestiegen sind. Der eine, Franz, stromert durch das legendäre Berlin des Jahres 1928: Flappergirls, Bubikopf, Pumphosen, Automatenbüffett, Lunapark und Protos-Staubsauger, Hotel Eden und Tempelhofer Flugfeld. Alles, was auf Fotos dieser Zeit zu sehen ist, bekommt auch er vor die Linse. Mit seiner Leica Kamera dokumentiert Franz das Nachtleben, die Landung des Zeppelins und wird aufgrund eines Fotos selbst prominent. Er raucht, trinkt und diskutiert mit Freunden über Zeitgeist und neue Lebensformen. Irgendwann dann die Erkenntnis: "Obwohl alles in Bewegung ist, herrscht eine beängstigende Stille."
Die zweite Hauptfigur ist die junge Israeli Liv. Sie reist, weil sie dem Wehrdienst in ihrer Heimat entgehen will, durch die Welt von heute. Zuerst nach Mexiko, wo sie als Bagpackerin touristische Highlights abklappert: die Strände, Märkte und Bars von Yucatán sowie Pyramiden und Ruinenstädte im Dschungel. Liv setzt ihre Tour in den USA fort und schließt sich dort einem Luxusaussteigerpaar an, das mit seiner Superjacht durch den Pazifik bis Neuseeland segeln will: "Irgendetwas wartete da draußen auf sie."
In "Liv" präsentiert Kevin Kuhn nun erneut zwei Protagonisten, die aussteigen, bevor sie richtig eingestiegen sind. Der eine, Franz, stromert durch das legendäre Berlin des Jahres 1928: Flappergirls, Bubikopf, Pumphosen, Automatenbüffett, Lunapark und Protos-Staubsauger, Hotel Eden und Tempelhofer Flugfeld. Alles, was auf Fotos dieser Zeit zu sehen ist, bekommt auch er vor die Linse. Mit seiner Leica Kamera dokumentiert Franz das Nachtleben, die Landung des Zeppelins und wird aufgrund eines Fotos selbst prominent. Er raucht, trinkt und diskutiert mit Freunden über Zeitgeist und neue Lebensformen. Irgendwann dann die Erkenntnis: "Obwohl alles in Bewegung ist, herrscht eine beängstigende Stille."
Die zweite Hauptfigur ist die junge Israeli Liv. Sie reist, weil sie dem Wehrdienst in ihrer Heimat entgehen will, durch die Welt von heute. Zuerst nach Mexiko, wo sie als Bagpackerin touristische Highlights abklappert: die Strände, Märkte und Bars von Yucatán sowie Pyramiden und Ruinenstädte im Dschungel. Liv setzt ihre Tour in den USA fort und schließt sich dort einem Luxusaussteigerpaar an, das mit seiner Superjacht durch den Pazifik bis Neuseeland segeln will: "Irgendetwas wartete da draußen auf sie."
Der Eindruck permanenter Gegenwart
Kuhn vertauscht die naheliegenden Erzählperspektiven. Franz (aus dem 20. Jahrhundert) berichtet live, er zoomt von einem Eindruck zum nächsten, ist ein rasender Ich-Erzähler im Stil der Neuen Sachlichkeit, realistisch und dabei distanziert. Livs Erlebnisse (im 21. Jahrhundert) werden von einem allwissenden Erzähler in der Vergangenheit widergegeben. Dennoch entsteht der Eindruck permanenter Gegenwart. Sie ist auf ihrer Reise ständig online, postet und chattet, ununterbrochen "pingt" ihr Smartphone, Tausende Follower sind jederzeit darüber im Bilde, was sie denkt, fühlt, sieht und – erlebt?
Das ist alles ambitioniert konstruiert, warnt vor Social Media Allmacht und Persönlichkeitsverlust, zeigt das zweifelhafte Bemühen um Individualität, will existentiell sein und am Ende auch noch überraschen. Doch die Geschichte sackt unter der forcierten Erzählform weg, die Figuren bleiben Behauptungen. Es gelingt dem Autor nicht, die Neugier des Lesers so zu stimulieren, dass er die knapp 500 Seiten des Romans bewältigen möchte. Die Dominanz der "Messages", pausenlose Bildbeschreibungen und banale Sentenzen ermüden.
Das ist alles ambitioniert konstruiert, warnt vor Social Media Allmacht und Persönlichkeitsverlust, zeigt das zweifelhafte Bemühen um Individualität, will existentiell sein und am Ende auch noch überraschen. Doch die Geschichte sackt unter der forcierten Erzählform weg, die Figuren bleiben Behauptungen. Es gelingt dem Autor nicht, die Neugier des Lesers so zu stimulieren, dass er die knapp 500 Seiten des Romans bewältigen möchte. Die Dominanz der "Messages", pausenlose Bildbeschreibungen und banale Sentenzen ermüden.






