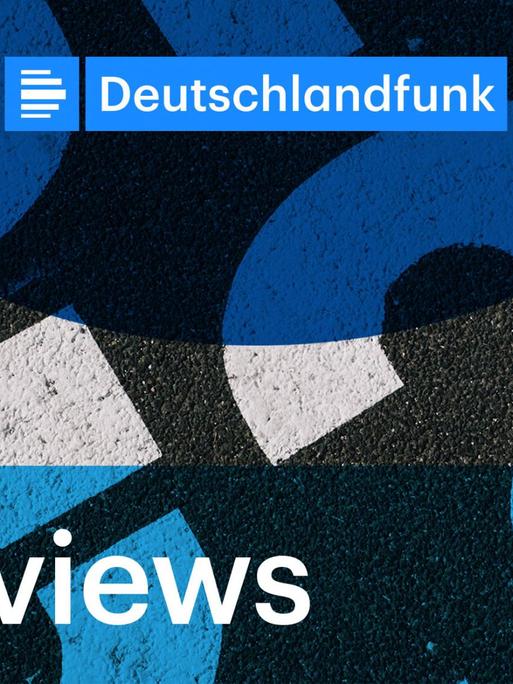"Keine überstürzten Schritte"
Taugt Deutschland als Vorbild für eine Wiedervereinigung Koreas? Kein Land in der Region ist wirklich an einem wiedervereinigten Korea interessiert, sagt Markus Tidten von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Ulrike Timm: Trotz aller Spannungen wollen Nord- und Südkorea Ende des Monats wieder Familienbegegnungen zulassen. Irgendwo an der nordkoreanischen Ostküste sollen sich Menschen aus dem geteilten Land dann still und heimlich sehen dürfen, genau datiert zwischen dem 30. Oktober und dem 5. November. Wir erinnern uns: Mit solch klitzekleinen Schritten, auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, suchten Bundesrepublik und DDR in den 1970ern Kontakt zueinander. Vor 20 Jahren dann kam es zur Wiedervereinigung. Wäre solch eine Entwicklung auch für Nord- und Südkorea denkbar? Markus Tidten ist als Experte für Nordostasien bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin Fachmann für solch spannende Fragen. Schönen guten Tag!
Markus Tidten: Guten Tag, Frau Timm!
Timm: Herr Tidten, wie haben denn die Koreaner vor 20 Jahren auf die deutsche Wiedervereinigung reagiert? Gab es da Stimmen à la das kriegen wir doch auch hin?
Tidten: Zunächst einmal mit sehr großer Begeisterung, und wir erinnern uns auch in unserem Institut noch an die Zeit, wo sich besonders aus Südkorea die Herrschaften die Klinke in die Hand gaben, weil man da ein Modell sah, von dem man zunächst einmal glaubte, das wäre doch eine Möglichkeit. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass die Unvergleichlichkeit beider Situationen doch sehr viel größer ist, als man vorher angenommen hatte.
Timm: Wie würde man sich – bleiben wir bei dem Gedankenspiel – denn diese Wiedervereinigung denken, zum einen in nord-, und zum anderen in südkoreanischer Lesart?
Tidten: Die einfachste Denkweise ist glaube ich die des Nordens, denn das heißt einfach, Wiedervereinigung nach nordkoreanischen Vorstellungen. Und das bedeutet: ein stalinistisches System mit einer straffen Führung, einem starken Militär, einer atomaren Bewaffnung und einem Volk, das das Wort Demokratie noch nicht einmal kennt.
Timm: Und Südkorea tritt dann bei?
Tidten: Und Südkorea tritt dann sozusagen dem Geltungsbereich dieses Systems bei. Das ist natürlich unrealistisch. Die südkoreanische Vorstellung war, wenn wir auf den Zeitraum von vor 20 Jahren zurückkommen, natürlich ähnlich wie die auch damals in der Bundesrepublik: Man hoffte, zunächst über den Übergang über zwei Systeme allmählich in eine Angleichung beider Systeme zu kommen und im Prinzip an der Demokratie, an der sozialen Marktwirtschaft und an den Bündnissen, die ja Südkorea eingegangen ist, festhalten zu können. Das alles hat sich aber mittlerweile als illusorisch herausgestellt.
Timm: Die politische Einheit, die haben die Deutschen ja auch der weltpolitischen Lage zu verdanken, auch der Großzügigkeit der Großmächte USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich, dass eben in der Nachbarschaft der anderen Mächte diese deutsche Wiedervereinigung zugelassen wurde. Und nun spielt ja auch bei Nord- und Südkorea die weltpolitische Lage eine große Rolle, ist da aber anders geartet. Was würden denn die Nachbarn, die Großmächte zu solch einer Vereinigung sagen?
Tidten: Exakt. Hier haben Sie genau den wichtigsten wohl die beiden Länder unterscheidenden Punkt getroffen. Wenn wir uns erinnern: Die Wiedervereinigung unseres Landes geschah vor dem Hintergrund, dass sozusagen der Druck auf die Erhaltung der Systeme sowohl im Westen als auch im Osten zunächst von den sogenannten Schutzfunktionen der jeweiligen Schutzmächte kamen, das heißt, es war während des Kalten Krieges das Interesse der Sowjetunion, das System DDR zu halten, und es war Interesse des westlichen Bündnisses, das System Bundesrepublik zu erhalten. Diese Konstellation haben Sie auf der koreanischen Halbinsel nicht. Der Druck auf das System in Nordkorea kommt mittlerweile ausschließlich aus dem Land selber, das heißt, die äußeren Faktoren – also die Beziehung zu China, die Beziehung zu Russland, die Beziehung zu den Vereinigten Staaten – sind eigentlich nur Mittel zum Zweck des Regimes, des Regimeerhaltes in Nordkorea. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Timm: Also so abgeschottet wie Nordkorea heute ist, war die DDR zu keinem Zeitpunkt.
Tidten: Nein, nein. Nordkorea ist heute mit eingeschweißten Radiosendern, mit Staatsfernsehen, mit einer kontrollierten Presse, mit der Unmöglichkeit, überhaupt Informationen von außen zu bekommen, dermaßen abgeschottet, wie wir es noch in keinem anderen Land auf diesem Globus gefunden haben.
Timm: Die Ostdeutschen waren ja über Westdeutschland viel besser informiert als umgekehrt. Gibt es denn eigentlich so, ja, Piratensender, wie es für Ostdeutschland eine Zeitlang der Deutschlandfunk der RIAS waren, die den anderen Teil des Landes, ja, auf dem Laufenden gehalten haben?
Tidten: Es gab vergleichbare Versuche sozusagen, am 38. Breitengrad den Norden zu beschallen mit entsprechenden Sendungen aus Südkorea. Es gab Versuche, über Ballons Flugblätter in den Norden zu bringen und abwerfen zu lassen. All das wurde aber sofort als massive Provokation seitens des Nordens betrachtet und entsprechend beantwortet – mit Raketentests, mit geheimen Versuchen, die Urananreicherung weiterzuführen, mit der Drohung, die Provokationen des Südens zu beantworten in militärischen Schlägen, sodass diese zaghaften Versuche sehr schnell wieder eingestellt wurden, um eigentlich die Situation auf der koreanischen Halbinsel nicht noch weiter zu verschärfen.
Timm: Das klingt, als wäre dieser Traum, der möglicherweise vor 20 Jahren auch in Korea sich entzündet hat, noch sehr weit entfernt.
Tidten: So würde ich das sehen. Wir haben heute eine Situation, dass eigentlich alle, die jetzt sozusagen involviert sind in diesen Prozess der Lösung der Probleme der koreanischen Frage – ich spreche von den Sechs-Länder-Gesprächen –, das sind fast alles Status-quo-Mächte. Es gibt kaum ein Land, selbst Südkorea kann man nicht mehr ernsthaft zu den Ländern zählen, die ein vitales Interesse daran haben, jetzt die Wiedervereinigung zu machen. Für China wäre es ein Desaster, es wäre ein Pufferstaat weg, es stünden 30.000 amerikanische Soldaten an der chinesischen Grenze, für Südkorea wäre es eine wirtschaftliche Überforderung, für Nordkorea wäre es das Ende des Regimes, für Japan bedeutete es einen immensen Zufluss von Flüchtlingen. Kein Land ist wirklich interessiert. Und ich glaube, wir müssen noch einige Jahre mit dieser Situation leben.
Timm: Das sind jetzt so viele Aspekte, die Sie uns aufgezählt haben, lassen Sie uns das mal ein bisschen auseinanderpuzzeln, Herr Tidten. Südkorea hat ja die Unterstützung der Amerikaner. Das kann den Chinesen dann nicht so wirklich recht sein, wenn diese Vereinigung ... Dann wären ja die Amerikaner im Land, oder wie würden da dann die Weltmächte reagieren in diesem Mosaikspiel, dass es einfach politisch gibt?
Tidten: Bedingt sind die Chinesen betroffen von der amerikanischen Präsenz. Es gibt in dieser Region in Nordostasien zwei sehr wichtige sicherheitspolitische Elemente, Strukturelemente, das sind Allianzverträge, die die Amerikaner haben. Der eine ist mit Südkorea, der berechtigt die Vereinigten Staaten seit Ende des Koreakrieges 1953 zur Stationierung von ungefähr 30.000 amerikanischen Militär, was nach wie vor dort stationiert ist. Der zweite Sicherheitsvertrag ist mit den Japanern, die auch amerikanische Truppen im Land haben und die ebenfalls eine sehr wichtige Allianz bilden. Für China selbst bedeutet die Präsenz der Amerikaner zumindest die Garantie, dass auch Südkorea nicht ohne völlige Kontrolle der Amerikaner sich bewegen wird, denn mittlerweile wissen wir, dass die Interessen der USA und Chinas in dieser Region ausgeglichen werden müssen, und beide Länder wollen das natürlich. Zudem ist China nicht daran interessiert, dass Nordkorea wegfällt als Regime, weil wir dann eine Vereinigung haben, und dann hätten wir ein Ergebnis, was beide, sowohl China als auch die USA, nicht haben wollten, nämlich, im wiedervereinigten Erbe der Koreaner eine atomare Bewaffnung zu haben. Das will keiner.
Timm: Deutschlandradio Kultur, das "Radiofeuilleton", mit einem Gedankenspiel: Was wäre, wenn der eiserne Vorhang zwischen Nord- und Südkorea fiele? Darüber sprechen wir mit Markus Tidten von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Tidten, Sie haben uns eben ein bisschen die weltpolitische Lage drum rum erklärt, Sie haben aber davor gesagt, Südkorea hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch kein Interesse dran, sich mit Nordkorea wiederzuvereinigen. Warum? Man sollte doch meinen, das sind doch ihre Leute?
Tidten: Das ist richtig. Es ist auch ähnlich wie bei uns im Grundgesetz seinerzeit Staatsziel Südkoreas, die Wiedervereinigung. Man braucht also beispielsweise keine Volksabstimmung, ob man denn wiedervereinigen will oder nicht, es ist erklärtes Staatsziel. Aber die Beispiele, die Südkorea erkannt hat hier in Europa mit der Wiedervereinigung Deutschlands und der DDR, der Bundesrepublik und der DDR – die enormen finanziellen Belastungen, die Schwierigkeiten in dem Zusammenführen von zwei völlig unterschiedlichen Systemen – schrecken vor allen Dingen die Wirtschaft in Südkorea ab. Und ich glaube, dass zwar die Begeisterung in der Bevölkerung noch eine gewisse Weile anhält, was die Wiedervereinigung angeht, dass aber die entscheidenden Figuren, also die Politik, die Regierung, zumal wir jetzt eine sehr konservative Regierung in Seoul haben, eher sozusagen auf Zeit spielt und man es nicht überstürzen möchte. Und eine Begeisterung ist bestenfalls noch in Randbereichen von wirtschaftlich weniger wichtigen Bevölkerungskreisen zu entdecken, aber die große Linie ist, wenn ich die Situation in Südkorea richtig beurteile, eher abwarten, keine überstürzten Schritte.
Timm: Nun ist Nordkorea nach allem, was wir wissen, wir wissen wenig genug, aber nach allem, was wir wissen, ist Nordkorea viel ärmer als die DDR jemals war. Das war eine funktionierende, mehr schlecht als recht, aber eine funktionierende Volkswirtschaft, und von Nordkorea hört man ja Geschichten, dass Menschen sogar hungern. Insofern ist das einleuchtend, wenn Sie beschreiben, Südkorea wäre wirtschaftlich überfordert. Aber das wäre ja viel zu schwierig, das werden wir nicht mehr erleben, das wird uns wirtschaftlich überfordern – das hätte man in Deutschland, jede Wette, 1988 auch noch gesagt. Und dann ging es plötzlich ganz schnell. Überwiegt das Rationale, was Sie eben geschildert haben, dann wirklich den großen Traum von Menschen?
Tidten: Ich glaube, kurzfristig muss man das leider so sehen. Nicht nur ist Nordkorea sehr viel ärmer als die DDR damals, auch Südkorea ist sehr viel ärmer als die Bundesrepublik vor 20 Jahren. Also die wirtschaftliche Potenz Südkoreas ist auch nicht vergleichbar mit der, die wir hatten vor 20 Jahren in der Bundesrepublik. Dazu kommt natürlich die Überlegung, dass mit einer Wiedervereinigung beider Staaten dann das eintritt, was bisher ja nicht stattfindet, nämlich der Druck auf die Systeme. Der Druck auf die Systeme ist bisher nicht gegeben. Das Land Nordkorea erzeugt selbst den eigenen Druck gegenüber der Bevölkerung. Wenn es zu den Fragen der Wiedervereinigung kommt, dann spielen die großen Akteure eine sehr viel entscheidendere Rolle, dann kommen die Amerikaner ins Spiel, dann kommt China ins Spiel, dann kommen alle Mitglieder der Sechs-Länder-Gespräche ins Spiel, und dann stellt sich heraus, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit Südkoreas trotz der fehlenden Bündnisse – verglichen mit der Bundesrepublik damals – noch sehr viel größer ist von der Welt, als sie war für uns damals im sicheren Europa.
Timm: Und wenn man die deutsche Wiedervereinigung im sicheren Europa auch 20 Jahre später noch als politisches Geschenk nimmt, dann wird nach Ihren Ausführungen deutlich: Solche Geschenke sind äußerst, äußerst knapp auf der Welt.
Tidten: Das würde ich genau so sehen, ja.
Timm: Markus Tidten von der Stiftung Wissenschaft und Politik, wir sprachen über ein Gedankenspiel: Könnte die deutsche Wiedervereinigung zum Vorbild für Korea taugen? Und zum Weiterlesen empfehlen wir Ihnen ein Buch, das sich als Expedition in geteilte Welten versteht, und in dem Künstler – darunter auch koreanische und deutsche – solche geteilten Welten beschreiben, nämlich "Die Mauerreise", so heißt es, herausgegeben von Michael Jeismann und Hans-Georg Knopp und erschienen im Steidl Verlag.
Markus Tidten: Guten Tag, Frau Timm!
Timm: Herr Tidten, wie haben denn die Koreaner vor 20 Jahren auf die deutsche Wiedervereinigung reagiert? Gab es da Stimmen à la das kriegen wir doch auch hin?
Tidten: Zunächst einmal mit sehr großer Begeisterung, und wir erinnern uns auch in unserem Institut noch an die Zeit, wo sich besonders aus Südkorea die Herrschaften die Klinke in die Hand gaben, weil man da ein Modell sah, von dem man zunächst einmal glaubte, das wäre doch eine Möglichkeit. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass die Unvergleichlichkeit beider Situationen doch sehr viel größer ist, als man vorher angenommen hatte.
Timm: Wie würde man sich – bleiben wir bei dem Gedankenspiel – denn diese Wiedervereinigung denken, zum einen in nord-, und zum anderen in südkoreanischer Lesart?
Tidten: Die einfachste Denkweise ist glaube ich die des Nordens, denn das heißt einfach, Wiedervereinigung nach nordkoreanischen Vorstellungen. Und das bedeutet: ein stalinistisches System mit einer straffen Führung, einem starken Militär, einer atomaren Bewaffnung und einem Volk, das das Wort Demokratie noch nicht einmal kennt.
Timm: Und Südkorea tritt dann bei?
Tidten: Und Südkorea tritt dann sozusagen dem Geltungsbereich dieses Systems bei. Das ist natürlich unrealistisch. Die südkoreanische Vorstellung war, wenn wir auf den Zeitraum von vor 20 Jahren zurückkommen, natürlich ähnlich wie die auch damals in der Bundesrepublik: Man hoffte, zunächst über den Übergang über zwei Systeme allmählich in eine Angleichung beider Systeme zu kommen und im Prinzip an der Demokratie, an der sozialen Marktwirtschaft und an den Bündnissen, die ja Südkorea eingegangen ist, festhalten zu können. Das alles hat sich aber mittlerweile als illusorisch herausgestellt.
Timm: Die politische Einheit, die haben die Deutschen ja auch der weltpolitischen Lage zu verdanken, auch der Großzügigkeit der Großmächte USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich, dass eben in der Nachbarschaft der anderen Mächte diese deutsche Wiedervereinigung zugelassen wurde. Und nun spielt ja auch bei Nord- und Südkorea die weltpolitische Lage eine große Rolle, ist da aber anders geartet. Was würden denn die Nachbarn, die Großmächte zu solch einer Vereinigung sagen?
Tidten: Exakt. Hier haben Sie genau den wichtigsten wohl die beiden Länder unterscheidenden Punkt getroffen. Wenn wir uns erinnern: Die Wiedervereinigung unseres Landes geschah vor dem Hintergrund, dass sozusagen der Druck auf die Erhaltung der Systeme sowohl im Westen als auch im Osten zunächst von den sogenannten Schutzfunktionen der jeweiligen Schutzmächte kamen, das heißt, es war während des Kalten Krieges das Interesse der Sowjetunion, das System DDR zu halten, und es war Interesse des westlichen Bündnisses, das System Bundesrepublik zu erhalten. Diese Konstellation haben Sie auf der koreanischen Halbinsel nicht. Der Druck auf das System in Nordkorea kommt mittlerweile ausschließlich aus dem Land selber, das heißt, die äußeren Faktoren – also die Beziehung zu China, die Beziehung zu Russland, die Beziehung zu den Vereinigten Staaten – sind eigentlich nur Mittel zum Zweck des Regimes, des Regimeerhaltes in Nordkorea. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Timm: Also so abgeschottet wie Nordkorea heute ist, war die DDR zu keinem Zeitpunkt.
Tidten: Nein, nein. Nordkorea ist heute mit eingeschweißten Radiosendern, mit Staatsfernsehen, mit einer kontrollierten Presse, mit der Unmöglichkeit, überhaupt Informationen von außen zu bekommen, dermaßen abgeschottet, wie wir es noch in keinem anderen Land auf diesem Globus gefunden haben.
Timm: Die Ostdeutschen waren ja über Westdeutschland viel besser informiert als umgekehrt. Gibt es denn eigentlich so, ja, Piratensender, wie es für Ostdeutschland eine Zeitlang der Deutschlandfunk der RIAS waren, die den anderen Teil des Landes, ja, auf dem Laufenden gehalten haben?
Tidten: Es gab vergleichbare Versuche sozusagen, am 38. Breitengrad den Norden zu beschallen mit entsprechenden Sendungen aus Südkorea. Es gab Versuche, über Ballons Flugblätter in den Norden zu bringen und abwerfen zu lassen. All das wurde aber sofort als massive Provokation seitens des Nordens betrachtet und entsprechend beantwortet – mit Raketentests, mit geheimen Versuchen, die Urananreicherung weiterzuführen, mit der Drohung, die Provokationen des Südens zu beantworten in militärischen Schlägen, sodass diese zaghaften Versuche sehr schnell wieder eingestellt wurden, um eigentlich die Situation auf der koreanischen Halbinsel nicht noch weiter zu verschärfen.
Timm: Das klingt, als wäre dieser Traum, der möglicherweise vor 20 Jahren auch in Korea sich entzündet hat, noch sehr weit entfernt.
Tidten: So würde ich das sehen. Wir haben heute eine Situation, dass eigentlich alle, die jetzt sozusagen involviert sind in diesen Prozess der Lösung der Probleme der koreanischen Frage – ich spreche von den Sechs-Länder-Gesprächen –, das sind fast alles Status-quo-Mächte. Es gibt kaum ein Land, selbst Südkorea kann man nicht mehr ernsthaft zu den Ländern zählen, die ein vitales Interesse daran haben, jetzt die Wiedervereinigung zu machen. Für China wäre es ein Desaster, es wäre ein Pufferstaat weg, es stünden 30.000 amerikanische Soldaten an der chinesischen Grenze, für Südkorea wäre es eine wirtschaftliche Überforderung, für Nordkorea wäre es das Ende des Regimes, für Japan bedeutete es einen immensen Zufluss von Flüchtlingen. Kein Land ist wirklich interessiert. Und ich glaube, wir müssen noch einige Jahre mit dieser Situation leben.
Timm: Das sind jetzt so viele Aspekte, die Sie uns aufgezählt haben, lassen Sie uns das mal ein bisschen auseinanderpuzzeln, Herr Tidten. Südkorea hat ja die Unterstützung der Amerikaner. Das kann den Chinesen dann nicht so wirklich recht sein, wenn diese Vereinigung ... Dann wären ja die Amerikaner im Land, oder wie würden da dann die Weltmächte reagieren in diesem Mosaikspiel, dass es einfach politisch gibt?
Tidten: Bedingt sind die Chinesen betroffen von der amerikanischen Präsenz. Es gibt in dieser Region in Nordostasien zwei sehr wichtige sicherheitspolitische Elemente, Strukturelemente, das sind Allianzverträge, die die Amerikaner haben. Der eine ist mit Südkorea, der berechtigt die Vereinigten Staaten seit Ende des Koreakrieges 1953 zur Stationierung von ungefähr 30.000 amerikanischen Militär, was nach wie vor dort stationiert ist. Der zweite Sicherheitsvertrag ist mit den Japanern, die auch amerikanische Truppen im Land haben und die ebenfalls eine sehr wichtige Allianz bilden. Für China selbst bedeutet die Präsenz der Amerikaner zumindest die Garantie, dass auch Südkorea nicht ohne völlige Kontrolle der Amerikaner sich bewegen wird, denn mittlerweile wissen wir, dass die Interessen der USA und Chinas in dieser Region ausgeglichen werden müssen, und beide Länder wollen das natürlich. Zudem ist China nicht daran interessiert, dass Nordkorea wegfällt als Regime, weil wir dann eine Vereinigung haben, und dann hätten wir ein Ergebnis, was beide, sowohl China als auch die USA, nicht haben wollten, nämlich, im wiedervereinigten Erbe der Koreaner eine atomare Bewaffnung zu haben. Das will keiner.
Timm: Deutschlandradio Kultur, das "Radiofeuilleton", mit einem Gedankenspiel: Was wäre, wenn der eiserne Vorhang zwischen Nord- und Südkorea fiele? Darüber sprechen wir mit Markus Tidten von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Tidten, Sie haben uns eben ein bisschen die weltpolitische Lage drum rum erklärt, Sie haben aber davor gesagt, Südkorea hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch kein Interesse dran, sich mit Nordkorea wiederzuvereinigen. Warum? Man sollte doch meinen, das sind doch ihre Leute?
Tidten: Das ist richtig. Es ist auch ähnlich wie bei uns im Grundgesetz seinerzeit Staatsziel Südkoreas, die Wiedervereinigung. Man braucht also beispielsweise keine Volksabstimmung, ob man denn wiedervereinigen will oder nicht, es ist erklärtes Staatsziel. Aber die Beispiele, die Südkorea erkannt hat hier in Europa mit der Wiedervereinigung Deutschlands und der DDR, der Bundesrepublik und der DDR – die enormen finanziellen Belastungen, die Schwierigkeiten in dem Zusammenführen von zwei völlig unterschiedlichen Systemen – schrecken vor allen Dingen die Wirtschaft in Südkorea ab. Und ich glaube, dass zwar die Begeisterung in der Bevölkerung noch eine gewisse Weile anhält, was die Wiedervereinigung angeht, dass aber die entscheidenden Figuren, also die Politik, die Regierung, zumal wir jetzt eine sehr konservative Regierung in Seoul haben, eher sozusagen auf Zeit spielt und man es nicht überstürzen möchte. Und eine Begeisterung ist bestenfalls noch in Randbereichen von wirtschaftlich weniger wichtigen Bevölkerungskreisen zu entdecken, aber die große Linie ist, wenn ich die Situation in Südkorea richtig beurteile, eher abwarten, keine überstürzten Schritte.
Timm: Nun ist Nordkorea nach allem, was wir wissen, wir wissen wenig genug, aber nach allem, was wir wissen, ist Nordkorea viel ärmer als die DDR jemals war. Das war eine funktionierende, mehr schlecht als recht, aber eine funktionierende Volkswirtschaft, und von Nordkorea hört man ja Geschichten, dass Menschen sogar hungern. Insofern ist das einleuchtend, wenn Sie beschreiben, Südkorea wäre wirtschaftlich überfordert. Aber das wäre ja viel zu schwierig, das werden wir nicht mehr erleben, das wird uns wirtschaftlich überfordern – das hätte man in Deutschland, jede Wette, 1988 auch noch gesagt. Und dann ging es plötzlich ganz schnell. Überwiegt das Rationale, was Sie eben geschildert haben, dann wirklich den großen Traum von Menschen?
Tidten: Ich glaube, kurzfristig muss man das leider so sehen. Nicht nur ist Nordkorea sehr viel ärmer als die DDR damals, auch Südkorea ist sehr viel ärmer als die Bundesrepublik vor 20 Jahren. Also die wirtschaftliche Potenz Südkoreas ist auch nicht vergleichbar mit der, die wir hatten vor 20 Jahren in der Bundesrepublik. Dazu kommt natürlich die Überlegung, dass mit einer Wiedervereinigung beider Staaten dann das eintritt, was bisher ja nicht stattfindet, nämlich der Druck auf die Systeme. Der Druck auf die Systeme ist bisher nicht gegeben. Das Land Nordkorea erzeugt selbst den eigenen Druck gegenüber der Bevölkerung. Wenn es zu den Fragen der Wiedervereinigung kommt, dann spielen die großen Akteure eine sehr viel entscheidendere Rolle, dann kommen die Amerikaner ins Spiel, dann kommt China ins Spiel, dann kommen alle Mitglieder der Sechs-Länder-Gespräche ins Spiel, und dann stellt sich heraus, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit Südkoreas trotz der fehlenden Bündnisse – verglichen mit der Bundesrepublik damals – noch sehr viel größer ist von der Welt, als sie war für uns damals im sicheren Europa.
Timm: Und wenn man die deutsche Wiedervereinigung im sicheren Europa auch 20 Jahre später noch als politisches Geschenk nimmt, dann wird nach Ihren Ausführungen deutlich: Solche Geschenke sind äußerst, äußerst knapp auf der Welt.
Tidten: Das würde ich genau so sehen, ja.
Timm: Markus Tidten von der Stiftung Wissenschaft und Politik, wir sprachen über ein Gedankenspiel: Könnte die deutsche Wiedervereinigung zum Vorbild für Korea taugen? Und zum Weiterlesen empfehlen wir Ihnen ein Buch, das sich als Expedition in geteilte Welten versteht, und in dem Künstler – darunter auch koreanische und deutsche – solche geteilten Welten beschreiben, nämlich "Die Mauerreise", so heißt es, herausgegeben von Michael Jeismann und Hans-Georg Knopp und erschienen im Steidl Verlag.