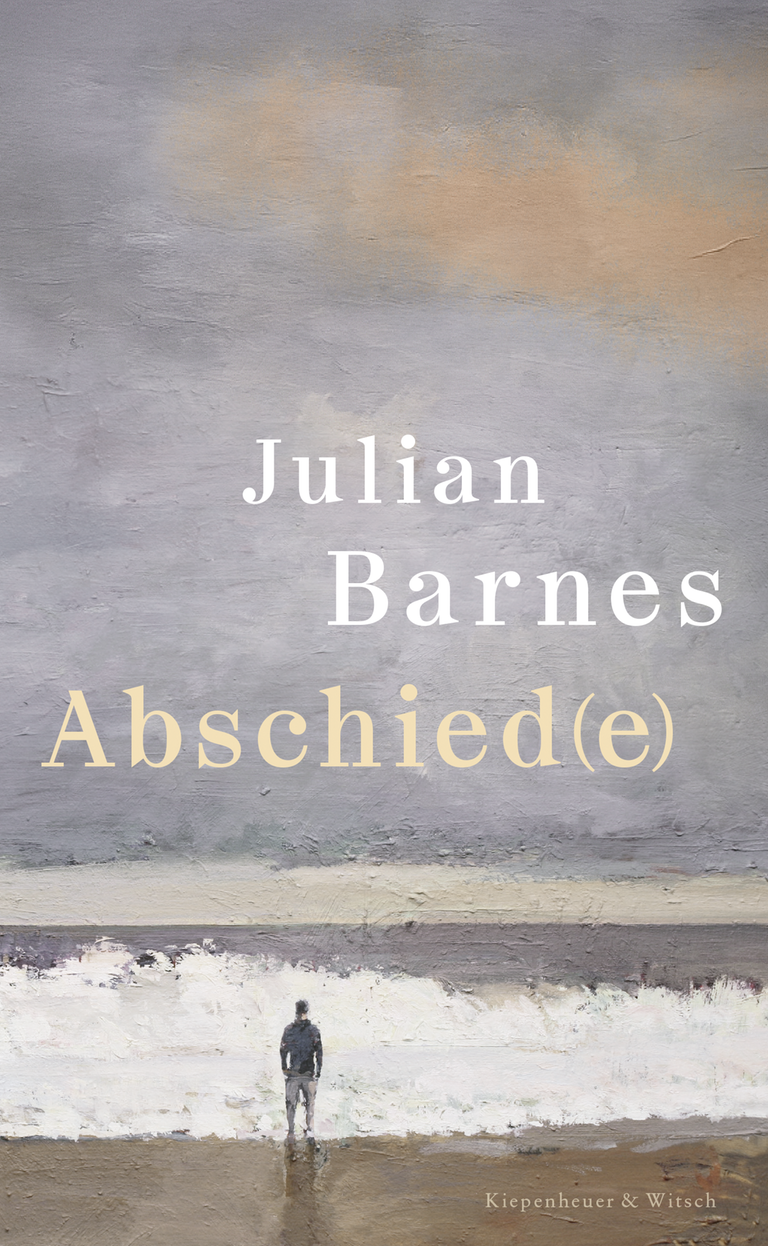Vom französischen Schriftsteller Gustave Flaubert, dem Julian Barnes einen seiner frühen Romane gewidmet hat, stammt das Bonmot: „Kaum kommen wir auf diese Welt, da fangen wir auch schon an, stückchenweise abzubröckeln.“
Und in der Tat geht es bereits mit Mitte zwanzig bergab. Die Lebensphase, die man Alter nennt, hat ihre eigenen Beschwernisse: Abnutzungserscheinungen und Krankheiten nehmen zu, oft schrumpft auch der Freundeskreis. Der Alterungsprozess ist aber so individuell wie der Umgang damit. Bis hin zur Weigerung, sich selbst als „alt“ zu bezeichnen, wie es Julian Barnes‘ neuer Roman von der betagten Mutter des Erzählers berichtet.
Dieser Erzähler heißt wie der Autor Julian Barnes, und wir dürfen den Roman ruhig autobiografisch lesen, mehrmals werden wir sogar aufgefordert, biografische Stationen zu googeln. Manches lässt sich so verifizieren, anderes muss erfunden sein – bei dem nüchtern-ironischen Briten sind solche Aufforderungen immer auch ein Spiel mit der Fiktion.
Und genau das ist der Witz und das Thema: Wie konstruieren wir eigentlich unsere Biografie? Wie funktionieren Erinnerung und Gedächtnis? Und wie geht ein Schriftsteller damit um, wenn der Tod, über den er schon so oft geschrieben hat, näher rückt – um nicht zu sagen: statistisch wahrscheinlicher wird.
„Ich habe eine alte Freundin, eine Radiologin, die mir seit Jahren Ausschnitte aus dem British Medical Journal zuschickt. Sie weiß, dass mein Interesse vornehmlich dem Makabren und Außergewöhnlichen gilt. In meinem Gedächtnis – dem Ort, an dem Verfall und Ausschmückung ineinandergreifen – habe ich Fälle gespeichert, bei denen Patienten platzten, als ein erhitztes Skalpell ihre Körpergase entzündet hatte, und andere aus der Frühzeit der Kernspintomografie, bei denen innere Nähte aus Metallfäden wie Granatsplitter in weiches Fleisch geschossen wurden.“
Julian Barnes, „Abschied(e)“
Verlust der körperlichen Integrität
„Abschied(e)“ erzählt von verschiedenen Formen des Abschieds in „posttragischen Zeiten“, wie unsere Gegenwart genannt wird. Unter anderem von Barnes‘ Frau, der Literaturagentin Pat Kavanagh, die 2008 mit 68 Jahren an einem Gehirntumor starb. Der stoische Umgang mit dem, was einem Körper angetan wird, der in seiner ganzen krankheitsbedingten Verletzlichkeit in das medizinische System eingespeist wird, hilft dem Erzähler, zumindest wenn es um den eigenen Körper geht. Als Zufallsbefund wird ihm eine seltene Form von Blutkrebs attestiert, eine Myeloproliferative Neoplasie. Daran müsse man nicht unbedingt sterben, beruhigt ihn die Ärztin, es handle sich um eine zwar unheilbare, aber beherrschbare Krebsart.
Mit zunehmendem Alter werde in immer mehr Körperöffnungen „medizinisch eingedrungen“, formuliert Barnes den Verlust der körperlichen Integrität, die jeder Patient irgendwie akzeptieren muss, um sich behandeln zu lassen. Zufälligerweise fallen Diagnose und der erste Lockdown im März 2020 zeitlich zusammen, das Leben gerät in eine „zweifache Stagnation“, wie es heißt.
Damit die Sache nicht allzu trüb wird, baut Julian Barnes eine Liebesgeschichte ein. Stephen, ein Freund aus Studientagen im Oxford der 1960er-Jahre, meldete sich nach vierzig Jahren und bat den Erzähler, abermals den Mittelsmann zu spielen, zu Jean, der Frau, in die sie als Studenten beide verliebt waren. Stephen und Jean wurden ein Paar und gingen am Ende des Studiums doch auseinander. Nach Jahrzehnten wollte Stephen die Liebe wiederbeleben. Julian ist als Kuppler erfolgreich – nach ihrer Hochzeit erzählen sie ihm nun regelmäßig aus ihrem Liebesleben.
Auch guter Sex kann ein Problem sein
„‘Guter Sex kann ebenso ein Problem sein wie schlechter Sex‘, fuhr sie fort. ‘Unter gewissen Umständen.‘ Wie die meisten Männer hat mich das weibliche Innenleben oft verblüfft und frappiert. Aber das hier war mir neu.“
Julian Barnes, „Abschied(e)“
Das alles ist zum Zeitpunkt der Diagnose längst geschehen. Ob es sich wirklich ereignet hat, bleibt ungewiss. Geschickt baut Barnes die Geschichte mit einem seiner literarischen Tricks ins Geschehen ein. Ihm werde oft erst im Nachhinein klar, was in einer früheren Lebensphase wichtig gewesen sei. Damit lassen sich jederzeit neue Geschichten aus dem autofiktionalen Hut zaubern.
Julian Barnes nimmt die Mechanismen des Erinnerns und Erzählens auseinander, mit ausführlichen Reflexionen zu Marcel Proust. Wenn manche Neuropsychopathologien zu einem übermäßig detaillierten Gedächtnis führen, fragt er sich, ob man wirklich seine Vergangenheit jederzeit zur Verfügung haben möchte. Beschädigt das nicht die Gegenwart? Dabei analysiert er, wie Notizbücher und Tagebücher das Erinnern verändern und ob sie der schriftstellerischen Arbeit überhaupt förderlich sind. Den ersten, in Oxford spielenden Teil der Liebesgeschichte erzähle er aus dem Gedächtnis, betont er, den zweiten Teil mit der Erfahrung eines Notiz- und Tagebücher schreibenden Schriftstellers.
Eine Abschiedsgeste an die Leser
Der Roman ist auch eine Abschiedsgeste an die Leser, für deren Treue sich Julian Barnes ausdrücklich bedankt. Er suggeriert, es sei sein definitiv letzter Roman, aber wer weiß das schon. „Abschied(e)“ ist ganz offen ein Alterswerk, das dem Schrecken der eigenen Endlichkeit ins Auge blickt. Es wirkt manchmal ein bisschen zusammengeschraubt, aber das macht nichts, sofern man bereit ist, den eigenen Geist auf Kontemplation einzustimmen. Man braucht Zeit und Geduld und die Lust, verschiedene Aspekte des Gedächtnisses auch an sich selbst zu beobachten. Dann liest sich „Abschied(e)“ als romaneskes Beispiel stoischer Lebenskunst.