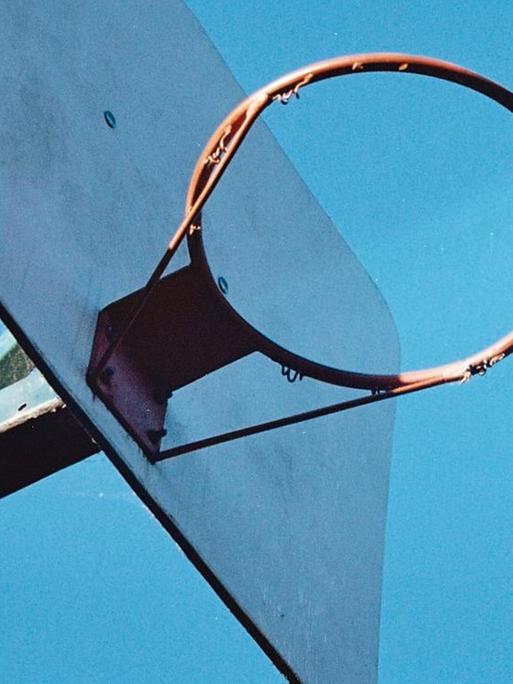Die Ausgebremsten
26:43 Minuten

Zu Hause bei den Eltern hocken, statt die Welt zu entdecken. Allein sein statt in Gemeinschaft. Auf den Bildschirm starren, statt zu tanzen. Die Pandemie ist eine Zumutung für Jugendliche. Nicht nur in Deutschland.
Mika ist 17 Jahre alt und hat genug. Er hängt seit einem Jahr zu Hause in Berlin-Wilmersdorf rum, er nimmt klaglos alle Pandemieregeln hin und findet es ungerecht, dass es ständig nur um die Alten geht.
"Wir, die Jugend von heute, sind wahrscheinlich solidarischer mit den Alten als sie mit uns. Meine Generation muss nämlich nach dem Klima jetzt auch noch die Rentner retten. Also alle, die jahrelang unsere Zukunft ignoriert haben. Will eigentlich irgendwer wissen, wie es uns geht?"
Nur Alte reden in den Talkshows
Für seine Schulfreundin Jess ist Onlineunterricht ein Horror, sie kann so nicht lernen und vermisst das Gemeinschaftsgefühl extrem. Sein Kumpel Juri steht kurz vor dem Abitur. Er muss auf Sport verzichten, auf Ausflüge und auch auf das gemeinsame Lernen mit anderen.

Mika findet, in der Coronadebatte drehe sich alles nur um die Alten.© Deutschlandradio / Ellen Häring
Mika findet, dass endlich mal über die seelische Gesundheit der Jugendlichen gesprochen werden sollte - und zwar mit Jugendlichen.
"Für uns fühlt es sich so an, als würde Politik gemacht werden für Menschen, die nach 21 Uhr sowieso nicht mehr das Haus verlassen. Es gibt Unmengen an Talkshows. Wieso sitzen da immer nur Alte?"
"Manchmal wollte ich gar nicht mehr raus"
Gemeinsames Feiern, Freundschaften und natürlich auch Liebschaften vermisst auch Marisol. Sie ist wie Mika 17 Jahre alt, lebt aber im Süden Mexikos, in Oaxaca. Sie ist mit dem Alleinsein und dem Onlineunterricht auch nicht gut klargekommen:
"Ich habe mich in mir selbst eingeschlossen. Es gab einen Moment, da wollte ich gar nicht mehr raus, ich wollte noch nicht einmal mehr mein Zimmer verlassen. Ich hatte auf nichts mehr Lust."
Vor der Pandemie hat Marisol in der Volleyball-Mannschaft der Schule gespielt. Beim Training hat sie sich kurz vor Beginn der Pandemie ein bisschen in einen Jungen verliebt.
"Am Anfang haben wir uns noch Nachrichten geschrieben und dachten, dass wir uns irgendwann bald wieder sehen würden. Aber jetzt ist die Pandemie immer noch nicht zu Ende. Wenn man sich nur noch Nachrichten schreibt, das ist nicht das Gleiche. Irgendwann hat es sich dann verlaufen."

"Es gab einen Moment, da wollte ich gar nicht mehr raus", sagt die 17-jährige Marisol aus Mexiko. © Deutschlandradio / Anne Demmer
Seit einem Jahr hat Marisol ihre Freundinnen nicht getroffen, sie sieht sie lediglich auf den kleinen Bildern beim Onlineunterricht.
"Es ist schon irgendwie frustrierend. Wir haben kurz vor dem Abi so viel gemeinsame Zeit verloren. Wir können nicht ausgehen, ins Kino, Pizza essen gehen. So wie wir es immer gemacht haben. Die Tage sind eintönig."
"Eigentlich will ich mal was Großes werden"
Omar ist 13 und lebt ebenfalls in Mexiko, allerdings auf dem Dorf im Norden des Bundesstaates Oaxaca. Internetempfang gibt es in dem Dorf nicht, auch für das Fernsehen reicht das Signal nicht aus, sodass der Unterricht über diese Medien nicht stattfinden kann.
"In den letzten Tagen habe ich nur gearbeitet, wir haben Brennholz gesucht. Also habe ich nichts für die Schule gemacht. Mein Vater zeigt mir, wie man Holz hackt, wie man Mais anbaut, all diese Sachen."
Omars Lehrer kommt nur einmal im Monat vorbei, sammelt die Übungen ein, die Omar in der Zwischenzeit gemacht hat. Ansonsten gibt es zwischen dem Lehrer und seinen Schülern keinen Kontakt.

In Omars Dorf gibt es nicht einmal Fernsehen.© Deutschlandradio / Anne Demmer
Er vermisst die Schule, den täglichen Unterricht. Obwohl es keinen einzigen Covid-Fall in dem Dorf gibt, bleibt sie geschlossen.
"Ich will eigentlich mal studieren und etwas Großes werden, etwas für mein Dorf tun. Ich würde gerne Archäologe werden. Es gibt so viel zu entdecken, so viel Kultur."
Um diesen Traumjob zu ergreifen, braucht er einen guten Abschluss. Doch wann die Schule wieder aufmacht, weiß er nicht. In Mexiko wird zwar inzwischen auch auf dem Land geimpft, aber Jugendliche sind - wie überall - noch nicht dran. Sie müssen warten.
Manchen kann die Pandemie auch nützen
Hend Hussein ist 23 Jahre alt und kommt aus Ägypten. Sie studiert in Berlin, hat fließend Deutsch gelernt und wohnt in einer WG. Trotz der guten Gemeinschaft, die sie umgibt, fühlt sie sich manchmal nicht richtig zugehörig. Ihr hat die Pandemie genutzt. Sie ist im Winter nach Ägypten zu ihrer Familie gefahren. Das hätte sie ohne Pandemie ganz bestimmt nicht gemacht. Sie wollte vor fünf Jahren unbedingt weg aus Ägypten und suchte auch Distanz zur Familie. Sie wollte Freiheit. Die will sie immer noch, aber Corona hat einiges verändert:
"Im Winter habe ich mich gefragt: ‚Was mache ich in Europa eigentlich? Wenn alles zu Ende geht, wenn ich nichts mehr leisten muss und nirgendwohin rennen muss, was mache ich hier?‘ Ich spürte immer noch Angst vor der Rückkehr. Aber ich wollte bei meiner Familie sein. Also bin ich im Dezember gefahren."
Die Familie neu entdecken
"Das Ankommen war sehr schön. Meine Mutter hat mal davon geträumt, dass ich vor ihrer Haustür als Überraschung stehe. Ich habe mich darüber gefreut, dass das kein Traum mehr war. Aber zu Hause zu sein war nicht ganz leicht. Es ist schwer, an einen Ort zu gehen, wo du lange gedacht hast, du wirst nie zurückkommen. Man erinnert sich wieder daran, wieso man einmal gegangen ist. Aber alle anderen scheinen es vergessen zu haben."
Hend ist schließlich dreieinhalb Monate in Ägypten geblieben, hat sich aber ein Zimmer in Kairo gemietet. Sie hatte einen Job und etwas Geld, so konnte sie es sich leisten, mit dem Taxi zu fahren und in einem relativ reichen Viertel zu wohnen. Sie fühlte sich als Frau freier als früher.
"Mein Aussehen hat sich in Berlin auch verändert. Menschen denken, ich käme nicht aus Ägypten oder sie glauben, ich bin eine reiche Ägypterin. Ich kann mich anziehen, wie ich will, solange ich Uber-Taxi fahre oder in einem der reichen Viertel rumlaufe. Außerdem tut sich aktuell was für Frauenrechte in Ägypten. Also gibt es mehr Räume als früher für mich, in denen ich mich sicher fühle."
Hend hat nicht nur Ägypten, sondern auch ihre Familie neu kennengelernt. Sie hat viele Gespräche und Diskussionen geführt, Fragen gestellt und zugehört:
"Ich glaube, dass ich diese Zeit unter anderen Umständen nicht so genutzt hätte. Ich habe die Endlichkeit des Lebens gesehen und mich gefragt, worauf es mir ankommt. Und ich wollte mehr über meine Familiengeschichte wissen. Denn es prägt mich bis jetzt sehr stark."
Hend ist nun wieder in Berlin, aber sie hat neue Bande nach Ägypten knüpfen können – dank der Pandemie. Hend hat also von der Auszeit profitiert. Das gibt es auch.
Viele Jugendlichen bleiben auf der Strecke
Es trifft allerdings nicht auf Enoch und Grace aus Kenia zu.
Unterricht ist in Kenia nur für manche eine Option, viele haben gar keinen Computer oder Internetanschluss. Schule über Fernsehen und Radio war dort angesagt und dabei sind einige Jugendliche auf der Strecke geblieben.
Enoch ist 16 und wohnt mit seiner Großmutter in einem Zimmer in Mathare, einem der Slums in Kenias Hauptstadt Nairobi. Früher ging Enoch zur Schule und seine Großmutter arbeitete als Haushaltshilfe. Aber seit dem Beginn der Corona-Pandemie sitzen die beiden häufig nebeneinander auf dem Sofa, schlagen die Zeit mit Fernsehen tot. Enoch fügt sich in sein Schicksal:
"Die Pandemie hat mein Leben sehr verändert. Ich muss das hinnehmen, meine Großmutter hat einfach kein Geld mehr, sie kann mich nicht wieder in die Schule schicken."
Statt Elektroingenieur ist Enoch Wasserträger
Dabei wollte Enoch eigentlich Ingenieur werden. Elektoingenieur. Stattdessen arbeitet er jetzt als Wasserträger. Er muss Geld verdienen und in seiner Nachbarschaft hat kaum jemand fließendes Wasser zu Hause. Wer einen Anschluss bezahlen kann, macht daraus ein kleines Geschäft und füllt anderen gegen Geld die Kanister. Enoch trägt den Leuten dann die vollen Kanister nach Hause. Wenn es möglich wäre, würde Enoch sofort wieder in die Schule gehen.
Ein paar Stockwerke über Enoch wohnt die 17-jährige Grace mit ihren Eltern und ihrem neu geborenen Sohn. Sie wurde schwanger, nachdem die Corona-Pandemie anfing.
Die Zahl ungewollter Schwangerschaften vor allem minderjähriger Mütter ist in Kenia mit dem Beginn der Corona-Pandemie drastisch gestiegen. Schwangerschaften dürfen aber nur in medizinischen Notfällen abgebrochen werden. Grace entschied sich für das Baby.
"Einige meiner Freundinnen haben illegal abgetrieben. Ich bekam mit, welche Schmerzen sie anschließend hatten, einige sind gestorben. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden, ich wollte nicht mein Leben aufs Spiel setzen."
Ohne Schulabschluss mit Baby bei den Eltern
Zu dem Vater des Kindes hat sie keinen Kontakt mehr. Weil ihre Eltern wegen der Corona-Pandemie auch ihre Gelegenheitsjobs verloren haben, versucht Grace, mitzuverdienen. An guten Tagen kann sie als Wäscherin arbeiten. Für die Schulgebühren reicht das Geld nicht mehr und Grace hat sich von ihrem Traum verabschiedet: Journalistin zu werden.
"Jetzt hoffe ich, dass ich einen Förderer finde, der mir helfen kann, eine Ausbildung zur Friseurin und Kosmetikerin zu machen."
Für sie und Enoch, der vom Ingenieurberuf träumt, hat die Corona-Pandemie alles verändert: Die beiden waren gut in der Schule und hätten es schaffen können, einen Beruf zu lernen, Arbeit zu finden und aus dem Slum wegzuziehen. Jetzt sieht es eher so aus, als läge auch vor ihnen nur die Zukunft als Tagelöhner.