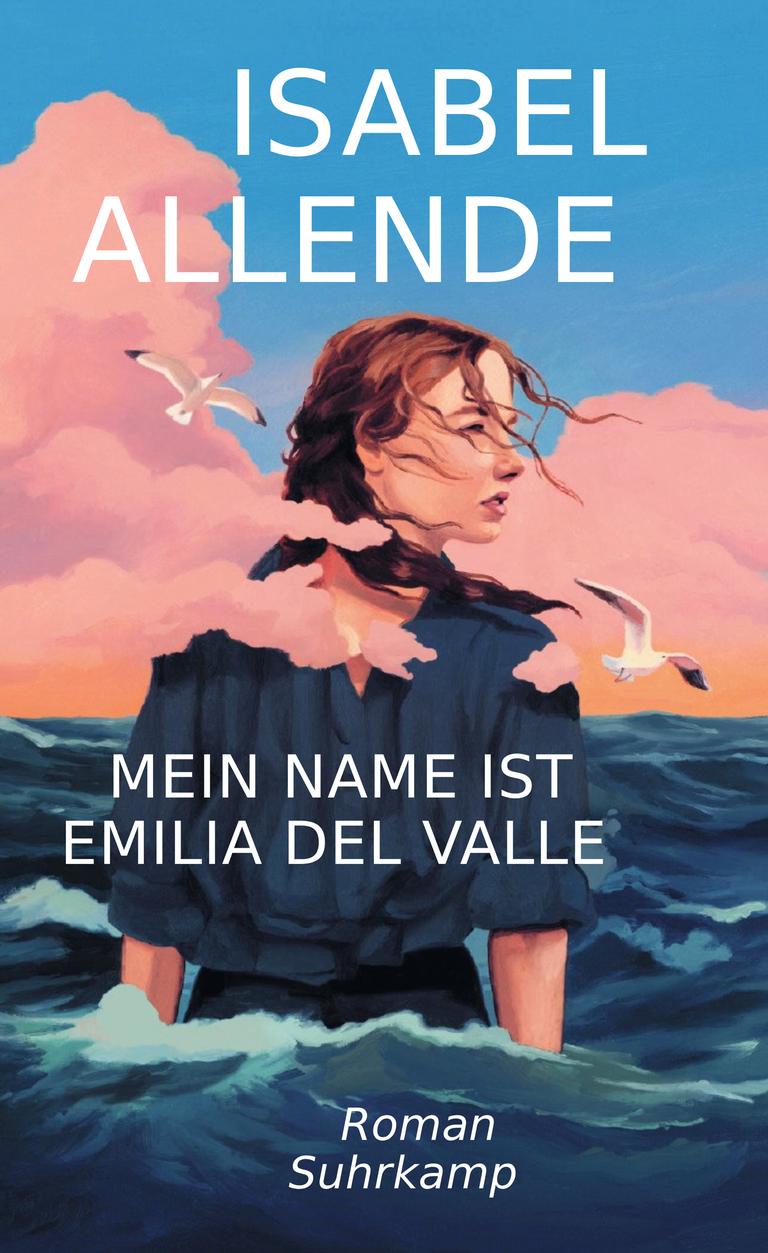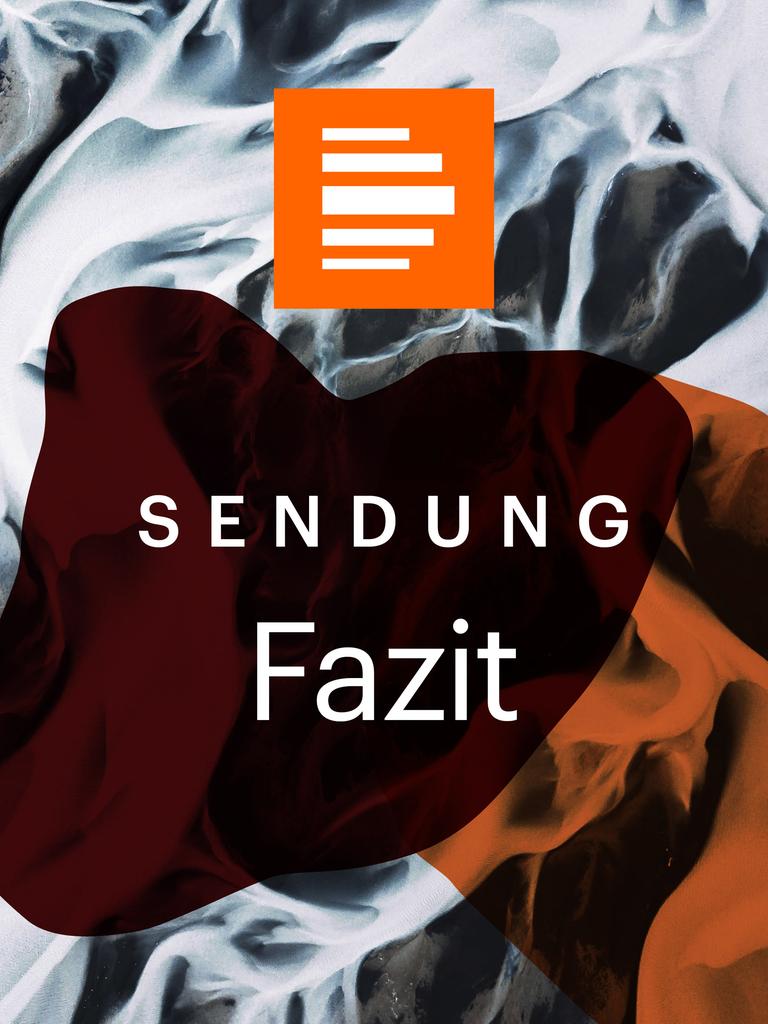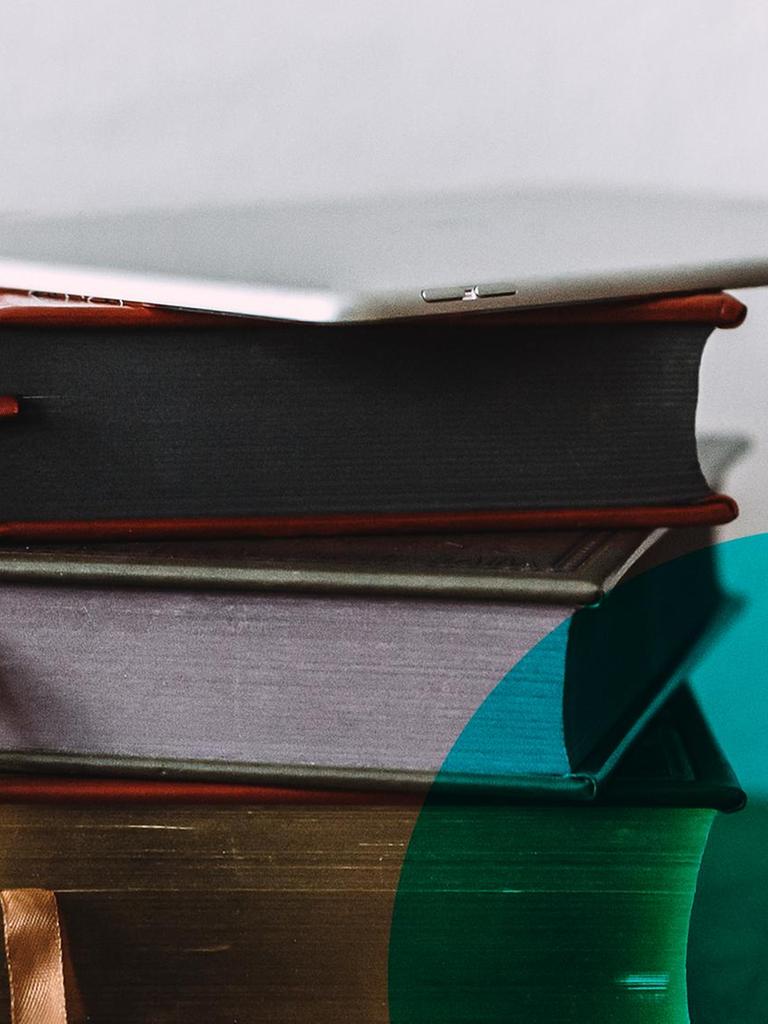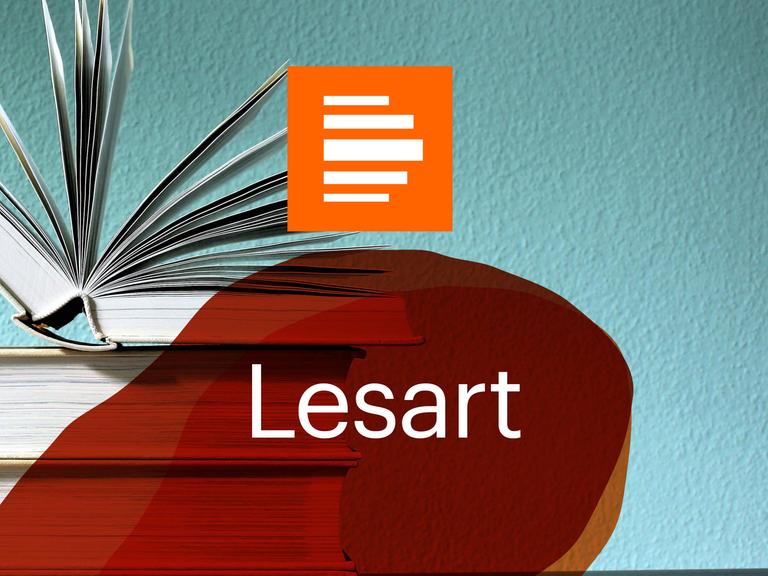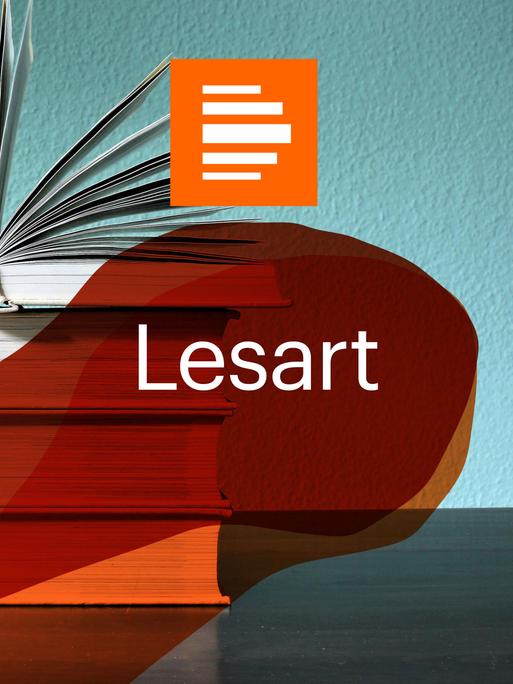Emilia wächst am Ende des 19. Jahrhunderts in San Francisco auf. Kalifornien war erst kurz zuvor, nämlich 1848, Mexiko von den Vereinigten Staaten abgenommen worden. Die Ich-Erzählerin – mit ihrer Mutter ins Zentrum rund um den vornehmen Nob Hill unterwegs – schildert die gesellschaftlichen Gegensätze in der Stadt am Pazifik.
„Bis dahin hatte ich nicht mitbekommen, dass es auch Menschen gab, denen es besser ging als uns […]. Die Kutschen mit den glänzenden Pferden, die Damen in überquellenden viktorianischen Rüschenkleidern mit Löckchen und Schleifen im Haar, die Herren mit Zylinder und Gehstock und die Kinder im Matrosenanzug gehörten für mich zu einer anderen Spezies. In unserem Viertel lebte die arbeitende Bevölkerung, wir waren alle mehr oder weniger gleich. Die Häuser dort beherbergten zumeist eine oder zwei Familien mit barfüßigen Kindern, ständig schwangeren Frauen und dauerbetrunkenen Männern, die ihr Auskommen mal hier, mal da als Tagelöhner fanden.“
Aus „Mein Name ist Emilia del Valle“ von Isabel Allende
Emilia ist ein Ausnahmetalent. Sie beginnt früh zu schreiben, hat schon als Teenager beim Publikum gewissen Erfolg mit trivialen Gruselromanen, die als Heftchen verbreitet werden. Mit dieser Erfahrung und dem daraus erwachsenen Selbstbewusstsein bewirbt sie sich bei einer großen Zeitung und wird eingestellt – als erste Frau.
Eine ehrgeizige und unerschrockene Heldin
Isabel Allende lässt ihre ehrgeizige und unerschrockene Heldin das männerdominierte Metier des Journalismus aufmischen. Als in Chile 1891 ein Bürgerkrieg ausbricht, gelingt es ihr, den Chefredakteur zu überzeugen, dass sie die Richtige ist für die Kriegsberichterstattung aus diesem Land. Zumal sie Spanisch spricht und ihr Vater Chilene ist – auch wenn der sich, direkt nachdem er die Mutter verführt hatte, aus dem Staub gemacht hat.
Emilia nennt sich, obwohl der Hallodri aus der Oberschicht sie nie als seine Tochter anerkannt hat, kurzerhand wie ihr leiblicher Vater: Emilia del Valle – und schifft sich nach Südamerika ein:
„Valparaíso war der wichtigste Hafen am Pazifik, nur vergleichbar mit San Francisco, von hier aus wurden chilenische Waren in alle Welt verschifft, Metalle, Leder, Wolle, Holz, Weizen. Schon am frühen Morgen brodelte der Hafen vom Hin und Her der Seeleute, Stauer, Händler, Karren und Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, von modisch gekleideten Damen und Herren bis hin zu Bettlern in Lumpen.“
Aus „Mein Name ist Emilia del Valle“ von Isabel Allende
Bis hierhin ist Emilia del Valle eine coole junge Frau, die sich von Konventionen nicht einschnüren lässt und mit ziemlicher Kaltschnäuzigkeit ihren Weg geht. Männern begegnet sie mit einer Mischung aus Charme und Frechheit. Sie nimmt sich das Recht auf sexuelle Erfahrungen, ohne sittsam verheiratet zu sein. Eine markant skizzierte Romanheldin, eine frühe Kämpferin für die Selbstverwirklichung von Frauen.
Anfangs kraftvoll, dann kitschig
Die Figur ist eine Reminiszenz an Isabel Allendes eigene Zeit als Journalistin und engagierte Frauenrechtlerin. Und so ist auch die Sprache, die sie im ersten Teil dieses Romans verwendet: straff, schnell, entschieden, auf den Punkt. Man ist beim Lesen verblüfft über die scheinbar ungebrochene literarische Kraft dieser 1942 geborenen Schriftstellerin.
Doch leider hält dieser Eindruck nicht. Denn unwillkürlich kippen Handlung und Ton. Zunächst in eine – sehr Allende-typische und dadurch vorhersehbare – Love-Story mit dem Kollegen Eric, der gemeinsam mit ihr von der Zeitung nach Chile geschickt wird:
„Wir liefen aufeinander zu und fielen uns ungewohnt stürmisch um den Hals. Emilia! Eric!, ging es hin und her, bis einer dieser Ausrufe in einen Kuss mündete. In einen sehr langen Kuss oder vielleicht auch in eine ganze Reihe davon.“
Aus „Mein Name ist Emilia del Valle“ von Isabel Allende
Ganz ohne entsprechende erotische Stellen, die das Herzschmerz-Genre und Allendes treue Leserschaft bedienen, geht es bei der Meisterin der dick aufgetragenen Emotion eben nicht:
„Ich ließ mich zum Bett führen, wo Eric sich die Kleider vom Leib riss und mich an sich drückte. Er roch nach Tabak und süßlichem Schweiß.“
Aus „Mein Name ist Emilia del Valle“ von Isabel Allende
Die Handlung verzettelt sich
Nach solcherlei liebesromaneskem Bettgeflüster verzettelt sich die Struktur der Handlung.
Emilias eigentliche Hauptmotivation, nach Chile zu reisen nämlich, den verschollenen Erzeuger ausfindig zu machen, tritt zunehmend in den Hintergrund. Als sie ihm schließlich begegnet, liegt der einstige Don Juan – nun zum Frömmler mutiert – auf dem Sterbebett.
Sein gesamtes Vermögen, auf das Emilia hoffte, hat der Lebemann durchgebracht. Nur ein wertloses Stück Land ganz im Süden ist vom Erbe übrig. Emilia ist davon besessen, dieses abgelegene Gebiet tief in den Jagdgründen der Mapuche aufzusuchen. Warum sie das tut und in der Einsamkeit ihre Wurzeln als eine Art Waldgeist findet, bleibt völlig rätselhaft. Dass die in San Francisco geborene Tochter einer Irin und eines Chilenen aus der europäischen Oberschicht ihre Identität in den finsteren Wäldern Araukaniens sucht, wirkt ziemlich an den Haaren herbeigezogen.
Das „Magische“ gerinnt zum reinen Klischee
Das Ganze rutscht immer mehr in Richtung mystischer Innerlichkeitskitsch. Das „Magische“, das Allende als Stilmittel und Marker ihrer Einbettung in die lateinamerikanische Literaturtradition in vielen ihrer Werke verwendet hat, gerinnt in diesem Roman hier zum reinen Klischee.
Isabel Allende, Tochter eines Diplomaten und entfernte Verwandte des 1973 durch den Militärputsch gestürzten Staatspräsidenten Salvador Allende, hätte – so meint man es am Beginn der Lektüre zu spüren – noch einmal einen großen Epochenroman über die gewaltsame Geschichte ihrer Heimat Chile, den Journalismus und eine außergewöhnliche Frauenfigur schreiben können. Leider ist am Ende nur ein seichtes Alterswerk herausgekommen.