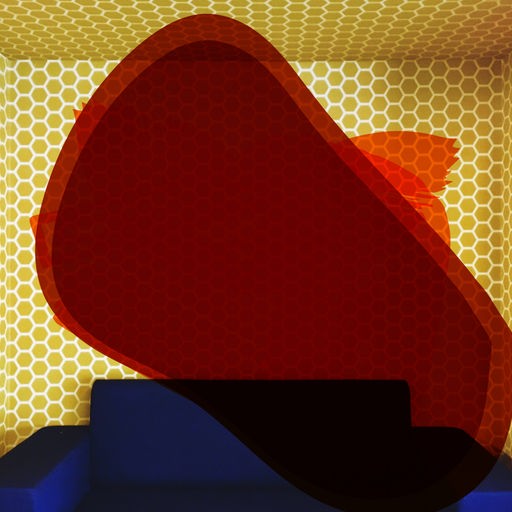Die Tücken der Herkunftsfrage
58:21 Minuten

"Wo kommen Sie her?" Welche Fallstricke die Frage nach der Herkunft birgt und was sie über den Zustand der deutschen Gesellschaft verrät, damit befasste sich eine Diskussionsrunde auf der Buchmesse - und diese Frage stieß auf sehr komplexe Antworten.
"Integration ist ja ein großer Begriff", stellte der Journalist Marvin Oppong gleich zu Beginn der "Blauen Stunde" von Deutschlandfunk Kultur auf der Leipziger Buchmesse fest, die sich genau mit diesem Thema befasste. Er diskutierte gemeinsam mit den Journalistinnen Ferda Ataman, Jagoda Marinić und Dilek Güngör, die sich auch in ihren aktuellen Büchern Integrationsfragen widmen.
Und Oppong weitete auch gleich den Blick. "Man muss erst mal gucken, was überhaupt worein integriert werden soll. Ich glaube die gemeinhin angenommenen Integrationsprobleme in unserem Land sind zum Teil gar nicht so groß. Es gibt auch gar nicht wenig Leute, die man vielleicht in die neue, multikulturelle Gesellschaft integrieren muss: Deutsche."

Marvin Oppong (v.l.), Jagoda Marinic, Dilek Güngör, Ferda Ataman und Deutschlandfunk Kultur-Moderatorin Christine Watty bei der Blauen Stunde auf der Leipziger Buchmesse 2019© Deutschlandradio
Die Hauptfigur in Dilek Güngörs Buch "Ich bin Özlem" verweist allerdings auch selbst immer wieder auf ihre Herkunft. "Ich glaube Özlem ist sich am Anfang gar nicht darüber bewusst, dass sie diese Migrantisierung auch so gefressen hat", erzählte die Autorin. "Dass sie reflexartig immer ihre Herkunft erklärt, auch wenn niemand danach gefragt hat. Und eigentlich erst im Lauf des Roman darauf kommt: Warum tue ich das eigentlich und wie hat das angefangen? Und als sie damit aufhören möchte, erst mal gar nicht weiß, wie sie sich beschreiben soll, weil sie sich so daran gewöhnt hat, von klein auf, ihren Anfangspunkt, die Geschichte ihrer selbst immer von der Herkunft ihrer Eltern her aufzuziehen, und als es dann plötzlich wegfällt, denkt sie: Ja, wer bin ich denn dann, wenn das keine Rolle mehr spielt?"
Ataman: Herkunftsfrage als Symbol für "ein völkisches 'Wir'"
Ferda Ataman, Autorin des Buchs "Ich bin von hier. Hört auf zu fragen!", sieht die Frage nach der Herkunft in anderer Hinsicht kritisch. "Seit es Kinder von Migranten gibt, so lange gibt es schon diese Debatte, so dass man, wenn man hier geboren ist, und hier aufgewachsen ist, es irgendwann doch befremdlich findet, wenn man mehrmals die Woche erklären soll, wo man herkommt, und wenn man sagt, man kommt halt von hier, dass diese Antwort nicht akzeptiert wird", beschreibt Ataman ihre Erfahrung.
"Also es ist gar nicht so sehr die Frage, sondern es ist das, worauf es hinaus will, nämlich darauf, dass man ja offensichtlich nicht von hier ist, wenn man eben Ferda heißt, oder aussieht, wie man aussieht, oder irgendwelche Merkmale hat, die nicht typisch deutsch sein können." Sie halte es für wichtig darüber zu reden, "dass wir so ein völkisches 'Wir' haben, und die Frage ist ja ein Symbol dafür."

Die Journalistin Ferda Ataman, Autorin des Buchs "Ich bin von hier. Hört auf zu fragen!"© imago / Jürgen Heinrich
Marvin Oppong, der in "Ewig anders. Schwarz, deutsch, Journalist" eigene Rassismuserfahrungen niedergeschrieben hat, bekräftigte das. "Ich glaube, wir sind bei der Integration erst richtig weit angekommen, wenn man eben auch anders aussehen kann und trotzdem als Deutscher durchgeht."
Gleichzeitig wies Dilek Güngör auf eine weitere Problematik hin. "Es soll jetzt nicht ein Gefühl entstehen, dass die Leute nicht mehr wissen, wie sie fragen sollen oder welche Worte sie verwenden sollen, weil es immer wieder neues Vokabular gibt, das jetzt nicht mehr gesagt werden darf, und jetzt heißt es mit oder ohne Migrationshintergrund oder bio-deutsch oder nicht." Auch wenn sich das Vokabular in einem ziemlich rasanten Tempo ändere, bleibe das Gefühl dabei oft gleich. "Und man darf mich auch mit dem falschen Vokabular fragen, wenn die Intention stimmt, dann sage ich auch nicht, 'Du, man sagt aber gar nicht mehr Gastarbeiter'. Wenn ich merke, da ist einfach nur Neugierde da, und da will jemand etwas wissen."

Jagoda Marinić spricht von "Sheroes", neuen Heldinnen, die Deutschland brauche.© imago images / ZUMA Press
Die "SZ"-Kolumnistin Jagoda Marinić, Autorin von "Sheroes. Neue Held*innen braucht das Land", ging dabei noch weiter. "Ich finde die Frage 'von hier' unglaublich wichtig. Ich habe eigentlich bemängelt, warum das in Deutschland nie eine Rolle gespielt hat, im Gegenteil. Also ich glaube, wir sind inzwischen ein Einwanderungsland." Und zu einem Einwanderungsland gehöre es, die eingewanderten Geschichten mit zu erzählen. "Wenn ich so tue, als gäbe es keine Differenzen, dann negiere ich ja auch die Vielfalt der Gesellschaft, in der wir leben."
Wobei Ferda Ataman noch einmal ihre persönliche Sicht schilderte. "Manchmal möchte ich einfach sagen können: 'Ich komme aus Nürnberg', und würde mich freuen, wenn mein Gegenüber sagt: 'Ah, okay'. Weil ich vielleicht heute gerade mal keine Lust habe, über meine Familiengeschichte zu reden."
Zudem hätte sie dazu häufig auch gar nicht die Chance. "Meistens werde ich dann zu Kopftuch, Erdogan oder was einem sonst an Klischees zur Türkei einfällt, gefragt. Ich kommen, ehrlich gesagt, gar nicht in diese wunderbare Gelegenheit und Verlegenheit, eine schöne Migrationsgeschichte zu erzählen, sondern ich werde da mit Stereotypen konfrontiert." Auch wenn solche Nachfragen in 99 Prozent der Fälle gut gemeint seien, wünsche sie sich, dass das abnehme. Es gehe in diesem Fall nicht darum, wie es gemeint sei, sondern wie es ankomme. "Wenn ein Taxifahrer 30 Mal am Tag gefragt wird, wo er herkommt, und er ist in Berlin geboren oder in Bielefeld oder Leipzig. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person sich hier zugehörig fühlt?", fragte Ataman.
Bindestrich-Identitäten als Teil des Diskurses
Marinić plädierte dafür, sich dieser Frage nicht auf persönliche Weise zu nähern. "Ich glaube, wir müssen so eine Frage auf einer politischen Ebene beantworten. Sind wir ein vielfältiges Land, oder nicht? Gehen wir mit der Vielfalt so um, dass wir sagen, wir bilden Bindestrich-Identitäten, und die Identitäten sind Teil des Diskurses Wir-müssen-viel-mehr-lernen-voneinander, oder sage ich, es gibt irgendeine Homogenität, und eigentlich einen Assimilationsprozess und erst dann habe ich eine gemeinsame Gesellschaft?"

Die Autorin Dilek Güngör erzählt in ihrem neuen Buch aus der Perspektive von Özlem.© Ingrid Hertfelder
Die Journalistin Dilek Güngör ermöglicht in "Ich bin Özlem" jedoch einen ganz genauen Einblick in das Innenleben ihrer Hauptfigur. Özlem vergesse als Teil ihres Freundeskreises in Berlin-Mitte tatsächlich teilweise ihre Herkunftsgeschichte. "Sie ist dann aber umso mehr erschrocken, als sie merkt, dass die anderen mit einem fremden Blick auf sie gucken", erklärte Güngör in der Diskussion. Und so sehe sie sich die Türkei verteidigen, die sie eigentlich gar nicht verteidigen wolle.
"Das ist sehr komplex", so Güngör weiter. "Das Gefühl von 'nicht genug sein, nicht wie die anderen sein'. Eine Scham hinzu, ich wäre gerne wie die und bin es nicht, und es gibt aber auch eine Scham hin, bei Özlem, zu denen, die man hinter sich gelassen hat, die man in seiner Karriere überholt hat, und ich glaube dieses Gefühl kennen ganz viele Leute." Für dieses Gefühl versuche sie ein Verständnis zu schaffen und es gehe ihr gar nicht so sehr um den politischen Blick darauf. Und es ist ein durchaus zwiespältiges Gefühl. "Özlem hat sich die Welt sehr schön aufgeteilt in deutsch und türkisch und sie begreift relativ spät im Leben, dass es noch vielfältiger ist, und dass man das nicht so sortieren kann und dass sie das aber auch sehr bequem sich selbst zugesteht, das so zu machen, aber bei anderen kritisiert."
Rassismuserfahrungen werden in Abrede gestellt
Marvin Oppong erzählte in Bezug auf eigene Rassismuserfahrungen von der Problematik, dass in Reaktion auf seine Beschwerden zum Beispiel über das Verhalten eines Kontrolleurs im öffentlichen Nahverkehr häufig standardisierte Antworten zurückkämen wie "Rassismus liegt uns fern".
"Das ist Teil dieses institutionalisierten Rassismus", sagte er. "Also man wird Rassismusopfer bei einer Behörde oder einem öffentlichen Unternehmen, beschwert sich dann, und dann wird die Rassismuserfahrung aber in Abrede gestellt. Und dann ist man im Prinzip das zweite Mal Opfer." Da müsse es mehr Sensibilität oder auch Schulungen geben.
Oppong meinte jedoch, es tue sich derzeit schon eine Menge in Deutschland. "Es gibt auch eine neue Generation, die mit Menschen aufgewachsen ist, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, die vielleicht auch eine andere Perspektive dadurch bekommen haben." Das werde auch immer weiter voranschreiten, ist er sich sicher. "Nur ich habe manchmal den Eindruck, dass es zwei Lager sind, es gibt die Leute, die sich für diese Fragen interessieren und auch etwas darüber wissen, und die, denen das völlig egal ist." Das sei sein persönlicher Eindruck. "Ich glaube, die Letzteren zu erreichen, das ist die Herausforderung."
Migration als Erfolgsgeschichte erzählen
Dass es bei der Debatte auch um die Art und Weise gehe, wie über Migranten gesprochen werde, darauf verwies Dilek Güngör am Ende der Diskussion. "Als mir zum ersten Mal jemand sagte, das ist auch eine Erfolgsgeschichte und wie friedlich das in Deutschland ist - das musste mir erst jemand sagen!" Es gehe darum, auch selber rauszukommen "aus diesem negativen Blick, oder aus diesem Blick auf das Defizit immer, weil es wird immer so betont, was nicht läuft, und dann sind wir hier so die, die es ganz toll gemacht haben. Das ist aber auch ein ekelhaftes Gefühl, dieses Hervorgehoben werden: 'Ihr seid besonders'."
(cwu)