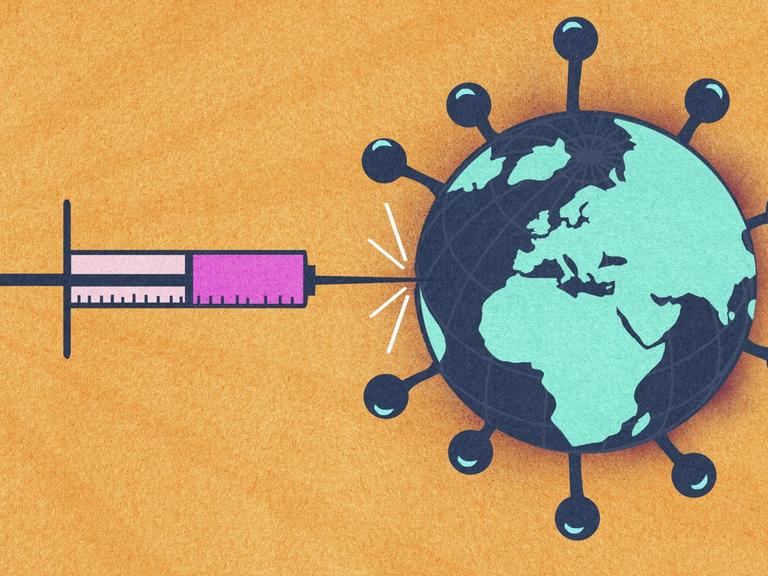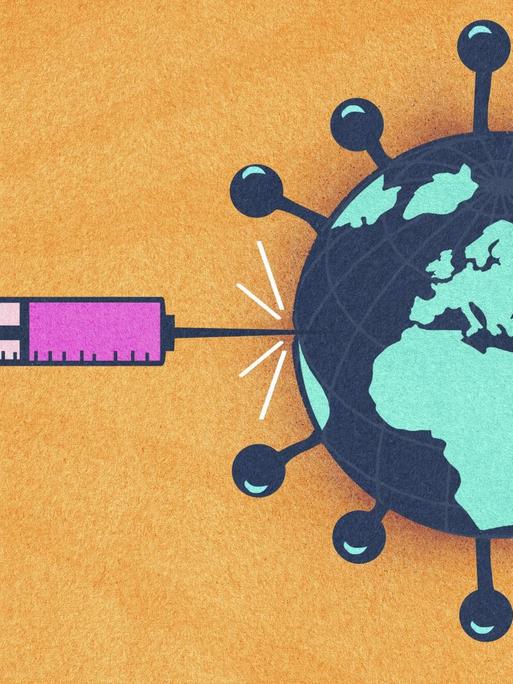Innovationsstandort Deutschland

Zusammen mit dem Pharmaunternehmen Pfizer gelang dem Mainzer Unternehmen BioNTech bahnbrechende Forschung und Entwicklung "made in Germany". Doch oft erreichen gute Ideen hierzulande nicht die Marktreife. © picture alliance / PIXSELL / Zeljko Lukunic
Keine Angst vor dem Risiko!
07:41 Minuten

Der Impfstoff von BioNTech war eine echte Innovation aus Deutschland. Dass deutsche Erfindungen nicht viel öfter international Furore machen, verhindert unter anderem ein schwerfälliges Fördersystem. Die Bundesagentur SPRIND will das ändern.
„Mehr Fortschritt wagen" ist das Motto der Ampelkoalition. Vom "Aufbruch in ein Innovationsjahrzehnt" spricht sogar die neue Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Das klingt gut, aber wie sieht das konkret aus? Firmen wie BioNTech haben vorgemacht, wie schnell Innovationen „made in Germany“ im Ernstfall und bei guter Förderung auf den Markt kommen und auch international Maßstäbe setzen können.
Das Mainzer Unternehmen lieferte nicht nur den ersten mRNA-Impstoff gegen Corona, sondern prescht auch in der Krebsmedizin voran. Damit so etwas in Zukunft häufiger passiert, wurde im Herbst 2019 die Bundesagentur für Sprunginnovation, kurz SPRIND, gegründet.
Keine Tradition der Risikoforschung
Die Agentur arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Vorbild ist die US-amerikanische Forschungsbehörde Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa). Sogenannte disruptive Forschung oder auch vielversprechende, aber risikoreiche Projekte mit noch ungewissem Ausgang sollen mit Hilfe von SPRIND angeschoben werden.
In Deutschland gab es bislang keine Tradition dafür. Dennoch: Rafal Laguna da la Vera, Direktor von SPRIND, gibt Deutschland auf einer Innovationsskala von null bis zehn die vollen zehn Punkte. „Wir sind sehr innovativ, wir erfinden tolle Sachen – wir bekommen sie nur häufig nicht auf die Straße", betont er.
Angaben bis auf den Bleistift genau
Tatsächlich hapert es Lagunas Beobachtung nach an der Umsetzung. Man müsse den Erfindenden „die Instrumente, die Mittel, die Freiheiten und die lange Leine“ geben, „um einfach mal zu machen und auch Risiken einzugehen“, sagt er.
Ein Hauptproblem ist für ihn das recht starre, behäbige und mitunter sehr bürokratische Projektfördersystem in Deutschland: „Man muss quasi beschreiben, welchen Bleistift man in vier Jahren kaufen wird.“

„Wir sind sehr innovativ, wir erfinden tolle Sachen – wir bekommen sie nur häufig nicht auf die Straße", sagt Rafael Laguna de la Vera.© SprinD GmbH
SPRIND will vieles anders machen und gibt vielversprechenden Projekten zunächst sechsstellige Summen für den Anschub. Das Geld dafür komme aus Steuereinnahmen, die „nicht leichtfertig, aber schnell auf den Tisch“ gelegt werden“, erläutert Laguna.
Bewähren sich die Ideen, wird weiter gefördert, inklusive unternehmerischem Beistand für die Gründungsphase.
Möglichst vielen guten Ideen eine Chance geben
Die Zahl der eingereichten guten Ideen zu Themen wie „Antivirale Wirkstoffe“ oder „Carbon to Value“ - die Herstellung von für die Umwelt unschädlichen Produkten aus Kohlenstoff – sei enorm, berichtet er. Auch deshalb habe die Förderung wettbewerbliche Strukturen, um möglichst vielen guten Projektanträgen eine erste Chance zu geben.
Laguna ist überzeugt: „Wir gehen mit dem Steuergeld dabei viel vorsichtiger um, als wenn wir eine lange Ausschreibung machen, dann nur ein Team auswählen und diesem für fünf Jahre das Geld hinlegen.“ Wenn man von vornherein nur Vorhaben fördere, bei denen ein Risiko ausgeschlossen sei, werde man keine Innovationen erzeugen.
(mkn)