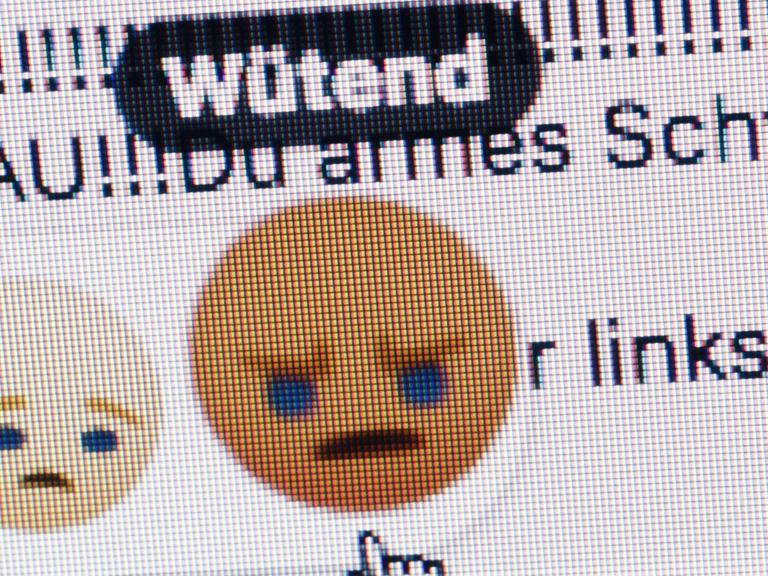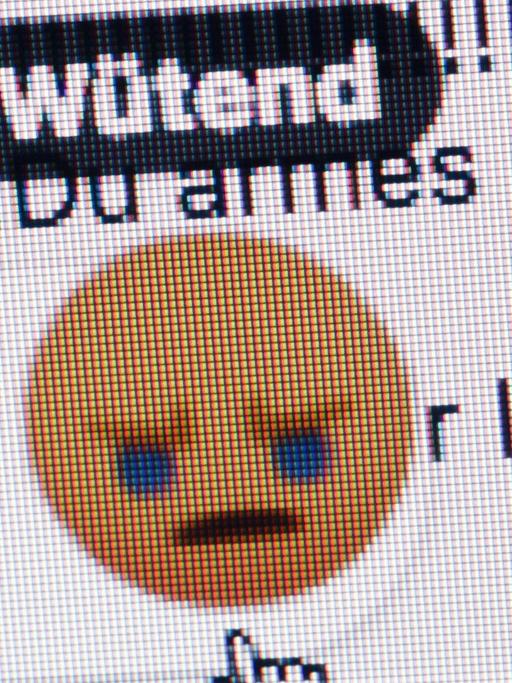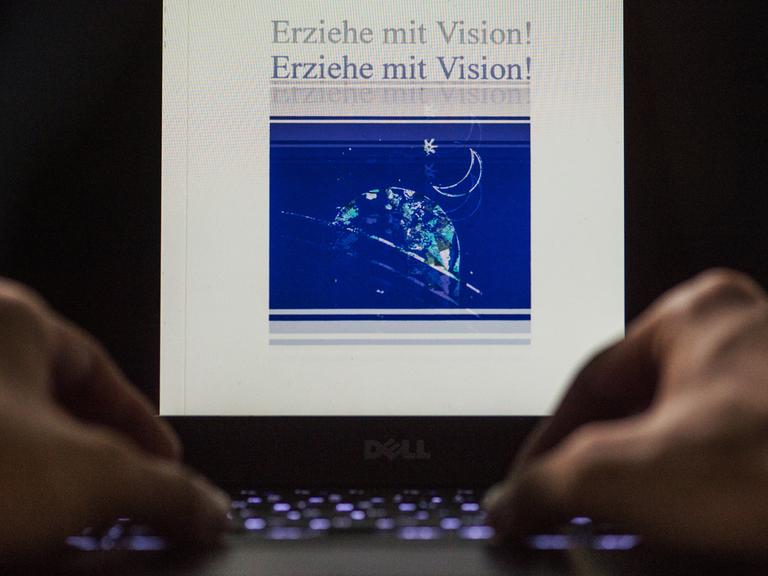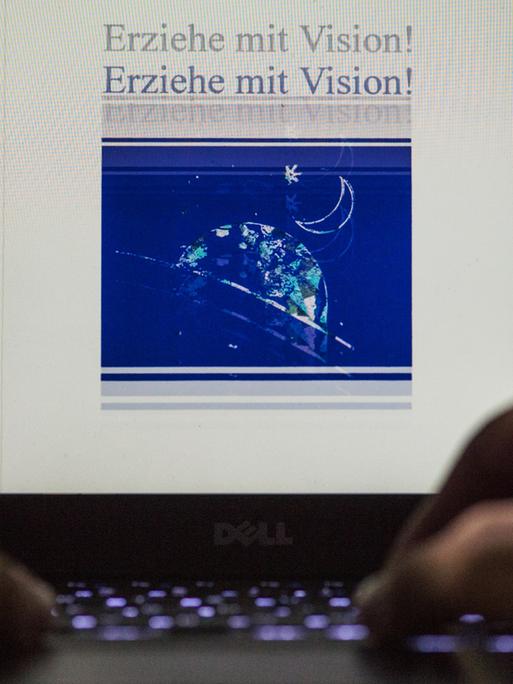Studie über Holocaust in den sozialen Medien

Stolperstein: Das Wissen über den Holocaust ist eine der Grundlagen der deutschen Demokratie. © picture alliance / photothek/ Janine Schmitz
"Man bekommt keinen repräsentativen Eindruck"
06:58 Minuten

Laut einer neuen Unesco-Studie sind gut 16 Prozent der Posts und Tweets über den Holocaust auf Social Media-Plattformen verleugnend oder verzerrend. Der Historiker Moritz Hoffmann findet die Studienergebnisse wenig überraschend.
Eine neue Studie, die die Unesco in Kooperation mit dem World Jewish Congress veröffentlicht hat, zeigt, dass die Leugnung oder Verzerrung von Fakten über den Holocaust in den sozialen Medien verbreitet ist. Demnach fallen insgesamt rund 16 Prozent der auf den einschlägigen Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter oder TikTok untersuchten Nachrichten unter diese Kategorie.
Viele Leugner bei Telegram
Auf Twitter beispielsweise leugnet jeder fünfte Post zum Thema den Massenmord an den Juden durch die Nationalsozialisten. Beim Messengerdienst Telegram fanden die Studienautoren sogar bei 49 Prozent der untersuchten Äußerungen den Holocaust leugnende oder verzerrende Inhalte.
Letzteres ist nicht überraschend, weil Telegram, anders als etwa Facebook, bei Kommentaren keine Klarnamen verlangt und Inhalte nicht moderiert oder kontrolliert.
Vorhersehbare Ergebnisse
Der auf innovative Formen der Geschichtsvermittlung spezialisierte Historiker Moritz Hoffmann findet die Studienergebnisse erwartbar und kritisiert die Untersuchung in einigen Punkten.
"Es wurde auch nach eindeutig den Holocaust leugnenden Begriffen gesucht", sagt er. "Und wenn man zum Beispiel so etwas wie ‚Holohoax‘ sucht – das ist einer der Begriffe, der in der der Studie beigefügten Excel-Tabelle auftauchte -, dann ist es natürlich vollkommen klar, dass man dort auch Holocaustleugnung findet.“ Auf diese Weise bekomme man keinen repräsentativen Eindruck, was über den Holocaust in den untersuchten Medien geschrieben werde.
Accounts mit nur zwei Followern
Auch sei die Stichprobe mit rund tausend Nachrichten, verteilt auf einige Medien, nicht sehr groß. Einige der in der Studie betrachteten, einschlägigen Twitteraccounts hätten zudem nur zwei oder drei Follower und damit kaum Bedeutung, so Hoffmann. „Das heißt, vermutlich haben nicht mehr als fünf oder zehn Menschen oder Bots auf der ganzen Welt diesen Tweet gesehen.“
Unabhängig davon sei aber „der Grundbefund der Studie klar und wichtig“. Grundsätzlich gut findet der Historiker auch, dass Plattformen wie Facebook oder TikTok Userinnen und User, die das Stichwort „Holocaust“ eingeben, an seriöse Websites wie About Holocaust weiterleiten.
Hoffmann hält nichts davon, das Internet als Informationsquelle pauschal als „schlecht“ abzuqualifizieren. Natürlich finde man im Netz "schreckliche Dinge". Aber auch früher, zu Vor-Internetzeiten, habe es bereits Holocaustleugner gegeben.
(mkn)