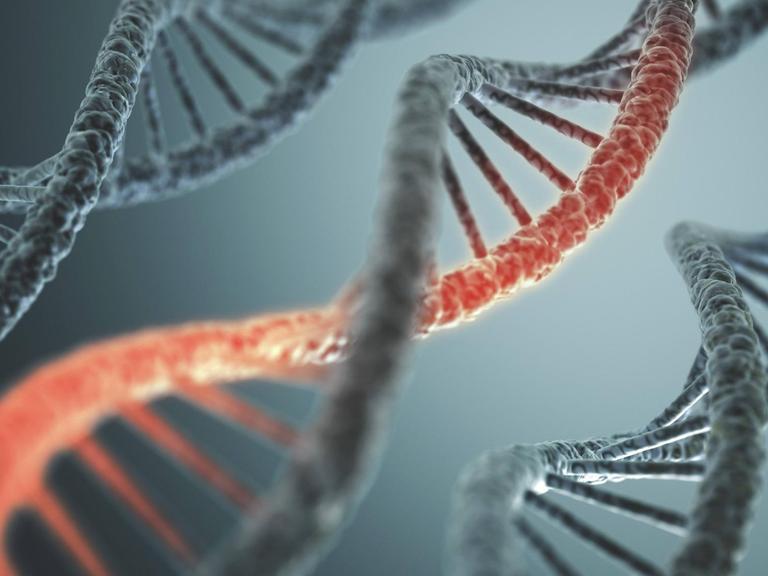Der lange Weg zur Heilung

Ein Enzym als Genschere: Hamburger Forscher versuchen, das HIV-Erbgut aus infizierten Zellen zu entfernen, statt wie bisher nur die Vermehrung des Virus zu unterdrücken. Sie glauben, auf diesem Weg Patienten von der Immunschwächekrankheit Aids heilen zu können.
Wer sich mit dem HI-Virus ansteckt, wird es nie mehr los. Denn der Erreger dringt in bestimmte Zellen des Immunsystems ein und fügen sein Erbgut in die DNA der Zelle ein. Teilt sich diese Zelle, vererbt sie auch das Virus an ihre Tochterzellen weiter. Außerdem bringt das Virus die Zellen dazu, neue Erreger herzustellen, die wiederum neue Immunzellen infizieren, sagt Professor Joachim Hauber vom Heinrich-Pette-Institut für experimentelle Virologie in Hamburg:
"Die bisherigen Ansätze versuchen, die Vermehrung von HIV zu unterdrücken. Unser Ansatz geht nun an die Wurzel des Übels. Wir versuchen wirklich wieder, den genetischen Bauplan von HIV, das HIV-Erbgut, aus der infizierten Zelle zu entfernen."
Dazu haben die Forscher eine Genschere entwickelt. Sie findet im Erbgut der Zelle charakteristische Stellen am Anfang und Ende des Viren-Genoms und schneidet es heraus. Long-Terminal-Repeat-Sequenzen heißen sie. Viele Mikroorganismen verwenden solche Enzyme – auch Rekombinasen genannt – sagt Professor Frank Buchholz von der Technischen Universität Dresden:
"Nun gibt es natürlich keine in der Natur vorkommenden Enzyme, die dann genau an dem Long-Terminal-Repeat-Sequenzen vom HIV-Genom schneiden und binden würden, und da haben wir genau angesetzt, und wir haben dann, so wie man sich das von einer Züchtung vorstellen kann, das Enzym dahingehend verändert über gerichtete Evolution, dass es dann genau die Sequenzen erkennt, die es in Long Terminal Repeats vom HIV-Genom gibt."
Die Genschere darf keine Fehler machen
Bei so einem Eingriff dürfen keine Fehler passieren, denn die Zelle soll schließlich ihre eigentlichen Aufgaben weiter erfüllen.
"Wir haben uns natürlich sehr viel Mühe fast zwei Jahre lang gegeben, sogenannte toxische und zytopathische Nebeneffekte zu untersuchen. Und dort haben wir das natürlich getestet und – ich sage es mal einfach: Nach allen Regeln der Kunst konnten keine Nebenwirkungen festgestellt werden."
Eine Schwierigkeit ist, die Genschere in die Wirtszellen zu bringen.
"Diese Rekombinase kann man leider nicht als Pille einfach einnehmen."
Die Wissenschaftler entnehmen Patienten solche Stammzellen, die im Knochenmark das Blut bilden. In deren DNA setzen die Forscher den genetischen Bauplan der Genschere ein. Sie pflanzen den Patienten die Stammzellen wieder ein, und die bilden dann Immunzellen, die das HI-Virus wieder entfernen, falls sie infiziert werden. Das Immunsystem, das ja bei HI-Infektionen langsam zusammenbricht, baut sich mit der Zeit wieder auf.
Die Genschere erkennt nicht alle Subtypen, aber immerhin mindestens 95 Prozent der wichtigen HI-Viren. In menschlichen Zellen in der Petrischale und in Versuchstieren hat die Methode bereits funktioniert.
"In beiden Systemen war nach einigen Wochen im Prinzip kein HIV mehr nachweisbar."
Jetzt muss sich die Methode in klinischen Tests an echten Patienten bewähren. Bis zu den ersten Tests kann jedoch noch zwei Jahre dauern. Und auch dann beginnen die Versuche mit ganz ausgewählten Kranken.
"Für allgemein HIV-Patienten besteht eine relativ gute Therapie im Moment, die kommen mit ihrer Infektion zurecht. Da möchte man nicht diese Patienten einer völlig neuartigen und eventuell risikobehafteten Gentherapie aussetzen. Man würde also HIV-Patienten nehmen, die zusätzlich an einer schwersten Erkrankung wie einer Tumorerkrankung leiden. Das wären die Patienten, die an einer ersten Studie teilnehmen."
Teuere Studien brauchen Investoren
Derartige Studien sind sehr teuer, sagt Joachim Hauber:
"Für eine erste kleine klinische Studie sprechen wir von einem Finanzbedarf von ungefähr 15 Millionen Euro. Das ist natürlich mehr als ein klinisches Forschungsinstitut, weit mehr oder auch ein Universitätsklinikum leisten kann, dafür benötigt man externe Investoren."
Zusammen mit den Geldgebern werden die Forscher eine Firma gründen. Sie betreibt die klinische Studie. Noch sind Frank Buchholz und Joachim Hauber auf der Suche nach Investoren.
"Da können wir nicht sehr wählerisch sein in unserer Situation, das beginnt mit Privatpersonen, das kann natürlich auch im Extremfall Venture Capital firmen sein, die sowas finanzieren. Oder strategische Investoren, also Pharmafirmen."
Im Idealfall bringen die Finanziers nicht nur Geld mit, sagt Frank Buchholz, der Molekularbiologe aus Dresden.
"Wir brauchen eine andere Expertise auch, das ist auch etwas, was wir uns erhoffen, das da reinzubringen, wir sind ja Grundlagenforscher. Wie man mit Krankenkassen spricht, die Rekrutierung der Patienten, all das sind Sachen, mit denen ich zumindest, keine Erfahrungen hatte, und solche Erfahrungen sind in solchen Unternehmungen dann auch sehr hilfreich und nützlich."
Die Forschungsinstitute können mitverdienen
Die Investoren ihrerseits hoffen natürlich darauf, dass die Methode funktioniert und sich irgendwann vermarkten lässt. Dann werden auch die Forschungsinstitute etwas davon haben, sagt Joachim Hauber.
"An jedem Forschungsinstitut, sollen auch im Auftrag der Zuwendungsgeber, also der Behörden, potenziell verwertbare Ergebnisse natürlich patentrechtlich geschützt werden, um sie zu kommerzialisieren, alles andere wäre eine Verschwendung von Steuergeldern. Patente hält in diesem Fall die TU Dresden und das Heinrich-Pette-Institut in Hamburg, und die Hoffnung ist natürlich schon, dass diese öffentlichen Forschungseinrichtungen auch irgendwann etwas damit verdienen, das dann wieder in die Forschung geht."
In letzter Zeit hatte es mehrfach Diskussionen in der Öffentlichkeit darüber gegeben, dass Firmen neue Techniken und neue Medikamente zu rigoros schützen oder viel zu teuer verkaufen. Hauber sieht darin ganz prinzipiell kein Problem.
"Das ist nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit schon immer gewesen, dass man eigentlich versucht, neue Ansätze zu schützen. Was dann später irgendwelche Firmen damit machen und ob bestimmte Preise für neue Therapien dann völlig überzogen sind, das kann man dann im Einzelfall diskutieren. Und da ist dann im Extremfall auch der Gesetzgeber gefordert."