Guido Westerwelles Kommunikationskunst
Guido Westerwelle hat mit seiner Forderung nach einer Reform des deutschen Sozialsystems erregte Debatten ausgelöst, die teilweise sogar ernsthaft sind. Offenbar hat er also einen Nerv getroffen.
Viele mögen Westerwelle nicht. Eine wichtige Minderheit ist für ihn. Er ist nicht der beliebteste, aber der gegenwärtig umstrittenste deutsche Politiker. Von einem solchen Erfolg können die meisten Politiker nur träumen. Erstaunlich ist die Aufregung dennoch.
Die Inhalte seiner Aussagen können diese Aufregung nicht verursacht haben. Die sind trivial. Dass es in den Sozialsystemen erhebliche Missbräuche gibt, bestreitet kaum jemand. Wer Berufsarbeit leistet, soll materiell besser gestellt sein als jemand, der nur von öffentlicher Unterstützung lebt. Auch dem stimmen fast alle zu. Wer vom Gemeinwesen unterstützt wird, sollte zu Gegenleistungen bereit sein. Die Kernaussagen Westerwelles sind nicht neu, nicht originell und nicht strittig.
Am angeblichen Anlass kann es auch nicht liegen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 macht dem hochverschuldeten deutschen Staat seine Aufgabe etwas schwerer; aber es erschütterte nicht die Grundlagen des Sozialsystems. Und was die finanzielle Situation Deutschlands angeht, ist Westerwelles FDP bekanntlich mehr als optimistisch. Sie will nicht sparen sondern stimulieren.
Aufschlussreicher ist offenbar der Satz: "Das wird man in diesem Lande doch noch sagen dürfen!" Auf eine solche Aussage hin erwarten die einen eine bislang unterdrückte Wahrheit; endlich kann man frei und wahrhaftig über etwas reden, das fast jedem am Herzen liegt. Die anderen erwarten eine Aussage rassistischen, volksverhetzenden oder blasphemischen Inhalts und reagieren darauf entsprechend.
Was aber wenn, wie in diesem Falle, gar kein Tabu gebrochen wird? Alles, was Westerwelle ausdrücklich sagte, wird ohnehin öffentlich diskutiert. Der angekündigte Tabubruch war also keiner, aber die Geste wirkte so. Warum aber zeigt der Redner emphatische Entschlossenheit? Warum schlägt er mit der Faust auf das Rednerpult und schiebt den Unterkiefer kraftvoll nach vorne? Das Pathos demonstrativer Entschlossenheit, verweist darauf, dass der aufregende Tabubruch in dem steckt, was nicht ausgesprochen wurde.
Die Äußerungen Westerwelles haben einen stillen Subtext. Westerwelle hat nicht gesagt, dass die Hartz-IV-Empfänger arbeitsscheue Schmarotzer sind, er hat nicht gesagt, die Hartz-IV-Sätze seien zu hoch und die Unterstützten wollten daher gar nicht arbeiten. Er hat die Unterschichten nicht als parasitäres Gesindel bezeichnet. Das wäre der Tabubruch gewesen, und auf ihn haben die Zuhörer positiv oder negativ reagiert. Die Aufregung betraf also nicht finanztechnische Fragen angesichts einer schrumpfenden Bevölkerung, einer sprunghaft ansteigenden Staatsverschuldung oder einer europäischen Währung, die auf den Zusammenbruch zusteuert. Die Empörung wurde von moralischen Urteilen ausgelöst, die an Stammtischen laut ausgesprochen werden.
Auf den Subtext reagierte das politische Spektrum von der Linkspartei über die Grünen und die SPD bis tief hinein in die CDU mit Empörung. Vielfach liefen die Empörten in die Argumentationsfalle, die ihnen gestellt worden war. Westerwelle hatte nicht ausgesprochen, wessen er beschuldigt wurde, und das konnte er in direkten Konfrontationen immer wieder mit jenem überlegenen Gestus betonen, den er so liebt.
Eine Illustration dafür liefert ein Bericht der "Bild"-Zeitung vom 23. Februar. Fünf empörte Hartz-IV-Empfänger hatte die Zeitung mit Westerwelle zusammengebracht. Alle aber ließen sich von den Argumenten des FDP-Chefs und von seinem Respekt für die Benachteiligten beeindrucken. Inhaltlich sagte er das, was er immer sagte – diesmal allerdings nicht wilhelminisch und aggressiv, sondern freundlich. Seine Gesprächspartner waren angetan.
Einem soliden Bürgertum sind Krawall und triumphale Posen eher fremd. Aber sicherlich gibt es Gruppen, die dergleichen mögen und gerade Westerwelles Subtext begrüßen. Zu ihnen gehören vor allem Selbstständige, die unter der Steuerlast, den staatlichen Regulierungen, dem flauen Markt und Arbeitnehmeransprüchen ächzen, die sich nach einem Land sehnen, in dem die Steuern niedrig, die unternehmerischen Entscheidungen frei und die Armen arm sind.
Zur Fangemeinde Westerwelles gehören mit Sicherheit auch jene alerten Absolventen von Management-Eliteschulen, die optimistisch in die eigene Zukunft schauen und in jene Positionen drängen, in denen sie Zugriff auf die Geldtöpfe haben. Sie schätzen die Werte, die Westerwelles FDP repräsentiert: Jugendlichkeit, Dreistigkeit und das Bewusstsein, dass die Marktwirtschaft für Menschen da ist, die gewitzt, hedonistisch und zupackend sind. Mitleid mit jenen, die sie für Versager halten, ist von ihnen nicht zu erwarten.
Es mag sein, dass Guido Westerwelle kein scharfsinniger Denker, kein gediegener Bürger und kein knorriger Staatsmann ist. Dass er das politische Theater besser beherrscht als viele seiner Gegner, lässt sich kaum bestreiten.
Erhard Stölting, Jahrgang 1942, Studium der Soziologie, Philosophie und Politikwissenschaft, u.a. Professor für Soziologie an der Freien Universität Berlin. Zurzeit Vertretung im Bereich Soziologie an der Universität Potsdam.
Die Inhalte seiner Aussagen können diese Aufregung nicht verursacht haben. Die sind trivial. Dass es in den Sozialsystemen erhebliche Missbräuche gibt, bestreitet kaum jemand. Wer Berufsarbeit leistet, soll materiell besser gestellt sein als jemand, der nur von öffentlicher Unterstützung lebt. Auch dem stimmen fast alle zu. Wer vom Gemeinwesen unterstützt wird, sollte zu Gegenleistungen bereit sein. Die Kernaussagen Westerwelles sind nicht neu, nicht originell und nicht strittig.
Am angeblichen Anlass kann es auch nicht liegen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 macht dem hochverschuldeten deutschen Staat seine Aufgabe etwas schwerer; aber es erschütterte nicht die Grundlagen des Sozialsystems. Und was die finanzielle Situation Deutschlands angeht, ist Westerwelles FDP bekanntlich mehr als optimistisch. Sie will nicht sparen sondern stimulieren.
Aufschlussreicher ist offenbar der Satz: "Das wird man in diesem Lande doch noch sagen dürfen!" Auf eine solche Aussage hin erwarten die einen eine bislang unterdrückte Wahrheit; endlich kann man frei und wahrhaftig über etwas reden, das fast jedem am Herzen liegt. Die anderen erwarten eine Aussage rassistischen, volksverhetzenden oder blasphemischen Inhalts und reagieren darauf entsprechend.
Was aber wenn, wie in diesem Falle, gar kein Tabu gebrochen wird? Alles, was Westerwelle ausdrücklich sagte, wird ohnehin öffentlich diskutiert. Der angekündigte Tabubruch war also keiner, aber die Geste wirkte so. Warum aber zeigt der Redner emphatische Entschlossenheit? Warum schlägt er mit der Faust auf das Rednerpult und schiebt den Unterkiefer kraftvoll nach vorne? Das Pathos demonstrativer Entschlossenheit, verweist darauf, dass der aufregende Tabubruch in dem steckt, was nicht ausgesprochen wurde.
Die Äußerungen Westerwelles haben einen stillen Subtext. Westerwelle hat nicht gesagt, dass die Hartz-IV-Empfänger arbeitsscheue Schmarotzer sind, er hat nicht gesagt, die Hartz-IV-Sätze seien zu hoch und die Unterstützten wollten daher gar nicht arbeiten. Er hat die Unterschichten nicht als parasitäres Gesindel bezeichnet. Das wäre der Tabubruch gewesen, und auf ihn haben die Zuhörer positiv oder negativ reagiert. Die Aufregung betraf also nicht finanztechnische Fragen angesichts einer schrumpfenden Bevölkerung, einer sprunghaft ansteigenden Staatsverschuldung oder einer europäischen Währung, die auf den Zusammenbruch zusteuert. Die Empörung wurde von moralischen Urteilen ausgelöst, die an Stammtischen laut ausgesprochen werden.
Auf den Subtext reagierte das politische Spektrum von der Linkspartei über die Grünen und die SPD bis tief hinein in die CDU mit Empörung. Vielfach liefen die Empörten in die Argumentationsfalle, die ihnen gestellt worden war. Westerwelle hatte nicht ausgesprochen, wessen er beschuldigt wurde, und das konnte er in direkten Konfrontationen immer wieder mit jenem überlegenen Gestus betonen, den er so liebt.
Eine Illustration dafür liefert ein Bericht der "Bild"-Zeitung vom 23. Februar. Fünf empörte Hartz-IV-Empfänger hatte die Zeitung mit Westerwelle zusammengebracht. Alle aber ließen sich von den Argumenten des FDP-Chefs und von seinem Respekt für die Benachteiligten beeindrucken. Inhaltlich sagte er das, was er immer sagte – diesmal allerdings nicht wilhelminisch und aggressiv, sondern freundlich. Seine Gesprächspartner waren angetan.
Einem soliden Bürgertum sind Krawall und triumphale Posen eher fremd. Aber sicherlich gibt es Gruppen, die dergleichen mögen und gerade Westerwelles Subtext begrüßen. Zu ihnen gehören vor allem Selbstständige, die unter der Steuerlast, den staatlichen Regulierungen, dem flauen Markt und Arbeitnehmeransprüchen ächzen, die sich nach einem Land sehnen, in dem die Steuern niedrig, die unternehmerischen Entscheidungen frei und die Armen arm sind.
Zur Fangemeinde Westerwelles gehören mit Sicherheit auch jene alerten Absolventen von Management-Eliteschulen, die optimistisch in die eigene Zukunft schauen und in jene Positionen drängen, in denen sie Zugriff auf die Geldtöpfe haben. Sie schätzen die Werte, die Westerwelles FDP repräsentiert: Jugendlichkeit, Dreistigkeit und das Bewusstsein, dass die Marktwirtschaft für Menschen da ist, die gewitzt, hedonistisch und zupackend sind. Mitleid mit jenen, die sie für Versager halten, ist von ihnen nicht zu erwarten.
Es mag sein, dass Guido Westerwelle kein scharfsinniger Denker, kein gediegener Bürger und kein knorriger Staatsmann ist. Dass er das politische Theater besser beherrscht als viele seiner Gegner, lässt sich kaum bestreiten.
Erhard Stölting, Jahrgang 1942, Studium der Soziologie, Philosophie und Politikwissenschaft, u.a. Professor für Soziologie an der Freien Universität Berlin. Zurzeit Vertretung im Bereich Soziologie an der Universität Potsdam.
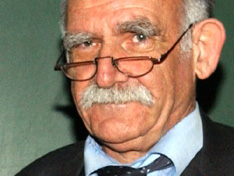
Erhard Stölting, Soziologe an der Universität Potsdam.© Privat