Geständnis eines Ruhelosen
Das Buch "Von Heimat zu Heimat" von Peter Glotz ist das Geständnis eines Ruhelosen, der nach dem Verlust der alten Heimat keine neue fand, sondern ständig unterwegs war. Als er endlich den Altersruhesitz im Halbkanton Appenzell bezog, blieben ihm nur noch wenige Monate bis zum Tod. Peter Glotz wusste von seiner Krebserkrankung und schrieb an gegen die Zeit - enttäuscht über das Leben, enttäuscht wohl auch über sein Leben.
Ein furioses Buch, aber auch ein bitteres Buch. Das Geständnis eines Ruhelosen, der - im Gegensatz zu dem, was der Titel suggeriert - nach dem Verlust der alten Heimat keine neue fand, sondern ständig unterwegs war: von Böhmen nach Bayern, von Bayreuth nach Hannover, von Hannover nach Wien, nach München, Bonn, Berlin, Erfurt und schließlich in die Schweiz. Als endlich der Altersruhesitz im Halbkanton Appenzell bezogen werden konnte, blieben ihm nur noch wenige Monate bis zum Tod. Peter Glotz wusste von seiner Krebserkrankung und schrieb an gegen die Zeit - enttäuscht über das Leben, enttäuscht wohl auch über sein Leben.
"Wir dürfen nicht zu streng sein, "das Menschenleben zwängt sich durch die Tage", wie einer meiner Seelentröster bemerkt hat, man brezelt sich auf, schlägt ein Rad, erobert eine Frau, einen Mann, eine Position, mehrere Positionen, es zeigt nach oben, aber dann Karzinom, Chemotherapie, Bangen, Warten, Hoffnung, und irgendwann ist es aus."
Vor allem handelt das Buch über das Verhältnis von Peter Glotz zur SPD - "seiner" Partei, die ihn erst förderte und dann fallen ließ. Die ihn aufsteigen ließ bis zum Bundesgeschäftsführer und dann zur Existenz eines durchschnittlichen Bundestagsabgeordneten degradierte. "Der Spitzenpolitiker", notierte Glotz nicht ohne Sarkasmus, "mutierte zum Hinterbänkler". Das war 1987. Erst neun Jahre später warf er das Handtuch in der Politik und wandte sich der Wissenschaft zu.
"Was kommt zum Vorschein, wenn ich versuche, mich an die Gründe zu erinnern, die mich zur Sozialdemokratie brachten? Schon die Idee, die Leute besser zu stellen… Wenn einer sagte: Es soll aufwärts gehen, wusste jeder, was gemeint war. .. Am meisten aber empörte mich das Klassensystem der Bildung, in dem die Arztsöhne Ärzte und die Anwaltssöhne Anwälte wurden, die Arbeiterkinder aber unten, am Boden der Gesellschaft festgehalten wurden… Wer unten im Bodensatz steckt, kommt nicht hoch, und wer oben in der Rahmschicht schwimmt, sinkt nicht tief."
Die SPD versprach aber noch eines: Dem Flüchtling Peter Glotz, der nicht nur die böhmische Heimat, sondern als junger Erwachsener schnell hintereinander den Vater, die Großmutter und die vier Jahre jüngere Schwester verloren hatte, bot sie ein neues Zuhause: Er gehörte wieder dazu, gewann sogar eine "Familie", die sich über das ganze Bundesgebiet erstreckte. Die Partei hat ihm mehr bedeutet als alles andere im Leben - mehr als Familie, Freunde, von Freizeit gar nicht zu reden. Und seit dem Eintritt in die SPD war klar:
"Es galt hochzukommen. … und (ich) war wild entschlossen, so schnell wie möglich den untergeordneten Rollen zu entkommen… Die Macht war mir kein Brechreiz, und ich habe mich nie nach Einödhöfen im Herbst gesehnt."
So unterwarf sich "der überschlaue Flüchtling" den Initiationsriten der Organisation, "biss" sich durch Diskussionen in verrauchten Hinterzimmern, verteilte Zettel an der S-Bahn, stand morgens um sechs am Werkstor. Anders ließen sich seine "Aufstiegsgelüste" nicht realisieren - seine Wünsche nach Anerkennung, Einfluss, Macht, nach Delegiertenmandaten, Maßanzügen und Essen in Nobellokalen. "Wir Kriegs- und Flüchtlingskinder werden mit allem fertig", schreibt Peter Glotz zwar. Aber weil er zu kurz gekommen war und vor den Einheimischen bestehen wollte, hatte er viel nachzuholen und der Umwelt zu demonstrieren, dass er mithalten konnte.
Und Peter Glotz hat mitgehalten. Auf seine - grenzgängerische - Weise. Er rieb sich leidenschaftlich an den 68-ern, die er teils als ideologisch Verblendete, teils als Kriminelle bekämpfte, etwa als er Anfang 1969 ein besetztes Institut in München von der Polizei räumen ließ; er stritt mehr mit den eigenen Genossen vom Typ des "Predigers" Ehrhard Eppler als mit christdemokratischen Widersachern wie Kurt Biedenkopf oder Lothar Späth; und er plädierte - als Aufklärer aus Überzeugung - für einen Dialog zwischen verschiedenen Lebenswelten in der Sozialdemokratie und für einen Dialog über alle Parteigrenzen hinweg. So entstand sein Ruf, der ihn sein ganzes Leben begleiten sollte:
"Die Linken erkannten mich als "intelligenten" Rechten, die Rechten aber betrachteten mich kopfschüttelnd als Paradiesvogel und hatten kein Vertrauen zu mir."
Seine große Zeit war die als Bundesgeschäftsführer der SPD von 1981 bis 1987. Er hatte Macht und ging mit den Mächtigen um: dem zeitlebens bewunderten, charismatischen Willy Brandt, dem "eisgrauen" ehemaligen Ostemigranten Herbert Wehner und mit Helmut Schmidt, dem "befehlsgewohnten Hamburger", der "hochmütig, kalt und aggressiv werden konnte", wenn ihm jemand widersprach. Dieser Troika zollte Glotz trotz vieler Vorbehalte Respekt bis zum Schluss. Mit den "Enkeln" hingegen, die an die Macht kamen, als er sich bereits von ihr verabschiedet hatte, ging er hart ins Gericht.
"In der entscheidenden Frage hat die Regierung versagt. Die magische Zahl heißt: fünf Millionen. Fünf Millionen Arbeitslose. … Schröder, Scharping und Lafontaine, die angeblichen Achtundsechziger der SPD, waren kooperationsunfähig. Auch die "Troika" der Vergangenheit hat sich nicht geliebt, vielleicht sogar gehasst. Sie hielt ihren Widerwillen aber lange aus. Die Partei war ihnen ein lebendiger Organismus, ein Verband zur Veränderung der Gesellschaft. Den Enkeln war sie ein Spielfeld für persönliche Macht."
Als Peter Glotz sich 1996 aus der Politik zurückzog, war er längst kein Vorwärtsstürmender nach neuen Ufern mehr. In fast allen großen Fragen der 80er und 90er Jahre hat er geirrt oder wurde von der Geschichte überrollt. Die Widerstandsbewegungen in Mitteleuropa - einschließlich Polens - hielt er selbst nach dem Zusammenbruch des Kommunismus weiter für unbedeutend. Mit der Mehrheit seiner Fraktion und eins mit Oskar Lafontaine zog er gegen die Wiedervereinigung Deutschlands zu Felde, wehrte sich gegen die neue Hauptstadt Berlin und kritisierte die Osterweiterung der Europäischen Union.
"Ich war in allen Fasern ein Politiker der Bonner Republik… Ich wollte keine 'Berliner Republik'."
Allem Patriotischen gegenüber empfand er Abneigung, wenn nicht Abscheu. Das bleibt schwer zu verstehen bei einem Flüchtling, der - auch wenn seine Mutter (wie er schrieb) eine "verdeutschte Tschechin" war - doch wusste, dass Heimatverlust auch immer Trauer um die Patria ist. Hat er sich nicht sogar leidenschaftlich und wieder einmal zwischen allen Stühlen für ein Zentrum gegen Vertreibungen eingesetzt, um dieser Trauer endlich öffentlich Ausdruck zu verleihen? Wir werden ihn zu widersprüchlichen Reaktionen schon nicht mehr befragen können. Manches wollte er, der Intellektuelle und Aufklärer, offensichtlich selbst gar nicht so genau wissen.
"Man könnte sich fragen: Wozu all die Bücher, Artikel, Interviews, Vorträge, Reden, Ämter? Wie vielen Leuten hat man wirklich geholfen, wie viele hat man angeregt, wie viele wenigstens amüsiert? Solche Kinderfragen habe ich mir im vollen Lauf nie gestellt. Jetzt fange ich damit nicht mehr an. Besser eine "vita activa" als ein ergebnisloses Schürfen nach dem Sein!"
Die so genannten letzten Fragen hielt er sich genauso vom Leib wie alles "Gefühlvolle". Dabei sind gerade jene Szenen des Buches am bewegendsten, in denen seine Verletzlichkeit erkennbar wird – wie beim Tod der Mutter, seiner "Ditalein", die es nicht schaffte, sich angesichts ihrer Krebserkrankung mit Schlaftabletten umzubringen.
"Zur Beerdigung kamen neun Menschen. Das ist so, wenn Flüchtlinge alt sterben. Die Zeitgenossen sind tot, die Gräber teils – teils. Teils in München, teils in Prag."
Sein obligatorisches "So ist das eben" rettete ihn immer wieder in die klaglose, scheinbare Abgeklärtheit. Enttäuschung, Trauer und Einsamkeit überspielte er in der Regel mit Arroganz und Zynismus. Und so trug er den Groll über die Ungerechtigkeit des Lebens in sich bis zum bitteren Ende.
Ein furioses Buch, aber auch ein trauriges Buch.
Peter Glotz: Von Heimat zu Heimat
Econ Verlag, Berlin 2005.
"Wir dürfen nicht zu streng sein, "das Menschenleben zwängt sich durch die Tage", wie einer meiner Seelentröster bemerkt hat, man brezelt sich auf, schlägt ein Rad, erobert eine Frau, einen Mann, eine Position, mehrere Positionen, es zeigt nach oben, aber dann Karzinom, Chemotherapie, Bangen, Warten, Hoffnung, und irgendwann ist es aus."
Vor allem handelt das Buch über das Verhältnis von Peter Glotz zur SPD - "seiner" Partei, die ihn erst förderte und dann fallen ließ. Die ihn aufsteigen ließ bis zum Bundesgeschäftsführer und dann zur Existenz eines durchschnittlichen Bundestagsabgeordneten degradierte. "Der Spitzenpolitiker", notierte Glotz nicht ohne Sarkasmus, "mutierte zum Hinterbänkler". Das war 1987. Erst neun Jahre später warf er das Handtuch in der Politik und wandte sich der Wissenschaft zu.
"Was kommt zum Vorschein, wenn ich versuche, mich an die Gründe zu erinnern, die mich zur Sozialdemokratie brachten? Schon die Idee, die Leute besser zu stellen… Wenn einer sagte: Es soll aufwärts gehen, wusste jeder, was gemeint war. .. Am meisten aber empörte mich das Klassensystem der Bildung, in dem die Arztsöhne Ärzte und die Anwaltssöhne Anwälte wurden, die Arbeiterkinder aber unten, am Boden der Gesellschaft festgehalten wurden… Wer unten im Bodensatz steckt, kommt nicht hoch, und wer oben in der Rahmschicht schwimmt, sinkt nicht tief."
Die SPD versprach aber noch eines: Dem Flüchtling Peter Glotz, der nicht nur die böhmische Heimat, sondern als junger Erwachsener schnell hintereinander den Vater, die Großmutter und die vier Jahre jüngere Schwester verloren hatte, bot sie ein neues Zuhause: Er gehörte wieder dazu, gewann sogar eine "Familie", die sich über das ganze Bundesgebiet erstreckte. Die Partei hat ihm mehr bedeutet als alles andere im Leben - mehr als Familie, Freunde, von Freizeit gar nicht zu reden. Und seit dem Eintritt in die SPD war klar:
"Es galt hochzukommen. … und (ich) war wild entschlossen, so schnell wie möglich den untergeordneten Rollen zu entkommen… Die Macht war mir kein Brechreiz, und ich habe mich nie nach Einödhöfen im Herbst gesehnt."
So unterwarf sich "der überschlaue Flüchtling" den Initiationsriten der Organisation, "biss" sich durch Diskussionen in verrauchten Hinterzimmern, verteilte Zettel an der S-Bahn, stand morgens um sechs am Werkstor. Anders ließen sich seine "Aufstiegsgelüste" nicht realisieren - seine Wünsche nach Anerkennung, Einfluss, Macht, nach Delegiertenmandaten, Maßanzügen und Essen in Nobellokalen. "Wir Kriegs- und Flüchtlingskinder werden mit allem fertig", schreibt Peter Glotz zwar. Aber weil er zu kurz gekommen war und vor den Einheimischen bestehen wollte, hatte er viel nachzuholen und der Umwelt zu demonstrieren, dass er mithalten konnte.
Und Peter Glotz hat mitgehalten. Auf seine - grenzgängerische - Weise. Er rieb sich leidenschaftlich an den 68-ern, die er teils als ideologisch Verblendete, teils als Kriminelle bekämpfte, etwa als er Anfang 1969 ein besetztes Institut in München von der Polizei räumen ließ; er stritt mehr mit den eigenen Genossen vom Typ des "Predigers" Ehrhard Eppler als mit christdemokratischen Widersachern wie Kurt Biedenkopf oder Lothar Späth; und er plädierte - als Aufklärer aus Überzeugung - für einen Dialog zwischen verschiedenen Lebenswelten in der Sozialdemokratie und für einen Dialog über alle Parteigrenzen hinweg. So entstand sein Ruf, der ihn sein ganzes Leben begleiten sollte:
"Die Linken erkannten mich als "intelligenten" Rechten, die Rechten aber betrachteten mich kopfschüttelnd als Paradiesvogel und hatten kein Vertrauen zu mir."
Seine große Zeit war die als Bundesgeschäftsführer der SPD von 1981 bis 1987. Er hatte Macht und ging mit den Mächtigen um: dem zeitlebens bewunderten, charismatischen Willy Brandt, dem "eisgrauen" ehemaligen Ostemigranten Herbert Wehner und mit Helmut Schmidt, dem "befehlsgewohnten Hamburger", der "hochmütig, kalt und aggressiv werden konnte", wenn ihm jemand widersprach. Dieser Troika zollte Glotz trotz vieler Vorbehalte Respekt bis zum Schluss. Mit den "Enkeln" hingegen, die an die Macht kamen, als er sich bereits von ihr verabschiedet hatte, ging er hart ins Gericht.
"In der entscheidenden Frage hat die Regierung versagt. Die magische Zahl heißt: fünf Millionen. Fünf Millionen Arbeitslose. … Schröder, Scharping und Lafontaine, die angeblichen Achtundsechziger der SPD, waren kooperationsunfähig. Auch die "Troika" der Vergangenheit hat sich nicht geliebt, vielleicht sogar gehasst. Sie hielt ihren Widerwillen aber lange aus. Die Partei war ihnen ein lebendiger Organismus, ein Verband zur Veränderung der Gesellschaft. Den Enkeln war sie ein Spielfeld für persönliche Macht."
Als Peter Glotz sich 1996 aus der Politik zurückzog, war er längst kein Vorwärtsstürmender nach neuen Ufern mehr. In fast allen großen Fragen der 80er und 90er Jahre hat er geirrt oder wurde von der Geschichte überrollt. Die Widerstandsbewegungen in Mitteleuropa - einschließlich Polens - hielt er selbst nach dem Zusammenbruch des Kommunismus weiter für unbedeutend. Mit der Mehrheit seiner Fraktion und eins mit Oskar Lafontaine zog er gegen die Wiedervereinigung Deutschlands zu Felde, wehrte sich gegen die neue Hauptstadt Berlin und kritisierte die Osterweiterung der Europäischen Union.
"Ich war in allen Fasern ein Politiker der Bonner Republik… Ich wollte keine 'Berliner Republik'."
Allem Patriotischen gegenüber empfand er Abneigung, wenn nicht Abscheu. Das bleibt schwer zu verstehen bei einem Flüchtling, der - auch wenn seine Mutter (wie er schrieb) eine "verdeutschte Tschechin" war - doch wusste, dass Heimatverlust auch immer Trauer um die Patria ist. Hat er sich nicht sogar leidenschaftlich und wieder einmal zwischen allen Stühlen für ein Zentrum gegen Vertreibungen eingesetzt, um dieser Trauer endlich öffentlich Ausdruck zu verleihen? Wir werden ihn zu widersprüchlichen Reaktionen schon nicht mehr befragen können. Manches wollte er, der Intellektuelle und Aufklärer, offensichtlich selbst gar nicht so genau wissen.
"Man könnte sich fragen: Wozu all die Bücher, Artikel, Interviews, Vorträge, Reden, Ämter? Wie vielen Leuten hat man wirklich geholfen, wie viele hat man angeregt, wie viele wenigstens amüsiert? Solche Kinderfragen habe ich mir im vollen Lauf nie gestellt. Jetzt fange ich damit nicht mehr an. Besser eine "vita activa" als ein ergebnisloses Schürfen nach dem Sein!"
Die so genannten letzten Fragen hielt er sich genauso vom Leib wie alles "Gefühlvolle". Dabei sind gerade jene Szenen des Buches am bewegendsten, in denen seine Verletzlichkeit erkennbar wird – wie beim Tod der Mutter, seiner "Ditalein", die es nicht schaffte, sich angesichts ihrer Krebserkrankung mit Schlaftabletten umzubringen.
"Zur Beerdigung kamen neun Menschen. Das ist so, wenn Flüchtlinge alt sterben. Die Zeitgenossen sind tot, die Gräber teils – teils. Teils in München, teils in Prag."
Sein obligatorisches "So ist das eben" rettete ihn immer wieder in die klaglose, scheinbare Abgeklärtheit. Enttäuschung, Trauer und Einsamkeit überspielte er in der Regel mit Arroganz und Zynismus. Und so trug er den Groll über die Ungerechtigkeit des Lebens in sich bis zum bitteren Ende.
Ein furioses Buch, aber auch ein trauriges Buch.
Peter Glotz: Von Heimat zu Heimat
Econ Verlag, Berlin 2005.
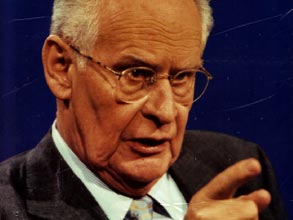
Peter Glotz: Von Heimat zu Heimat© Econ Verlag