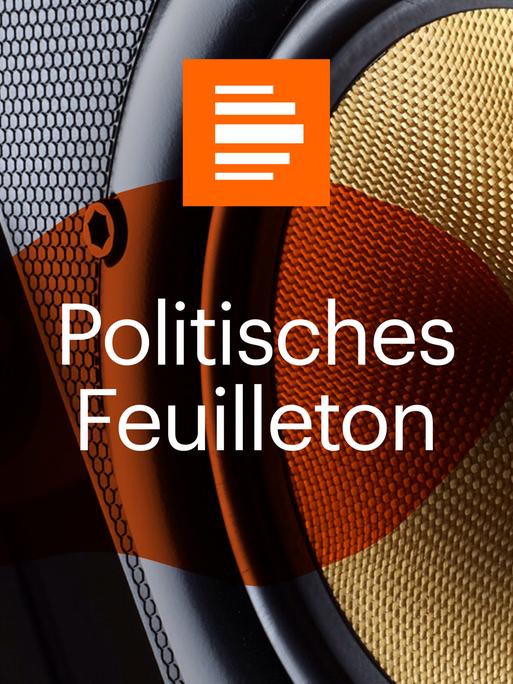Märkte kann man nicht hassen

Ressentiment bedeutet so viel wie "heimlicher Groll". Warum die Europäer solche Gefühle und sogar Hass wieder empfinden, analysiert der Soziologe Rainer Paris - und ruft dazu auf, auch mal nach eigenen Fehlern zu fragen.
Eine der bedenklichsten Entwicklungen der letzten Zeit ist es, dass aggressive Grundströmungen deutlich zunehmen und sich verfestigen, ja dass Hass und Ressentiment in Europa wieder auftauchen, wie es noch vor wenigen Jahren undenkbar schien.
Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise haben zu mentalen Brüchen geführt, die das politische Klima und den Prozess der europäischen Einigung auf Jahre belasten werden.
Wie ist es dazu gekommen? Ein Grundgesetz des Sozialen lautet: Leid sucht Schuld. Wo immer Menschen unter Verhältnissen leiden, wo sie Angst vor sozialem Abstieg haben oder tatsächlich in Not und Elend geraten, suchen sie Schuldige, die sie dafür verantwortlich machen können.
Politiker als Sündenböcke
Nicht Ursachen, sondern Verursacher müssen gefunden werden, denen man die Misere anlasten und die man dafür an den Pranger stellen kann. Ohne handliche Schuldige hängen Protest und Entrüstung in der Luft.
Gleichzeitig ist man selbst aus dem Schneider. Schuld sind immer die anderen, am besten jene, die ohnehin moralisch verkommen sind und denen man von jeher misstraut hat. Märkte kann man nicht hassen. Wohl aber Politiker oder Gruppen, die man als "politische Klasse" verunglimpft. Und wenn es nicht nur die eigenen, sondern sogar fremde Politiker, also Repräsentanten anderer Nationen sind, die man als Sündenböcke dingfest und für alles verantwortlich machen kann, so ist diese Mechanik kaum zu stoppen.
Hinzu kommen die Entwertung gewohnter Orientierungen und Erfahrungen von Entfremdung, die die Kultur des Umgangs schleichend verändern. Was anfangs nur Unmut bereitet und zähneknirschend akzeptiert wird, verdichtet sich irgendwann zu konstanten Gefühlshaltungen von Hass und Ressentiment, die von nun an geeignete Ventile suchen.
Hass braucht ein eindeutiges Gegenüber zum Abreagieren
Anders als der Neid, der die Menschen isoliert und auseinandertreibt, vermag der Hass, sie zu vergemeinschaften und aus ihnen kollektive Akteure zu formen.
Im Übrigen kann auch Hass manchmal gute Gründe haben. Das Problem ist, dass er, hat er sich einmal festgesetzt, häufig gute und schlechte Gründe miteinander verschweißt und sie fortan nicht mehr auseinanderhalten kann. Vor allem aber braucht er stets ein eindeutig identifizierbares, klar konturiertes Gegenüber, also konkrete Personen oder Gruppierungen, auf die er all seine Aggressionen richten und an denen er sich abreagieren kann.
Märkte und Handelsverflechtungen zwischen Staaten sind dazu im Grunde ungeeignet. Dafür sind Ursachen und Akteure zu unübersichtlich und komplex, finden einfache Affekte kaum Ansatzpunkte und Raum.
Erst der Vorrang der Politik und die Verkoppelung der Ängste und des Abstiegs mit politischen Entscheidungen erlauben die emotionale Polarisierung und geben den Akteuren die Möglichkeit, sich in ständigen Kreisgesprächen zu bestätigen, ihre Vorurteile zu kompakten Ideologien auszubauen und den aggressiven Impulsen freien Lauf zu lassen.
Eigene Ansprüche überprüfen
Das Ressentiment gegen andere ist häufig nur eine Methode, sich nicht an die eigene Nase zu fassen. Wo simple Schuldverlagerung nach außen versperrt ist, kommt man letztlich nicht umhin, seine Ansprüche zu überprüfen und vor allem nach eigenen Fehlern und Auswegen zu fragen.
Anstatt die Lösung der Probleme stets nur von anderen zu erwarten, geraten auf diese Weise die eigenen Möglichkeiten und Freiheiten in den Blick – und eröffnen damit zugleich die Chance für ein Handeln, an dem sich neues Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufrichten könnten.
Rainer Paris, geboren 1948 in Oldenburg, lehrte bis 2013 als Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Seine Schwerpunkte sind Mikrosoziologie, Macht- und Organisationsforschung. Zuletzt ist erschienen "Neid. Von der Macht eines versteckten Gefühls" (2010).
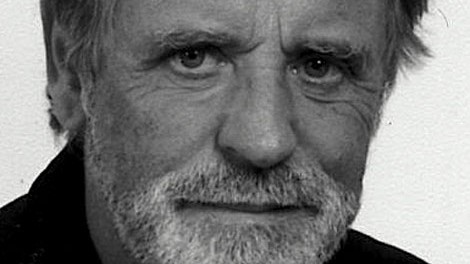
Der Soziologe Rainer Paris© privat