Geschichtsschreibung mit identitätsstiftender Funktion
Die von Pierre Nora herausgegebene Essaysammlung „Lieux de Mémoire“ zur französischen Geschichte liegt nun in einer deutschen Edition vor. Allerdings wurden hier von insgesamt 133 Essays nur 15 ausgewählt. Ein intellektuelles Vergnügen bereitet dabei der methodische Ansatz, die Historisierung bestimmter Themen als identitätsstiftende Funktion zu untersuchen.
Nach den dreibändigen „Deutschen Erinnerungsorten“ hat der Verlag C.H. Beck jetzt den lobenswerten Einfall gehabt, eine Auswahl aus dem insgesamt sieben stattliche Bände umfassenden und viel gerühmten Vorbild der „Lieux de Mémoire“ in deutscher Übersetzung vorzulegen. Diese „Französischen Erinnerungsorte“, an der die Creme der französischen Historiker beteiligt war und die zwischen 1984 und 1992 unter der Herausgeberschaft von Pierre Nora erschienen, sind ein viel bewunderter und seither auch häufig nachgeahmter neuer und viel versprechender Ansatz der Geschichtsschreibung.
Es handelt sich dabei um den rundum geglückten Versuch, sich von der traditionellen und nur jeweils anders kostümierten historistischen Geschichtserzählung zu befreien, die jeweils zeigen wollte, „wie es eigentlich gewesen“ und die dabei von der Einsicht zehrte, dass Vergangenheit, insofern sie Objekt der Geschichtsschreibung ist, seit je ein Geschehen meint, das in seinen Abläufen fixiert ist, das jedoch stets neu gedeutet wird, wie Goethe in den „Materialien zur Geschichte der Farbenlehre“ bereits feststellte:
„Dass die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschrieben werden müsse, darüber ist in unseren Tagen wohl kein Zweifel übrig geblieben. Eine solche Notwendigkeit entsteht aber nicht etwa daher, weil viel Geschehenes nachentdeckt worden, sondern weil neue Ansichten gegeben werden, weil der Genosse einer fortschreitenden Zeit auf Standpunkte geführt wird, von welchen sich das Vergangene auf neue Weise überschauen und beurteilen lässt.“
Man muss diesen ehrwürdigen Hintergrund aufrufen, um den Weg, den Pierre Nora mit dem Projekt der „Lieux de mémoire“ beschritt, den er selbst rückblickend als „Abenteuer“ bezeichnete, in seiner vielfältigen innovatorischen Bedeutung zutreffend einschätzen zu können. Zum einen gelingt es ihm damit nämlich, die gern beschwiegene Absicht jeder Geschichtsschreibung transparent zu machen, die, weil sie das vergangene Geschehen, die Geschichte eben, ganz im Sinne Goethes vom Standpunkt der jeweiligen Gegenwart aus gewichtet und damit Erinnerung strukturiert und teleologisch zurichtet, stets Identitätsbildung im Schilde führt.
Zum anderen vermag Pierre Nora diese Absicht geradezu als eine methodische Tugend zu erweisen: Der Prozess der Historisierung bestimmter Themen und Ereignisse, denen für die Identitätsstiftung eine Schlüsselfunktion zuerkannt werden kann, avanciert zum eigentlichen Gegenstand der historiographischen Analyse. Außerdem verwandelt sich unter diesem Prozess der zunächst bloß operationelle Begriff „Erinnerungsort“ zu einer neuen Kategorie historischer Einsicht, insofern sich dieser definieren lässt als ein
„"materieller wie auch immaterieller, langlebiger, Generationen überdauernder Kristallisationspunkt kollektiver Erinnerung und Identität, der durch einen Überschuss an symbolischer und emotionaler Dimension gekennzeichnet, in gesellschaftliche, kulturelle und politische Üblichkeiten eingebunden ist und sich in dem Maße verändert, in dem sich die Weise seiner Wahrnehmung, Aneignung, Anwendung und Übertragung verändert".“
Damit wurde eine neue Stufe historischer Reflexion erreicht, die jene sieben Bände der „Lieux de mémoire“ fraglos zum Vorbild einer neuen Art von Geschichtsschreibung gemacht haben, dem die jeweilige Gegenwart zur wichtigsten Kategorie der historischen Selbstvergewisserung und damit der Identitätsbestimmung geworden ist.
Der jetzt auf Deutsch vorliegende und sorgfältig übersetzte Auswahlband aus den „Lieux de mémoire“ verschafft einer wesentlich größeren Leserschaft jetzt einen repräsentativen Eindruck dieses viel gerühmten Unternehmens. Der Umstand, dass aus den insgesamt 133 Beiträgen des originalen Werks nur 15 in der einbändigen Auswahl vorgelegt werden konnten, tut dem keinerlei Abbruch, denn es wurden dafür ausnahmslos Essays gewählt, die sowohl methodisch wie inhaltlich überzeugen und die insgesamt die in drei große Abschnitte unterteilte Struktur des Geschichtswerks getreulich widerspiegeln:
Der erste Teil versammelt unter dem Titel „Die Republik“ vier Beiträge, von denen zwei zentrale Motive der Revolution, den Slogan „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ sowie „Die Marseillaise“ behandeln. Der dritte Beitrag ist dem Wahrzeichen von Paris und ganz Frankreich, dem „Eiffelturm“ gewidmet, während der vierte die Anti-Republik schlechthin, das Regime von „Vichy“ zum Gegenstand hat.
Aus dem zweiten Abschnitt, der mit „Die Nation“ überschrieben ist, wurden ebenfalls vier Beiträge ausgewählt: „Der Code civil“, die Frankreich bis heute prägende und von Napoleon veranlasste Vereinheitlichung der Rechtssprechung, der traditionelle und spannungsreiche Gegensatz „Paris-Provinz“, die Schlacht von „Verdun“ sowie der für das gesamte Unternehmen in inhaltlicher wie methodischer Hinsicht vielleicht aufschlussreichste Essay von Pierre Nora, der sich mit dem Konkurrenzverhältnis von „Gaullisten und Kommunisten“ befasst.
Aus dem dritten und mit Abstand umfangreichsten Abschnitt der „Lieux de mémoire“, der im Original den auf den ersten Blick überraschenden Titel „Les France“, „Die Frankreiche“, trägt, wurden hingegen sieben Essays ausgewählt, von denen sich zwei mit für die Geschichte des Landes emblematischen Persönlichkeiten, mit „Jeanne d’Arc“ und „Descartes“ befassen. Ein dritter Beitrag „Der Boden“ hat die siedlungsgeographische Vielfalt Frankreichs zum Gegenstand, während mit dem Aufsatz „Der Hof“ die für die politische wie kulturelle Identität wichtige Prägung durch die Monarchie beschrieben wird.
Abgerundet wird dieser Abschnitt durch drei Aufsätze, die sich mit „Der Tour de France“, dem großen Romanwerk Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ sowie mit „Paris“ als Kristallisationspunkt der französischen Identität befassen. Den Rahmen dieser Auswahl bilden außerdem das Vor- wie Nachwort von Pierre Nora.
Selbstverständlich wird diese an „Erinnerungsorten“, also an der Topologie des kollektiven Gedächtnisses orientierte Geschichtsschreibung weder die traditionelle, problembezogene monographische Historiographie noch die Biographik obsolet machen. Zu hoffen und zu erwarten aber ist, dass beide von dieser neuen, durchaus eleganten und intellektuell brillanten Methode der Geschichtsschreibung ihren stillen Nutzen haben und nicht in der Ödnis der Gesellschaftsgeschichte versanden. Allein diese Erwartung lässt einen den Auswahlband „Erinnerungsorte Frankreichs“ freudig begrüßen.
Pierre Nora (Hrsg.): Erinnerungsorte Frankreichs
Aus dem Französischen von Michael Bayer, Enrico Heinemann, Elsbeth Ranke, Ursel Schäfer, Hans Thill und Reinhard Tiffert
C.H. Beck Verlag, München 2005
Es handelt sich dabei um den rundum geglückten Versuch, sich von der traditionellen und nur jeweils anders kostümierten historistischen Geschichtserzählung zu befreien, die jeweils zeigen wollte, „wie es eigentlich gewesen“ und die dabei von der Einsicht zehrte, dass Vergangenheit, insofern sie Objekt der Geschichtsschreibung ist, seit je ein Geschehen meint, das in seinen Abläufen fixiert ist, das jedoch stets neu gedeutet wird, wie Goethe in den „Materialien zur Geschichte der Farbenlehre“ bereits feststellte:
„Dass die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschrieben werden müsse, darüber ist in unseren Tagen wohl kein Zweifel übrig geblieben. Eine solche Notwendigkeit entsteht aber nicht etwa daher, weil viel Geschehenes nachentdeckt worden, sondern weil neue Ansichten gegeben werden, weil der Genosse einer fortschreitenden Zeit auf Standpunkte geführt wird, von welchen sich das Vergangene auf neue Weise überschauen und beurteilen lässt.“
Man muss diesen ehrwürdigen Hintergrund aufrufen, um den Weg, den Pierre Nora mit dem Projekt der „Lieux de mémoire“ beschritt, den er selbst rückblickend als „Abenteuer“ bezeichnete, in seiner vielfältigen innovatorischen Bedeutung zutreffend einschätzen zu können. Zum einen gelingt es ihm damit nämlich, die gern beschwiegene Absicht jeder Geschichtsschreibung transparent zu machen, die, weil sie das vergangene Geschehen, die Geschichte eben, ganz im Sinne Goethes vom Standpunkt der jeweiligen Gegenwart aus gewichtet und damit Erinnerung strukturiert und teleologisch zurichtet, stets Identitätsbildung im Schilde führt.
Zum anderen vermag Pierre Nora diese Absicht geradezu als eine methodische Tugend zu erweisen: Der Prozess der Historisierung bestimmter Themen und Ereignisse, denen für die Identitätsstiftung eine Schlüsselfunktion zuerkannt werden kann, avanciert zum eigentlichen Gegenstand der historiographischen Analyse. Außerdem verwandelt sich unter diesem Prozess der zunächst bloß operationelle Begriff „Erinnerungsort“ zu einer neuen Kategorie historischer Einsicht, insofern sich dieser definieren lässt als ein
„"materieller wie auch immaterieller, langlebiger, Generationen überdauernder Kristallisationspunkt kollektiver Erinnerung und Identität, der durch einen Überschuss an symbolischer und emotionaler Dimension gekennzeichnet, in gesellschaftliche, kulturelle und politische Üblichkeiten eingebunden ist und sich in dem Maße verändert, in dem sich die Weise seiner Wahrnehmung, Aneignung, Anwendung und Übertragung verändert".“
Damit wurde eine neue Stufe historischer Reflexion erreicht, die jene sieben Bände der „Lieux de mémoire“ fraglos zum Vorbild einer neuen Art von Geschichtsschreibung gemacht haben, dem die jeweilige Gegenwart zur wichtigsten Kategorie der historischen Selbstvergewisserung und damit der Identitätsbestimmung geworden ist.
Der jetzt auf Deutsch vorliegende und sorgfältig übersetzte Auswahlband aus den „Lieux de mémoire“ verschafft einer wesentlich größeren Leserschaft jetzt einen repräsentativen Eindruck dieses viel gerühmten Unternehmens. Der Umstand, dass aus den insgesamt 133 Beiträgen des originalen Werks nur 15 in der einbändigen Auswahl vorgelegt werden konnten, tut dem keinerlei Abbruch, denn es wurden dafür ausnahmslos Essays gewählt, die sowohl methodisch wie inhaltlich überzeugen und die insgesamt die in drei große Abschnitte unterteilte Struktur des Geschichtswerks getreulich widerspiegeln:
Der erste Teil versammelt unter dem Titel „Die Republik“ vier Beiträge, von denen zwei zentrale Motive der Revolution, den Slogan „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ sowie „Die Marseillaise“ behandeln. Der dritte Beitrag ist dem Wahrzeichen von Paris und ganz Frankreich, dem „Eiffelturm“ gewidmet, während der vierte die Anti-Republik schlechthin, das Regime von „Vichy“ zum Gegenstand hat.
Aus dem zweiten Abschnitt, der mit „Die Nation“ überschrieben ist, wurden ebenfalls vier Beiträge ausgewählt: „Der Code civil“, die Frankreich bis heute prägende und von Napoleon veranlasste Vereinheitlichung der Rechtssprechung, der traditionelle und spannungsreiche Gegensatz „Paris-Provinz“, die Schlacht von „Verdun“ sowie der für das gesamte Unternehmen in inhaltlicher wie methodischer Hinsicht vielleicht aufschlussreichste Essay von Pierre Nora, der sich mit dem Konkurrenzverhältnis von „Gaullisten und Kommunisten“ befasst.
Aus dem dritten und mit Abstand umfangreichsten Abschnitt der „Lieux de mémoire“, der im Original den auf den ersten Blick überraschenden Titel „Les France“, „Die Frankreiche“, trägt, wurden hingegen sieben Essays ausgewählt, von denen sich zwei mit für die Geschichte des Landes emblematischen Persönlichkeiten, mit „Jeanne d’Arc“ und „Descartes“ befassen. Ein dritter Beitrag „Der Boden“ hat die siedlungsgeographische Vielfalt Frankreichs zum Gegenstand, während mit dem Aufsatz „Der Hof“ die für die politische wie kulturelle Identität wichtige Prägung durch die Monarchie beschrieben wird.
Abgerundet wird dieser Abschnitt durch drei Aufsätze, die sich mit „Der Tour de France“, dem großen Romanwerk Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ sowie mit „Paris“ als Kristallisationspunkt der französischen Identität befassen. Den Rahmen dieser Auswahl bilden außerdem das Vor- wie Nachwort von Pierre Nora.
Selbstverständlich wird diese an „Erinnerungsorten“, also an der Topologie des kollektiven Gedächtnisses orientierte Geschichtsschreibung weder die traditionelle, problembezogene monographische Historiographie noch die Biographik obsolet machen. Zu hoffen und zu erwarten aber ist, dass beide von dieser neuen, durchaus eleganten und intellektuell brillanten Methode der Geschichtsschreibung ihren stillen Nutzen haben und nicht in der Ödnis der Gesellschaftsgeschichte versanden. Allein diese Erwartung lässt einen den Auswahlband „Erinnerungsorte Frankreichs“ freudig begrüßen.
Pierre Nora (Hrsg.): Erinnerungsorte Frankreichs
Aus dem Französischen von Michael Bayer, Enrico Heinemann, Elsbeth Ranke, Ursel Schäfer, Hans Thill und Reinhard Tiffert
C.H. Beck Verlag, München 2005
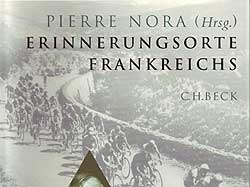
Pierre Nora (Hrsg.): Erinnerungsorte Frankreichs (Coverausschnitt)© C.H. Beck Verlag