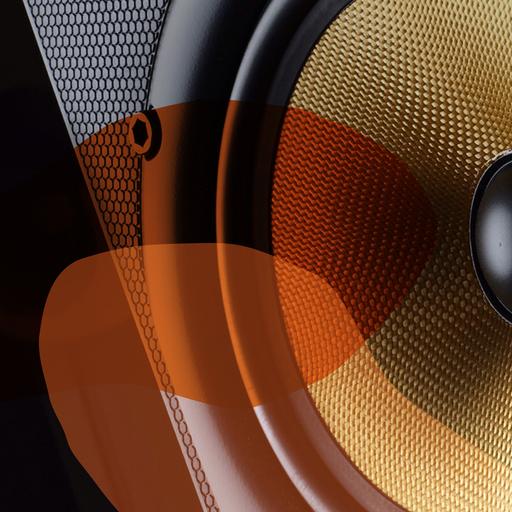Ramon Schack, Jahrgang 1971, ist Diplom-Politologe, Journalist und Publizist. Er schreibt für die "Neue Zürcher Zeitung", "Süddeutsche Zeitung", "Die Welt", "Berliner Zeitung", "Wiener Zeitung" und "Handelsblatt". Seit 2018 moderiert Schack die Internetsendung "Impulsiv TV", in der er Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur interviewt.
Warum sich der Westen neu erfinden muss
04:19 Minuten

Viel zu lang habe der Westen gebraucht, um die Veränderungen im weltpolitischen Machtgefüge nach 1990 zu begreifen, kritisiert Ramon Schack. Und hat dabei vor allem den Aufstieg Chinas im Blick. Uns dagegen droht der Rückfall in die Mittelmäßigkeit.
30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges, nach der Überwindung des Ost-West-Konfliktes, hat sich die NATO darauf geeinigt, die Volksrepublik China und ihre politische und wirtschaftliche Potenz als "Herausforderung" einzustufen. Skeptiker könnten vermuten, dass das westliche Militärbündnis nach dem Verlust seiner einstigen Gegner gar nicht anders kann, als regelmäßig neue Feindbilder zu konstruieren, schon allein deshalb, um seine eigene Existenz zu rechtfertigen.
Am Umgang mit der Volksrepublik Chinas offenbart sich jedoch mit betrüblicher Deutlichkeit, in welchem Ausmaß den Europäern und Amerikanern das geschichtliche Bewusstsein verloren gegangen ist.
Die Fehldiagnose des amerikanischen Politologen Francis Fukuyama vom "Ende der Geschichte" war auf allzu fruchtbaren Boden gefallen. Die westliche Welt begegnet dem phänomenalen Aufstieg Chinas in den Rang der zweiten Weltmacht mit einem Gemisch aus Arroganz und Missgunst. Die kaum zu bändigende Dynamik der Volksrepublik erzeugt wachsende Furcht, ja die Ahnung des eigenen Rückfalls in unerträgliche Mittelmäßigkeit.
Die mittlerweile schon fast krankhafte Abneigung gegenüber China, die immer wieder in der westlichen Berichterstattung sichtbar wird, hängt wohl auch damit zusammen. Viele westliche Wortführer fordern heute mit der "Menschenrechtskeule" äußerst selektiv "Reformen" im Reich der Mitte ein. Doch gleichzeitig schränken sie im Westen demokratische Grundrechte ein.
Das westliche Modell ist zum "Ladenhüter" geworden
Der Historiker Niall Ferguson analysiert in seinem Buch "Der Niedergang des Westens" den Verfall jener vier Säulen, auf denen einst die Weltherrschaft des Westens ruhte: repräsentative Demokratie, freie Marktwirtschaft, Rechtsstaat und Zivilgesellschaft. Sie degenerierten, so Ferguson, zunehmend zu den Gefahrenquellen von nachlassendem Wachstum, explodierenden Staatsschulden, zunehmender Ungleichheit, alternden Bevölkerungen sowie auseinanderbrechenden Sozialgefügen.
Unabhängig davon, welche innenpolitischen Folgen sich daraus in naher Zukunft ergeben: außenpolitisch ist unser politisches Modell - vor dem Hintergrund einer völlig anders gearteten Staatenwelt - zum Ladenhüter geworden.
Das späte 20. und frühe 21. Jahrhundert sind für die USA und Europa in vielerlei Hinsicht katastrophal gewesen. Der Kampf um Einfluss gerade in jenen Regionen, die Ost und West miteinander verbinden, ging verloren. Erstaunlich war hierbei, dass dem Westen offenbar seine Fähigkeit, welthistorische Vorgänge wahrzunehmen und darauf angemessen zu reagieren, verloren gegangen ist.
Sowohl beim so genannten "Krieg gegen den Terror" wie auch beim Versuch der NATO in die Weiten des eurasischen Raumes an die Ufer des Kaspischen Meeres vorzudringen - übrigens ein Prozess, den die Medien schönfärberisch als "NATO-Osterweiterung" beschreiben -, wurden historische Betrachtungen ignoriert.
Der Westen muss sich entscheiden
Was nun, Westen?
Erst wenn der Westen einen neuen realistischen Blick auf die Welt wagt, ja wenn man die globale Veränderung in Richtung einer multipolaren Welt als Chance betrachtet, kann eine große Konfrontation mit den nicht westlichen Mächten vermieden werden.
Diese Einsicht muss von den Menschen im Westen selbst geleistet werden. Ob das Zeitalter des Westens an einem Scheideweg angekommen ist oder gar an seinem Ende, wird die Geschichte offenbaren. Das Prinzip des unerbittlichen Aufstiegs und Falls der Imperien, welcher eine Konstante der Weltgeschichte darstellt, ist auch heute noch gültig. Schon zu Zeiten des Imperium Romanums galt folgende Redensart: "Rom fällt nicht von Feindeshand, es ist der Zahn der Zeit, der an ihm nagt."