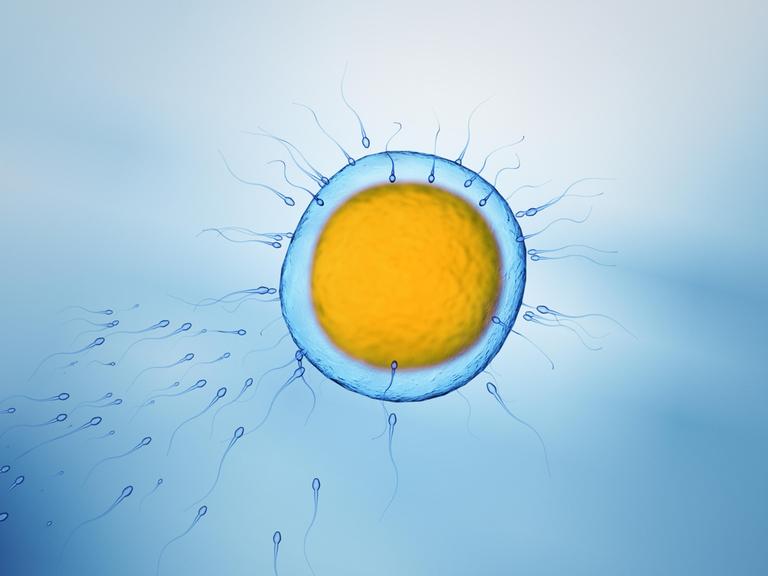- Wann sind Frühchen lebensfähig?
- Welche gesundheitlichen Risiken haben Extremfrühchen?
- Wo liegt die Altersgrenze für Frühgeborene in anderen Ländern?
- Wer sollte entscheiden, welches Kind gerettet und welches sterben soll?
- Warum kommt es bei uns häufiger zu Frühgeburten?
- Wo liegt die gesellschaftliche Verantwortung für Frühchen?
Überlebenswunder und ihre Schattenseiten

Mit der richtigen intensivmedizinischen Ausrüstung und Erfahrung ist es heutzutage möglich, ein Baby zu retten, das weniger als 24 Wochen im Mutterleib verbracht hat. Doch ist es auch das Beste für Eltern und Kinder?
Medizinisch ist es eine Erfolgsgeschichte: Noch in den 1960er-Jahren starben die meisten Frühchen, die bei ihrer Geburt weniger als 1.000 Gramm wogen. Dank intensivmedizinischer Hilfe überleben heute Babys, die nicht viel mehr wiegen als ein Päckchen Butter. So wie das Mädchen, das kürzlich als Passauer Wunder gefeiert wurde, weil es bei seiner Geburt nur 265 Gramm leicht war.
Doch der medizinische Fortschritt hat auch seinen Preis: Die meisten dieser extrem früh geborenen Kinder müssen über Monate intensivmedizinisch behandelt werden. Nicht wenige von ihnen brauchen auch in ihrem späteren Leben Unterstützung. Und einige tragen Behinderungen davon.
Inhalt
Wann sind Frühchen lebensfähig?
Das medizinische Nadelöhr bei Frühchen sei die Atmung, erklärt der Neonatologe Reinald Repp vom Uniklinikum Fulda. Babys könnten nur überleben, wenn die Lunge in der Lage sei, Sauerstoff aufzunehmen und Kohlendioxid abzugeben. Die Untergrenze dafür liegt zwischen der 22. und 24. Schwangerschaftswoche – auch mit Atemunterstützung und Beatmungstechniken.
Welche gesundheitlichen Risiken haben Extremfrühchen?
Etwa 45 Prozent der in der 22. Schwangerschaftswoche geborenen Frühchen überleben inzwischen. Von ihnen tragen rund 60 Prozent ein Handicap davon, sagt Alexander Rakow vom schwedischen Karolinska Institut Stockholm. Dazu gehören Hirnschädigungen, die zu geistiger Behinderung, Lähmungen und Entwicklungsverzögerungen führen können, Schädigungen des Darms und anderer Organe, chronische Atemwegserkrankungen und die Beeinträchtigung des Immunsystems, der Augen und des Gehörs.
In 20 bis 30 Prozent der Fälle seien die Beeinträchtigungen schwerwiegend, in 30 bis 40 Prozent eher moderat, so Rakow. Ähnlich sehe es bei Frühchen aus, die in der 23. Schwangerschaftswoche geboren werden, auch wenn ihre Überlebenschancen besser seien. Erst ab der 24. und 25. Schwangerschaftswoche besserten sich die Prognosen signifikant.
Wo liegt die Altersgrenze für Frühgeborene in anderen Ländern?
In manchen Ländern werden Babys erst ab der vollendeten 24. Schwangerschaftswoche intensivmedizinisch behandelt, etwa in den Niederlanden und der Schweiz. Babys, die früher auf Welt kommen, lässt man in der Regel sterben. In Japan hingegen müssen Frühchen laut Gesetz ab der 22. Schwangerschaftswoche intensivmedizinisch behandelt werden. In Deutschland obliegt die Entscheidung, ob Babys, die vor der 24. Schwangerschaftswoche geboren werden, eine intensivmedizinische Behandlung erhalten sollen, den Eltern. Die 22. und 23. Schwangerschaftswoche sind in medizinischen Leitlinien als Graubereich definiert.
Wer sollte entscheiden, welches Kind gerettet und welches sterben soll?
Eltern könnten oft nicht wirklich abschätzen, welche Konsequenzen ihre Entscheidung hat, auch wenn Ärzte sie über die möglichen Folgeschäden aufgeklärt haben, sagt Silke Mader, selbst Mutter eines Frühchens und Gründerin eines Selbsthilfevereins und der Stiftung „European Foundation for the Care of Newborn Infants“. Letztlich müssten die Eltern mit Folgen und Konsequenzen einer extrem frühen Geburt zurechtkommen. Manche seien auf Dauer damit überfordert, so Mader.
Eine Befragung von Eltern von 16 Frühchen an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Fulda ergab, dass Paare, die sich für eine lebenserhaltende Behandlung entschieden hatten, das wieder tun würden - selbst wenn das Kind nach wenigen Tagen gestorben war.
Der Neonatologe Alexander Rakow plädiert dennoch dafür, die Entscheidung über das Leben eines Kindes nicht allein den Eltern zu überlassen, sondern gemeinsam mit ihnen zu treffen. Man müsse den Eltern auch die Last abnehmen, über Leben und Tod zu entscheiden und dies dann womöglich ein Leben lang mit sich herumzutragen, betont er.
Warum kommt es bei uns häufiger zu Frühgeburten?
85 Prozent der Mehrlingsgeburten nach künstlicher Befruchtung in Deutschland sind Frühgeburten, sagt die Medizinethikerin Claudia Wiesemann. Die Rate an Mehrlingsgeburten nach künstlicher Befruchtung ist hierzulande im Vergleich mit Ländern wie England oder Schweden eher hoch: Sie liegt bei rund 15 Prozent. Ließe sich die Rate auf zwei oder drei Prozent reduzieren, würde das Leben retten, sagt die Medizinethikerin.
Dem steht das Embryonenschutzgesetz in Deutschland entgegen, das seit 1990 gilt. Es verbietet, Embryonen vor einer künstlichen Befruchtung nach Qualitätsmerkmalen auszuwählen. Gleichzeitig haben sich die Überlebenschancen Frühgeborener in den letzten 35 Jahren dramatisch verbessert. Wiesemann plädiert vor diesem Hintergrund für eine Reform des Embryonenschutzgesetzes.
Wo liegt die gesellschaftliche Verantwortung für Frühchen?
Andere Länder gehen offener mit der Problematik um, auch angesichts der hohen Kosten. Laut Schätzungen liegen diese zwischen 100.000 und 300.000 Euro für die intensivmedizinische Behandlung extremer Frühchen, in besonders komplizierten Einzelfällen können es sogar 500.000 Euro sein.
In den Niederlanden habe es vor mehreren Jahrzehnten ethische Grundsatzdebatten darüber gegeben, ob sich die Gesellschaft diese hohen Kosten leisten wolle, erinnert sich der Neanatologe Alexander Rakow. Ergebnis: Man wollte nicht, solange das Überleben "mit einer guten Qualität" unsicher sei. „Das ist legitim, wenn ein Land das so für sich entscheidet“, sagt Rakow.
Mögliche Folgekosten von vier Millionen Euro
Nur wenige der extrem zu frühgeborenen Kinder können sich als Erwachsene selbst versorgen, sie benötigen ihr Leben lang finanzielle Unterstützung. Bei schweren Behinderungen können die Folgekosten bis zu vier Millionen Euro betragen.
„Natürlich hat jeder Mensch zunächst einmal ein Recht auf Leben und Überleben. Und wenn die Medizin das gewährleisten kann, dann gibt es daran gar nichts zu kritteln oder zu bezweifeln", sagt die Medizinethikerin Claudia Wiesemann.
Kostendebatte mit Blick auf die gesamte Medizin
Wenn man über Kosten spreche, müsse man das in einem größeren Zusammenhang machen, betont sie: "Dann muss natürlich alles auf den Prüfstand und man muss sich bei allen (medizinischen) Maßnahmen fragen, was davon sinnvoll ist, was davon tatsächlich auch Lebensjahre in guter Lebensqualität verspricht."
Da könne man dann hinter einer ganzen Reihe von medizinischen Maßnahmen durchaus ein Fragezeichen setzen, sagt die Expertin. Diese Debatte dürfe deswegen nicht isoliert vor dem Hintergrund von einzelnen spektakulären medizinischen Erfolgen, sondern müsse mit Blick auf die gesamte Medizin und ihre Auswirkungen geführt werden: "Das wäre fairer.“
tha