Fragwürdige Erinnerungslandschaft
Politische Versäumnisse und personelle Fehlentscheidungen, wie sie der vormals nach Joachim Gauck, heute nach Marianne Birthler benannten Stasi-Unterlagen-Behörde in dem Klein/Schroeder-Papier angekreidet worden sind – warum sollen sie nicht öffentlich diskutiert werden? Eine offene Auseinandersetzung ist notwendig – und Frau Birthler wird sich der Kritik stellen müssen, wenn demnächst im Bundestag über Zukunft und Zuständigkeit ihres Hauses beraten und entschieden wird.
Einige der kritisierten Sachverhalte haben sich inzwischen längst erledigt – andere aber noch nicht. Dass heute, im Jahre 17 der deutschen Einheit, ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit noch immer in der Behörde tätig sind, was auch immer sie zu tun haben – das ist schwer vermittelbar. Bedarf es wirklich erst einer grundsätzlichen Neuorientierung in der Erinnerungspolitik samt ihrer institutionellen Konsequenzen, ehe sich auch dieses personelle Problem lösen lässt? Konzeptionelle Überlegungen, die die Birthler-Behörde, die Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Gedenk- und Erinnerungsstätten zur DDR-Vergangenheit sowie das Bundesarchiv und die Staatsarchive der Länder berühren, wollen allerdings klug bedacht sein, ehe darüber beschlossen wird.
Bestimmender Gesichtspunkt bleibt der Umgang mit den Stasi-Akten. Der Zugriff auf sie muss auch in Zukunft gewährleistet sein - für ehemals Verfolgte des Unrechtsregimes ebenso wie für die Medien und die Geschichtsforschung. Für die politische und historische Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, die noch lange nicht als beendet gelten kann, sind sie unverzichtbar. Speziell die Erblast der Staatssicherheit ist noch nicht getilgt. Hier ist Aufarbeitung umso dringender geboten, als linksorthodoxe Tendenzen zur Revision des DDR-Geschichtsbildes im gesellschaftlichen Diskurs deutlich verstärkt hervortreten. Indizien dafür sind die in jüngster Zeit sich häufenden Wortmeldungen ehemaliger Stasi-Spitzenkader, denen die Öffnung der Akten-Archive seit eh und je ein Dorn im Auge ist.
Exemplarisch dafür war erst jüngst wieder ein Artikel von Werner Großmann, der sich gern als Generaloberst a. D. und letzter Chef der DDR-Auslandsaufklärung präsentiert, ohne zu sagen, dass er zugleich Stellvertreter Erich Mielkes war. In der früheren FDJ-Zeitung "Junge Welt" mokierte sich der 78-Jährige über die Birthler’sche Forschungsabteilung, der er rundheraus die Wissenschaftlichkeit aberkennen will. Scharlatanerie, Stückwerk, Mutmaßungen, Brunnenvergiftung – so seine Stichworte zu einer Expertise über die Stasi-Westarbeit. Großmann revanchiert sich damit für einen Boykott der Stasi-Unterlagen-Behörde gegen eine von dem dänischen Historiker Thomas Wegener Friis ausgerechnet zum 17. Juni geplante Tagung in Berlin, zu der vorzugsweise ehemalige Generäle und Obristen aus dem Staatssicherheitsdienst als Referenten oder Zeitzeugen geladen waren, darunter Großmann selbst.
Warum nicht, ist man versucht zu fragen, wenn es Erkenntnis fördernd sein kann? Doch eben dies ist absolut zweifelhaft. Wer die Publikationen und Pamphlete, Memoiren und Elaborate früherer DDR-Tschekisten kennt, deren Editionen sich in den letzten Jahren gehäuft haben, der weiß, dass ihre Autoren nichts als pure Apologetik verbreiten. Sie leugnen nicht nur jegliche Verbrechen, sondern sie rechtfertigen ihr Tun ausdrücklich. "Es gibt da, was unsere Tätigkeit betrifft, überhaupt nichts zu bereuen", äußerte neulich ein Ex-Stasi-Oberst in einem Statement für das ZDF. "Das ist ehrenhaft, was wir getan haben." Also Desinformation und Selbstverklärung jenseits von Schuld und Scham. Das Unrecht der Staatssicherheit soll im Grau des Vergessens versinken, verdrängt aus dem kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft.
Indes hat Großmann, ohne sich dessen bewusst zu sein, selbst ein überzeugungskräftiges Argument gegen den Dialog mit Seinesgleichen geliefert. In besagtem Artikel gab er gleichsam seine Weigerung zu Protokoll, zur wissenschaftlichen Recherche beizutragen. Seinem Vorhalt, die Historiker der Birthler-Behörde hätten keine Ahnung von der Stasi-Aufklärung, fügte er hämisch hinzu: "Und diejenigen, die es wirklich wissen, sagen es nicht. Heute nicht und später auch nicht. Das erfordert ihr Ehrenkodex." Ein Dialog mit Zeitzeugen dieser Qualität macht keinen Sinn – weder politisch noch wissenschaftlich. Historische Aufarbeitung wird bei solcher Verweigerungshaltung nur um so unerlässlicher – woran zu denken ist, wenn im Herbst die Erinnerungslandschaft neu durchpflügt wird.
Karl Wilhelm Fricke, Publizist, geboren 1929 in Hoym (Anhalt), floh nach dem Abitur 1949 aus der SBZ nach Westdeutschland. Bis 1953 studierte er an der Hochschule für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhelmshaven und an der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin und war im Westen der Stadt als freiberuflicher Journalist tätig. 1955 wurde Fricke von Stasi-Agenten aus West-Berlin entführt und 1956 in der DDR wegen "Kriegshetze" zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Er war bis 1959 in Brandenburg-Görden bzw. in Bautzen inhaftiert.
Anschließend arbeitete er als Journalist in Hamburg, von 1970 bis1994 als Leitender Redakteur beim Deutschlandfunk in Köln, seit 1994 wieder freiberuflich als Publizist. Fricke war Sachverständigen-Mitglied beider Enquetekommissionen zur "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland" sowie zur "Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit". 1996 wurde er Ehrendoktor der Freien Universität Berlin im Fachbereich Politische Wissenschaft.
Seine Buchveröffentlichungen: "Politik und Justiz in der DDR" (1979), "Die DDR-Staatssicherheit" (1982), "Opposition und Widerstand in der DDR" (1984), "MfS intern" (1991), "Akten-Einsicht" (1995), (gemeinsam mit Roger Engelmann), "Konzentrierte Schläge" (1998), "Der Wahrheit verpflichtet" (2000); zusammen mit Silke Klewin: "Bautzen II. Sonderhaftanstalt unter MfS-Kontrolle 1956 bis 1989" (Verlag Gustav Kiepenheuer).
Bestimmender Gesichtspunkt bleibt der Umgang mit den Stasi-Akten. Der Zugriff auf sie muss auch in Zukunft gewährleistet sein - für ehemals Verfolgte des Unrechtsregimes ebenso wie für die Medien und die Geschichtsforschung. Für die politische und historische Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, die noch lange nicht als beendet gelten kann, sind sie unverzichtbar. Speziell die Erblast der Staatssicherheit ist noch nicht getilgt. Hier ist Aufarbeitung umso dringender geboten, als linksorthodoxe Tendenzen zur Revision des DDR-Geschichtsbildes im gesellschaftlichen Diskurs deutlich verstärkt hervortreten. Indizien dafür sind die in jüngster Zeit sich häufenden Wortmeldungen ehemaliger Stasi-Spitzenkader, denen die Öffnung der Akten-Archive seit eh und je ein Dorn im Auge ist.
Exemplarisch dafür war erst jüngst wieder ein Artikel von Werner Großmann, der sich gern als Generaloberst a. D. und letzter Chef der DDR-Auslandsaufklärung präsentiert, ohne zu sagen, dass er zugleich Stellvertreter Erich Mielkes war. In der früheren FDJ-Zeitung "Junge Welt" mokierte sich der 78-Jährige über die Birthler’sche Forschungsabteilung, der er rundheraus die Wissenschaftlichkeit aberkennen will. Scharlatanerie, Stückwerk, Mutmaßungen, Brunnenvergiftung – so seine Stichworte zu einer Expertise über die Stasi-Westarbeit. Großmann revanchiert sich damit für einen Boykott der Stasi-Unterlagen-Behörde gegen eine von dem dänischen Historiker Thomas Wegener Friis ausgerechnet zum 17. Juni geplante Tagung in Berlin, zu der vorzugsweise ehemalige Generäle und Obristen aus dem Staatssicherheitsdienst als Referenten oder Zeitzeugen geladen waren, darunter Großmann selbst.
Warum nicht, ist man versucht zu fragen, wenn es Erkenntnis fördernd sein kann? Doch eben dies ist absolut zweifelhaft. Wer die Publikationen und Pamphlete, Memoiren und Elaborate früherer DDR-Tschekisten kennt, deren Editionen sich in den letzten Jahren gehäuft haben, der weiß, dass ihre Autoren nichts als pure Apologetik verbreiten. Sie leugnen nicht nur jegliche Verbrechen, sondern sie rechtfertigen ihr Tun ausdrücklich. "Es gibt da, was unsere Tätigkeit betrifft, überhaupt nichts zu bereuen", äußerte neulich ein Ex-Stasi-Oberst in einem Statement für das ZDF. "Das ist ehrenhaft, was wir getan haben." Also Desinformation und Selbstverklärung jenseits von Schuld und Scham. Das Unrecht der Staatssicherheit soll im Grau des Vergessens versinken, verdrängt aus dem kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft.
Indes hat Großmann, ohne sich dessen bewusst zu sein, selbst ein überzeugungskräftiges Argument gegen den Dialog mit Seinesgleichen geliefert. In besagtem Artikel gab er gleichsam seine Weigerung zu Protokoll, zur wissenschaftlichen Recherche beizutragen. Seinem Vorhalt, die Historiker der Birthler-Behörde hätten keine Ahnung von der Stasi-Aufklärung, fügte er hämisch hinzu: "Und diejenigen, die es wirklich wissen, sagen es nicht. Heute nicht und später auch nicht. Das erfordert ihr Ehrenkodex." Ein Dialog mit Zeitzeugen dieser Qualität macht keinen Sinn – weder politisch noch wissenschaftlich. Historische Aufarbeitung wird bei solcher Verweigerungshaltung nur um so unerlässlicher – woran zu denken ist, wenn im Herbst die Erinnerungslandschaft neu durchpflügt wird.
Karl Wilhelm Fricke, Publizist, geboren 1929 in Hoym (Anhalt), floh nach dem Abitur 1949 aus der SBZ nach Westdeutschland. Bis 1953 studierte er an der Hochschule für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhelmshaven und an der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin und war im Westen der Stadt als freiberuflicher Journalist tätig. 1955 wurde Fricke von Stasi-Agenten aus West-Berlin entführt und 1956 in der DDR wegen "Kriegshetze" zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Er war bis 1959 in Brandenburg-Görden bzw. in Bautzen inhaftiert.
Anschließend arbeitete er als Journalist in Hamburg, von 1970 bis1994 als Leitender Redakteur beim Deutschlandfunk in Köln, seit 1994 wieder freiberuflich als Publizist. Fricke war Sachverständigen-Mitglied beider Enquetekommissionen zur "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland" sowie zur "Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit". 1996 wurde er Ehrendoktor der Freien Universität Berlin im Fachbereich Politische Wissenschaft.
Seine Buchveröffentlichungen: "Politik und Justiz in der DDR" (1979), "Die DDR-Staatssicherheit" (1982), "Opposition und Widerstand in der DDR" (1984), "MfS intern" (1991), "Akten-Einsicht" (1995), (gemeinsam mit Roger Engelmann), "Konzentrierte Schläge" (1998), "Der Wahrheit verpflichtet" (2000); zusammen mit Silke Klewin: "Bautzen II. Sonderhaftanstalt unter MfS-Kontrolle 1956 bis 1989" (Verlag Gustav Kiepenheuer).
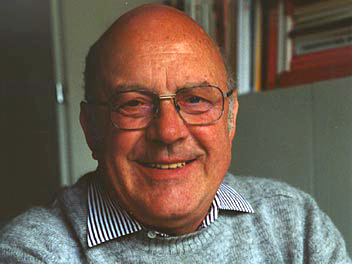
Karl Wilhelm Fricke© privat