Falsches Denken - falsche Sprache
Man kann aus einem Tätigkeitswort oder Verb ein Substantiv gewinnen, indem man den letzten Buchstaben fort nimmt und den weiblichen Artikel davor setzt. Aus senken wird dann die Senke und aus leuchten die Leuchte. Bei lachen und der Lache gibt es so was wie ein höhnisches Aburteil. Die Heule ist der - gleichfalls abschätzige - Name für transportable Radios.
Die Absahne bezeichnet einen finanziellen Übergriff. Die Sause ist der geringschätzige Name für eine feuchtfröhliche Feier. Erotische Annäherungen führen den grässlichen Namen Anmache, das hier zugrunde liegende Verbum ist auch als bloße Mache in Umlauf. Die Schreibe bezeichnet ein wenig qualifiziertes schriftliches Mitteilungsvermögen, und die scheußlichste dieser Wortbildungen betrifft jenen Vorgang, der den Menschen, unter anderem, zum Menschen macht: die Denke.
Warum reden wir davon? Weil die Denke sich mittlerweile selbst in die Sprache von Wirtschaftsleuten und Politikern einschlich. Politik und Wirtschaft sind viel mit Reden befasst. Das waren sie schon immer, aber neben die große Ansprache in Parlament, Haupt- und Volksversammlung sind inzwischen die zahlreichen elektronischen Kommunikationsmittel getreten, wo, mit oder ohne Bild, der Funktionsträger sich, sein Tun und seine Unterschiede zum Tun von anderen erläutern will. Dergleichen erzeugt eine Springflut des öffentlichen Verbalismus, der, um nicht gänzlich in Wiederholungen zu versickern, des lexischen Nachschubs bedarf. Die Übung, neue Wörter oder Wendungen aufzugreifen, ist beträchtlich. Einmal probiert, ist für fortwährenden Umschlag gesorgt, schon aus Aktualitätszwängen.
So tritt also die Denke auf und es scheint, wer sie in den Mund nimmt, nicht zu wissen, wie er damit sich selber beschädigt, indem er sein wichtigstes Vermögen verbal herabwürdigt.
Anderes in diesem Milieu sind überflüssige Albernheiten. Da wird, ich habe hier die Stimme von Oskar Lafontaine im Ohr, ständig behauptet, eine Sache sei streitig oder nicht, also unstreitig. Die adjektivische Ableitung vom Substantiv Streit heißt strittig und das Gegenteil unstrittig. Warum die hässliche Neubildung? Niemand kann es erklären.
So wenig wie die Gewinnwarnung. Nach normalem Verständnis müsste sie die Warnung vor einem Gewinn bedeuten, was hier natürlich widersinnig wäre, da in der Ökonomie Gewinne keiner Warnung bedürfen, sondern begrüßt werden. Die Gewinnwarnung warnt auch nicht vor Gewinn, sondern vor Verlust.
Ein anderes, ziemlich aktuelles Eigenschaftswort lautet systemisch. Es kam mit der aktuellen Finanzkrise in Umlauf und steht für die korrekte Adjektivbildung systembedingt und systemabhängig. Systemisch orientiert sich an dem Adjektiv polemisch, zu dem das Substantiv Polemik lautet und nicht etwa Polem. Die korrekte Ableitung von System heißt systematisch, was freilich etwas anderes beinhaltet als systembedingt und systemabhängig. Das Wort systemisch ist ähnlich blöde wie der gleichfalls im Finanzwesen tätige Analyst, der in korrektem Deutsch Analytiker heißen müsste und dessen Fehlleistungen unter anderem zu der gegenwärtigen Finanzkrise und der daraus folgenden Wirtschaftsdepression geführt haben.
Sprache ist die Materie des menschlichen Denkens. Falsches Sprechen bezeugt falsches Denken. Derart sind die Gewinnwarnungen der Analysten Resultat einer falschen Denke und ein systemisches Unglück.
Rolf Schneider stammt aus Chemnitz. Er war Redakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift "Aufbau" in Berlin (Ost) und wurde dann freier Schriftsteller. Wegen "groben Verstoßes gegen das Statut" wurde er im Juni 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, nachdem er unter anderem zuvor mit elf Schriftstellerkollegen in einer Resolution gegen die Zwangsausbürgerung Wolf Biermanns protestiert hatte. Veröffentlichungen u.a. "November", "Volk ohne Trauer" und "Die Sprache des Geldes". Rolf Schneider schreibt gegenwärtig für eine Reihe angesehener Zeitungen und äußert sich insbesondere zu kultur- und gesellschaftspolitischen Themen.
Warum reden wir davon? Weil die Denke sich mittlerweile selbst in die Sprache von Wirtschaftsleuten und Politikern einschlich. Politik und Wirtschaft sind viel mit Reden befasst. Das waren sie schon immer, aber neben die große Ansprache in Parlament, Haupt- und Volksversammlung sind inzwischen die zahlreichen elektronischen Kommunikationsmittel getreten, wo, mit oder ohne Bild, der Funktionsträger sich, sein Tun und seine Unterschiede zum Tun von anderen erläutern will. Dergleichen erzeugt eine Springflut des öffentlichen Verbalismus, der, um nicht gänzlich in Wiederholungen zu versickern, des lexischen Nachschubs bedarf. Die Übung, neue Wörter oder Wendungen aufzugreifen, ist beträchtlich. Einmal probiert, ist für fortwährenden Umschlag gesorgt, schon aus Aktualitätszwängen.
So tritt also die Denke auf und es scheint, wer sie in den Mund nimmt, nicht zu wissen, wie er damit sich selber beschädigt, indem er sein wichtigstes Vermögen verbal herabwürdigt.
Anderes in diesem Milieu sind überflüssige Albernheiten. Da wird, ich habe hier die Stimme von Oskar Lafontaine im Ohr, ständig behauptet, eine Sache sei streitig oder nicht, also unstreitig. Die adjektivische Ableitung vom Substantiv Streit heißt strittig und das Gegenteil unstrittig. Warum die hässliche Neubildung? Niemand kann es erklären.
So wenig wie die Gewinnwarnung. Nach normalem Verständnis müsste sie die Warnung vor einem Gewinn bedeuten, was hier natürlich widersinnig wäre, da in der Ökonomie Gewinne keiner Warnung bedürfen, sondern begrüßt werden. Die Gewinnwarnung warnt auch nicht vor Gewinn, sondern vor Verlust.
Ein anderes, ziemlich aktuelles Eigenschaftswort lautet systemisch. Es kam mit der aktuellen Finanzkrise in Umlauf und steht für die korrekte Adjektivbildung systembedingt und systemabhängig. Systemisch orientiert sich an dem Adjektiv polemisch, zu dem das Substantiv Polemik lautet und nicht etwa Polem. Die korrekte Ableitung von System heißt systematisch, was freilich etwas anderes beinhaltet als systembedingt und systemabhängig. Das Wort systemisch ist ähnlich blöde wie der gleichfalls im Finanzwesen tätige Analyst, der in korrektem Deutsch Analytiker heißen müsste und dessen Fehlleistungen unter anderem zu der gegenwärtigen Finanzkrise und der daraus folgenden Wirtschaftsdepression geführt haben.
Sprache ist die Materie des menschlichen Denkens. Falsches Sprechen bezeugt falsches Denken. Derart sind die Gewinnwarnungen der Analysten Resultat einer falschen Denke und ein systemisches Unglück.
Rolf Schneider stammt aus Chemnitz. Er war Redakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift "Aufbau" in Berlin (Ost) und wurde dann freier Schriftsteller. Wegen "groben Verstoßes gegen das Statut" wurde er im Juni 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, nachdem er unter anderem zuvor mit elf Schriftstellerkollegen in einer Resolution gegen die Zwangsausbürgerung Wolf Biermanns protestiert hatte. Veröffentlichungen u.a. "November", "Volk ohne Trauer" und "Die Sprache des Geldes". Rolf Schneider schreibt gegenwärtig für eine Reihe angesehener Zeitungen und äußert sich insbesondere zu kultur- und gesellschaftspolitischen Themen.
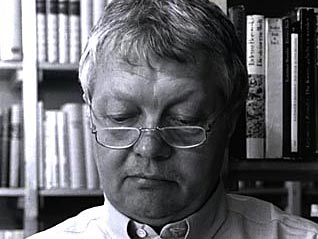
Rolf Schneider, Schriftsteller und Publizist© Therese Schneider