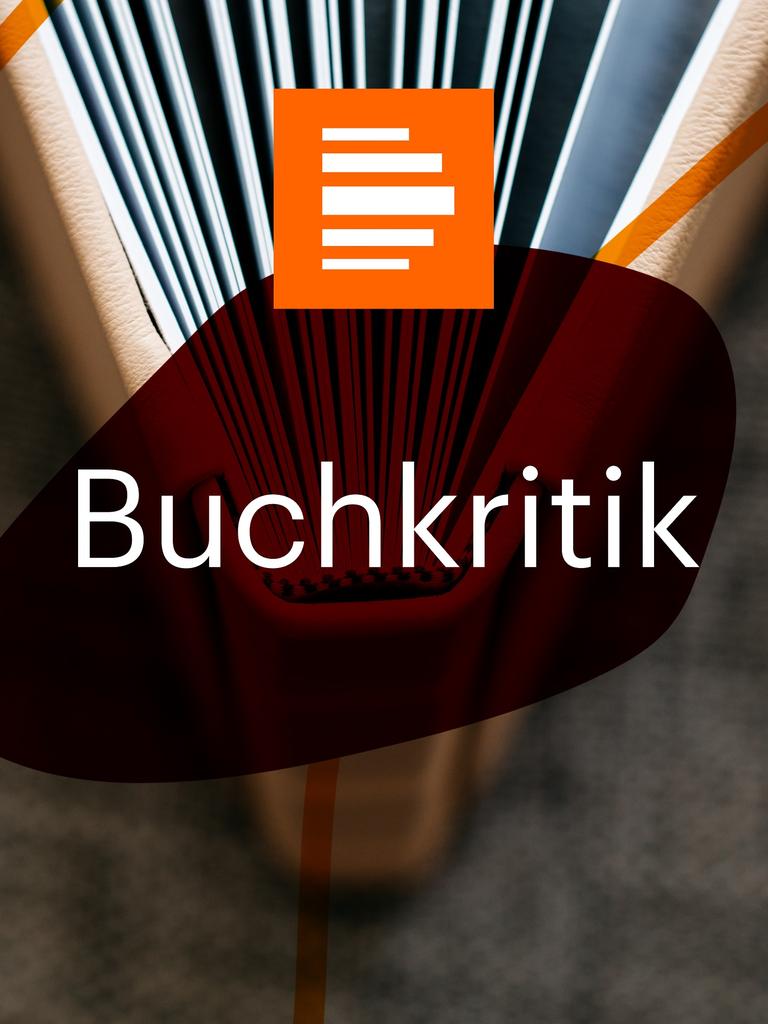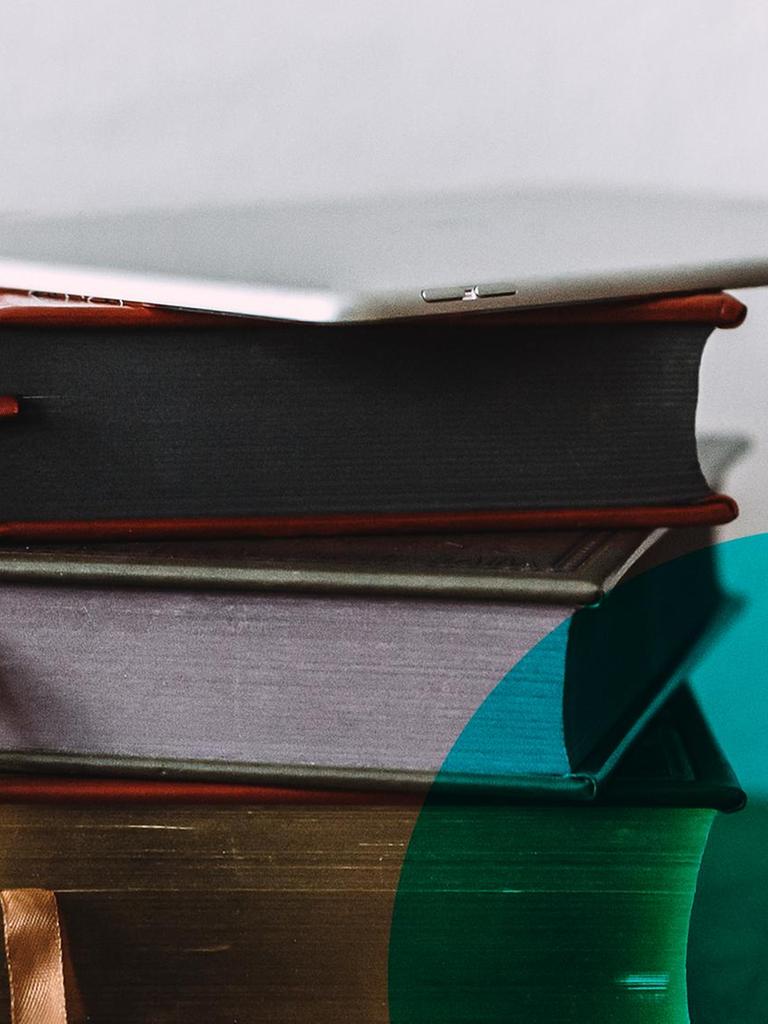Eva Illouz: „Der 8. Oktober“
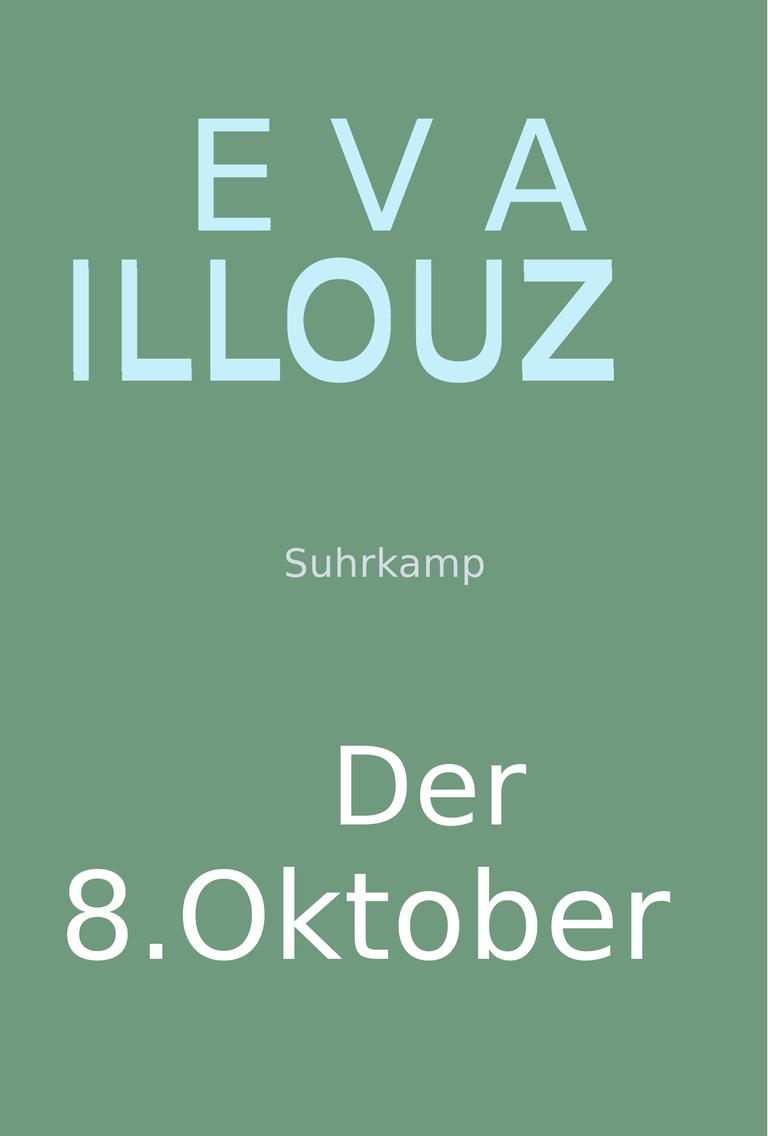
© Suhrkamp Verlag
Der vermeintlich tugendhafte Hass auf Israel
06:20 Minuten
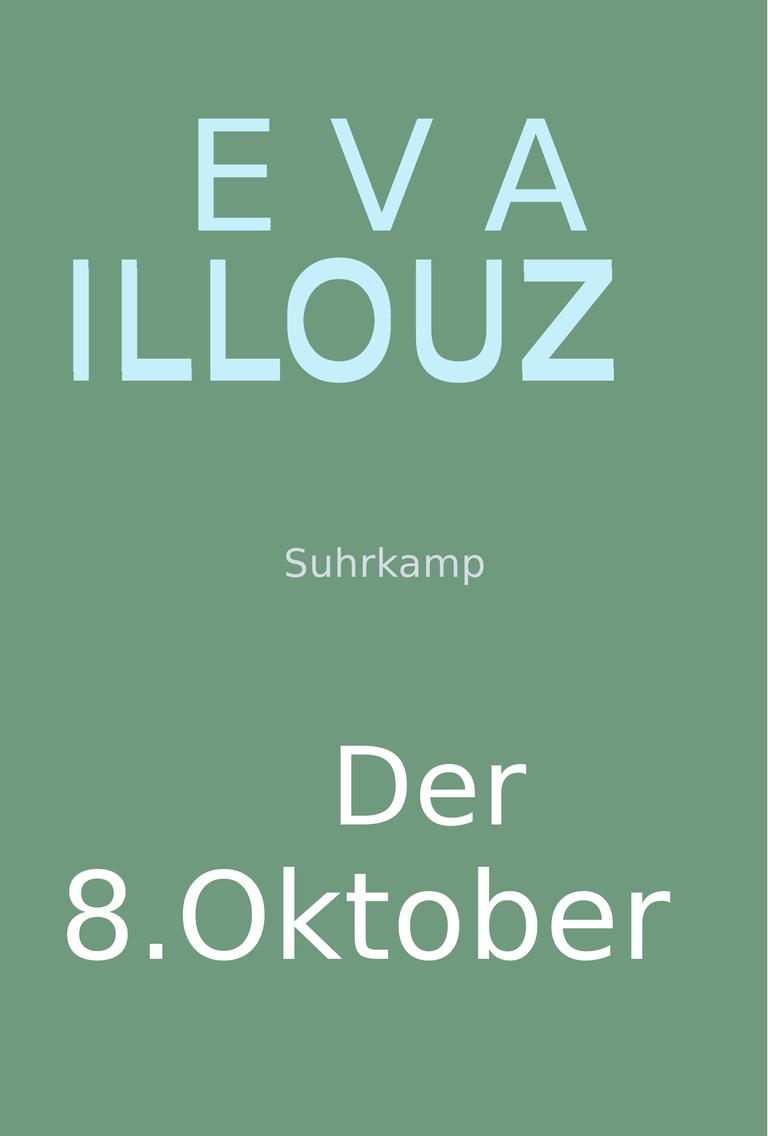
Eva Illouz, Aus dem Französischen von Michael Adrian
Der 8. OktoberSuhrkamp Verlag, Berlin 2025103 Seiten
12,00 Euro
Der 8.10.2023, also der Tag nach den Hamas-Massakern, steht für den Beginn einer Krise der globalen Linken, die in Teilen mit Freude auf die live gestreamten Grausamkeiten reagiert hat. Wie es dazu kommen konnte, erklärt der Essay von Eva Illouz.
Die Lage in Nahost ist verzweifelt seit dem Massaker, das die islamistische Hamas vor bald zwei Jahren an israelischen Zivilisten verübte: Der Krieg in Gaza wird von der Netanjahu-Regierung aus politischem Kalkül immer weiter verlängert und lässt sich selbst von Israels engsten Verbündeten kaum noch rechtfertigen. Braucht es angesichts dieser objektiv furchtbaren politischen Lage wirklich noch ein weiteres Buch, das sich mit den hämischen Reaktionen westlicher Linker auf die Massaker an Juden beschäftigt? Man könnte es bezweifeln.
Andererseits: Große Teile der westlichen Debatten haben eben auch nichts konkret mit der politischen Lage in Nahost zu tun, sondern sind eine Form der westlichen Selbstverständigung über die eigenen moralischen Standards. Und hier ist jeder kluge Blick auf die trüben Gewässer, die sich offenbart haben, willkommen.
Jubelrufe angesichts getöteter Babys
Das schmale Buch der französisch-israelischen Soziologin Eva Illouz bietet nun eine der hilfreichsten und klarsichtigsten Einordnungen der Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel ein akademisch etablierter und geschätzter westlicher Umweltwissenschaftler wie der Schwede Andreas Malm angesichts von live gestreamten Massenvergewaltigungen und vor laufender Kamera getöteten Babys in „Jubelrufe“ ausbrechen konnte.
Die Grundfrage, die sich eine linke Denkerin wie Illouz also stellt, und die auch viele andere Linke und Liberale umgetrieben hat seit dem Tag danach, lautet: Wie konnte ein Milieu, zu dessen zentralen Werten Empathie, Mitgefühl und Sensibilität zählen, manifeste Grausamkeiten wahlweise leugnen oder, schlimmer noch, feiern?
Der starke Fokus auf Machtkritik
Illouz sortiert die Lage großflächig mit Blick auf die drei Bereiche Geisteswissenschaften, US-amerikanische Zeitgeschichte und Kolonialismus/Postkolonialismus. Da sind zunächst die Geisteswissenschaften. Illouz betrachtet hier vor allem die US-amerikanischen Unis mit ihrem globalen Einfluss und spricht von einem „Denkstil“. Das ist eine vage, schwammige Kategorie, aber es geht ihr auch nicht um einzelne Äußerungen von einzelnen Denkerinnen, sondern um in den letzten Jahren wahrnehmbare Tendenzen und Strömungen.
Illouz bringt diese auf ein paar Schlagworte, die man einzeln durchaus kritisieren kann, die aber eindeutig etwas treffen. Eines davon ist das französische „pouvoirisme“ (von „pouvoir“, Macht), also der starke Fokus auf Machtkritik. Gut soziologisch ordnet Illouz das nicht nur in seiner theoretischen Herkunft ein, sondern betrachtet auch die begünstigenden sozialen Faktoren: den Rechtfertigungsdruck, unter dem Geisteswissenschaften heute stehen, sowie die Aussicht, durch solche Kritik moralisches Gewicht zu bekommen. Aber auch den Mechanismus, dass so etwas wie gesellschaftlicher Fortschritt nicht mehr wahrnehmbar ist, weil stets Macht kritisiert werden muss, und diese immer amorpher, unkonkreter und unhistorischer wird.
Opferkonkurrenz zwischen Juden und Schwarzen
Wie aber kommt es dann, dass sich dieser Denkstil nun ausgerechnet gegen Juden und Israel richtet? Hier wendet sich die Soziologin dem zweiten Bereich zu, der US-amerikanischen Zeitgeschichte. Illouz beschreibt das Aufbrechen der traditionellen Solidarität zwischen amerikanischen Juden und Afroamerikanern in Richtung einer Opferkonkurrenz und skizziert – das ist der dritte Bereich – die nach dem politischen Ende des westlichen Kolonialismus als wiederum sehr verallgemeinerte und abstrakte Theorie weiterlebende „Dekolonialität“. Sie ist in den USA teilweise zum zentralen Rahmen für das Verständnis von Sklaverei und Rassismus geworden. Mit der recht kontraintuitiven Folge, dass mittels einiger Übertragungsschritte Israel plötzlich als „weißer“ und „siedlerkolonialistischer“ Staat aufgefasst werden kann.
Interessant geht sie schließlich ein auf das im globalen Süden folgerichtige, an westlichen Universitäten aber eher erstaunliche und gerade in Frankreich teilweise recht fortgeschrittene Bündnis von Teilen der Linken mit absolut nicht progressiven islamischen und sogar islamistischen Akteuren.
All diese Faktoren, in diesem unglaublich dichten kleinen Buch so knapp wie stringent beschrieben, führen zu dem, was viele weiterhin mit Erstaunen wahrnehmen an westlichen Universitäten: ein „sich tugendhaft gebenden Hass auf Israel“. Man geht aus der Lektüre nicht ermutigt hervor, aber dankbar für den klaren, kenntnisreichen und schonungslosen Blick.