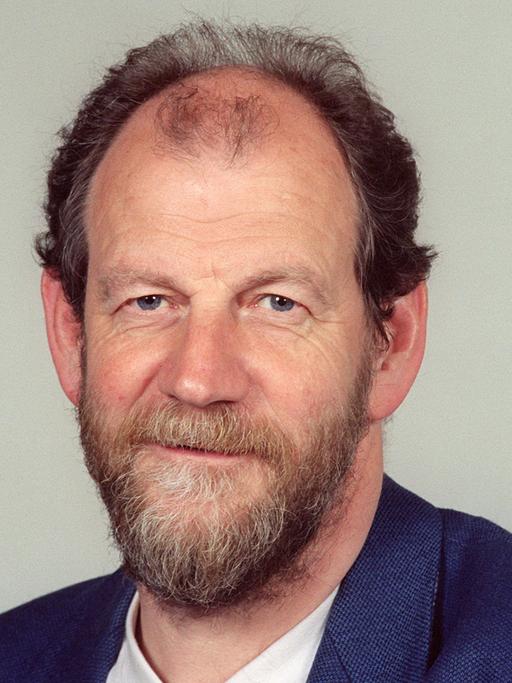"Die Menschen wissen nicht, was sie wählen"
Bei der Europawahl Ende Mai werden die großen Partei-Bündnisse erstmals mit Spitzenkandidaten um Wähler werben. Doch noch nie war der Widerstand gegen die EU größer als heute, sagt Michael Zürn.
Korbinian Frenzel: Wenn wie gestern und heute die 28 Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammenkommen, dann hat das ja immer so ein bisschen was Absolutistisches. Die wenigen Damen und vielen Herren regieren Europa. Sie tun es natürlich nicht, zumindest nicht alleine. Ein mächtiger Mitspieler ist das Europäische Parlament, seit 1979 von allen Bürgern der EU direkt gewählt. Im Mai ist die nächste Wahl, und die bringt ein Novum. Zum ersten Mal treten die wichtigen Parteienfamilien mit europäischen Spitzenkandidaten an. Europa kriegt also Gesichter. Nur, was bringt's, vor allem in Zeiten wie diesen, in denen die EU alles in allem alles andere als geliebt wird. Michael Zürn ist am Telefon; er ist Direktor der Abteilung beim Wissenschaftszentrum Berlin, die sich mit dem Regieren jenseits des Nationalstaates befasst. Einen schönen guten Morgen!
Michael Zürn: Schönen Morgen!
Frenzel: Sie müsste ja spannender sein als je, diese Europawahl, und dann schaut man auf die Umfragen, und die Deutschen zumindest zeigen minimales Interesse – warum?
Zürn: Es ist nach wie vor so, dass die Menschen nicht wissen, was sie eigentlich wählen, wenn sie in Europa wählen. Während wir seit zehn, fünfzehn Jahren an vielen Punkten zeigen können, dass Europa als wichtiger angesehen wird, als eine wichtige politische Institution angesehen wird, die mindestens so wichtige Entscheidungen trifft wie der Nationalstaat, das denken viele, das denken die meisten, aber umgekehrt ist im selben Zeitraum die Wahlbeteiligung immer wieder gesunken. Warum? Weil man einfach nicht weiß, was man mit einer solchen Europawahl bewirken soll. Insofern ist die Benennung von Spitzenkandidaten der richtige Schritt. Allerdings geht es natürlich darum, dass irgendwann dieses Europaparlament tatsächlich den Kommissionspräsidenten zu bestimmen hat, und dass das vorab feststeht, welche Koalition von Parteien für welchen Kommissionspräsidenten stehen.
"Ausmaß an Kritik, wie es noch nie da war"

Martin Schulz, Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der Europawahl© AFP/PATRICK HERTZOG
Frenzel: Aber vielleicht liegt diese Zurückhaltung ja auch an der Tatsache, dass wir immer so das Gefühl haben, entweder man ist für Europa, und das heißt dann für Brüssel mit allem drum und dran, oder man ist böser Renationalist, will eigentlich alles wieder auf den Nationalstaat heben. Ist das die einzige Alternative, die sich gerade bietet?
Zürn: Nein, natürlich ist es das nicht. Es geht ja, oder sollte in einem Europaparlament vor allem um die Frage gehen, welche Politik Europa macht. Aber selbst mit Schulz und Juncker niemand so recht weiß, für welche Politiken die eigentlich stehen. Und wenn man dann auch ihre konkreten Reden beobachtet, dann sind das Reden pro Europa, pro Europäisches Parlament, aber nicht für eine bestimmte Politik. Und deshalb wird der ganze Rahmen geschaffen, der dann heißt, Europawahl ist eine Abstimmung für oder gegen Europa. Und das ist falsch. Es muss darum gehen, dass darüber abgestimmt wird, welche Politik wir in Europa bekommen.
Frenzel: Sie haben die beiden genannt, Martin Schulz, der ja für die Sozialdemokraten antritt, Jean-Claude Juncker für die Christdemokraten, der frühere luxemburgische Premierminister. Beide sind ja wirklich echte, überzeugte Herzenseuropäer, und beide haben aber diesen Ton der Renationalisierung angeschlagen. Ist das gerade der Grundton, den wir verspüren, selbst bei Europa-Befürwortern?
Zürn: Es ist natürlich so, dass wir ein Ausmaß an Kritik, an Widerstand, an politischer Organisation gegen Europa haben, wie es noch nie da war. Und durch solche vorsichtigen, in diesen beiden Fällen extrem vorsichtigen Töne einer Renationalisierung soll diese Entwicklung aufgegriffen werden. Es wird eben sozusagen symbolisch festgehalten, dass niemand die europäischen Nationalstaaten und Nationen abschaffen möchte. Damit wird einer vermuteten Entwicklung und Tendenz in der Bevölkerung entgegengekommen. Allerdings sollte man immer nicht vergessen, dass wir in der Tat eine wachsende Europa-Skepsis haben, allerdings natürlich auch vieles darauf hindeutet, dass Europa noch viel stärker geworden ist, dass die europäischen Institutionen als Folge der Krise viel mehr Kompetenzen haben als vorher, dass fast alle Interessengruppen sich inzwischen nach Brüssel wenden als eine Form der politischen Mobilisierung und Interessensorganisation, dass, wie gesagt, viele Menschen davon ausgehen, dass auf europäischer Ebene die wichtigen Entscheidungen getroffen werden, und nicht auf nationaler. Und insofern haben wir eine doppelte, für mehr Europa, ein stärkeres Europa, ein höheres Bewusstsein von Europa einerseits, aber dann andererseits eine starke Infragestellung der europäischen Ebene.
"Wir haben noch längst keine europäische Offenheit"
Frenzel: Aber es bleibt ja doch irgendwie, und ich möchte unsere Medien da gar nicht ausnehmen, so ein bisschen die Situation, dass wir Politik ganz gern in unserem nationalen, in unserem Sprachraum wahrnehmen. Glauben Sie denn, dass sich daran etwas ändern kann?
Zürn: Ich meine, zum einen habe ich auch den Eindruck, dass Medienpolitik et cetera diese Grundüberzeugung, die Wähler wollen nichts hören, was zu kompliziert wird und zur Außenpolitik geht. Die Überzeugung der Chefredakteure, schreib am besten nicht über Außenpolitik, das interessiert niemanden, das verkauft sich nicht. An der Stelle wäre tatsächlich auch mal sorgfältig zu prüfen, inwieweit das sozusagen ein inzwischen eigentlich überholter Mythos ist, und inwieweit er sich tatsächlich noch trägt. Wir haben da relativ wenig gesichertes Wissen darüber. Ich jedenfalls hätte meine Zweifel, dass das immer noch in dem vermuteten Ausmaße der Fall ist. Das ändert natürlich nichts daran, dass wir längst noch keine europäische Öffentlichkeit haben, längst noch keine politischen Debatten über Grenzen hinweg, die die nationale politische Öffentlichkeit – mit denen vergleichbar sind. Aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr langwieriger Prozess, der auch innerhalb des Nationalstaates sehr, sehr lange gedauert hat, bis sich da etablierte Strukturen entwickelt haben.
Frenzel: Wenn wir jetzt noch mal diese Spitzenkandidaten angucken – zwei haben wir genannt, Schulz und Juncker. Dann gibt es noch für die Liberalen Guy Verhofstadt, den früheren belgischen Premierminister. Die kommen eigentlich alle aus einer Ecke. Politisch alles Brüssel-Gewächse, sogar geografisch, Flandern, Aachen, Luxemburg – man könnte böse sagen, die repräsentieren wunderbar das Europa von 1957 mit sechs Mitgliedern. Aber sprechen die eigentlich auch irgend jemanden in Bulgarien oder Großbritannien an? Können sie das, oder ist das alles zu klein, wie wir es denken, dieses Kerneuropa?
Zürn: Na, dieses Europa hat ein politische Zentrum entwickelt, und die drei kommen aus diesem politischen Zentrum der EU. Das ist ein Hinweis darauf, dass das nicht gewachsene, von unten aus Parteistrukturen entwickelte Kandidaten sind, sondern tatsächlich sie in Europa aus dem unmittelbaren Brüsseler politischen System stammen. Und von daher natürlich die Funktion Spitzenkandidaten zu sein, die für eine bestimmte Politik, möglicherweise auch für die Interessen einer bestimmten Region teilweise mit stehen, dass die das natürlich nicht erfüllen können.
Frenzel: Michael Zürn, Professor für Politikwissenschaft, Direktor am Wissenschaftszentrum Berlin. Ich danke Ihnen für das Gespräch!
Zürn: Danke schön!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.