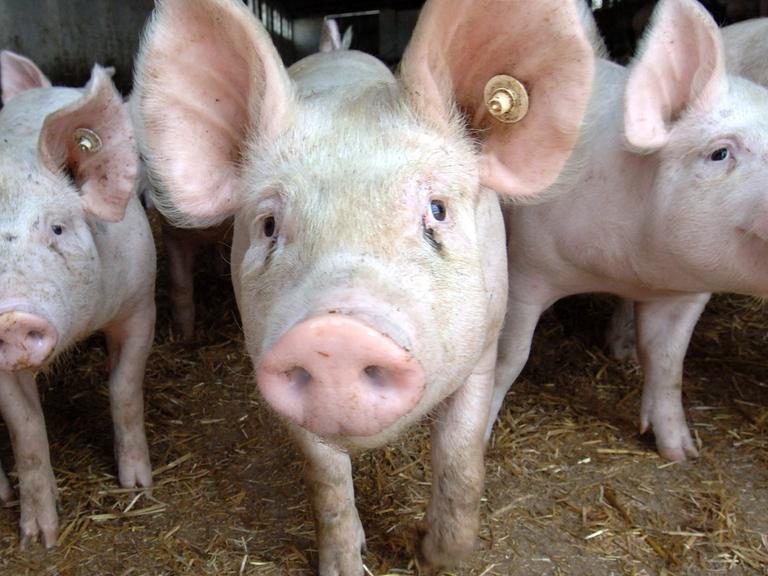Steuergelder für die Pharmaindustrie

2,5 Milliarden Euro europäischer Steuergelder umfasst der Etat der "Innovative Medicines Initiative". Die Pharmabranche steuert den selben Betrag bei. Ein journalistisches Team fand heraus: Die Pharmaindustrie nutzt die Steuergelder im Sinne ihrer eigenen Interessen.
Es klingt nach einer richtig guten Idee – die EU-Kommission stößt ein "Open Innovation Projekt" an, in dem dringend benötigte Medikamente und Therapien entwickelt werden.
Hinter diesem Konzept der geöffneten Innovation steckt ein simpler wie einleuchtender Gedanke: Gerade in den Naturwissenschaften wird Wissen immer spezialisierter. Weil ein Unternehmen aber immer nur begrenzt viel Spezialwissen hervorbringen kann, stehen die Chancen für Innovation am besten, wenn unterschiedliche Institutionen ihr Wissen teilen.
Hochschulen, kleinere Institute und Pharmakonzerne, alle zusammen nehmen also Teil an diesem Open Innovation Projekt, vernetzen sich, sollen gegenseitig voneinander profitieren – über 1000 verschiedene Akteure machen mit.
So soll dort ein wahrer Innovationsschub entstehen, wo die Medikamentenforschung heute oft noch ratlos oder tatenlos ist – bei Krankheiten wie Krebs, Malaria oder Tuberkulose.
An den Start gegangen ist die "Innovative Medicines Initiative", kurz IMI, 2008. Und für so ein vielversprechendes Projekt ist die EU-Kommission bereit, Geld in die Hand zu nehmen: 2,5 Milliarden Euro Steuergelder umfasst ihr Etat. Denselben Betrag steuert die Pharmaindustrie in Form von Sachleistungen bei – durch die Bereitstellung von Laboren zum Beispiel.
Was also hat die IMI in den letzten Jahren aus ihren Plänen gemacht? Diese Frage hat sich ein journalistisches Rechercheteam gestellt – sechs Monate lang haben sie Akten aufgetrieben, Zahlen studiert, Interviews geführt.
Ihr zentrales Ergebnis: Die an der IMI beteiligte Pharmaindustrie nutzt die Steuergelder im Sinne ihrer eigenen Interessen.
Nicola Kuhrt, Wissenschaftsjournalistin vom Magazin Spiegel: "In großen Teilen wird erforscht, was für die Industrie dann später auch verwertbar ist, also das ist Krebs, Diabetes; aber Tuberkulose, Malaria – diese ganzen vernachlässigten Krankheiten, die werden nicht erforscht"
Wie kann das sein? Angeblich wegen ihrer komplexen Struktur als groß angelegte öffentlich-private-Initiative wurde die IMI aus dem Verwaltungsapparat der EU ausgegliedert, als eigene Institution gegründet. Die Einrichtung des Projektes hat die EU-Kommission dabei voll und ganz der EFPIA überlassen - dem Verband der Europäischen Pharmakonzerne.
Herausgekommen ist eine Organisationsstruktur, die Forschern aus Hochschulen und kleineren Unternehmen kaum Mitspracherechte einräumt:
"Es ist ein Problem, dass Hochschulen und kleinere Institute keinen Einfluss darauf haben, was erforscht wird, und sich oft dem auch anschließen müssen, weil IMI ein so großes Projekt ist in den Lebenswissenschaften, dass es schon auch Pflicht ist da irgendwie auch mit zu machen, aber den Hochschulen bringt es oftmals gar nichts bzw. sie zahlen sogar drauf, um mitmachen zu können."
Die IMI hat zwar einen wissenschaftlichen Beirat – doch dessen Stimme wird erst gehört, wenn die Forschungsprojekte geplant, ihre Anträge bereits eingereicht sind. So verfügt die Pharma-Vertretung nicht nur über die Agenda der Forschungskooperation, sondern bestimmt auch über die Projekt-Budgets für die Hochschulen und kleineren Institute.
Mit den IMI-Geldern ist auch der Haushalts-Kontroll-Ausschuss des Europäischen Parlaments befasst. Dessen Vorsitzende ist Inge Gräßle von der CDU.
IMI hüllt sich in Intrasparenz
Als Vertreterin der steuerzahlenden Öffentlichkeit versucht sie seit Jahren Einblick in die Haushaltsvorgänge der IMI zu bekommen – mit mäßigem Erfolg. Denn die Pharmaindustrie gibt nur eine Gesamtkalkulation ab. Aus der geht nicht hervor, welcher Konzern mit welchen Leistungen an einem bestimmten Projekt beteiligt ist. Einsehbar ist auch nicht, wer über die Vergabe der Fördermittel entscheidet. Inge Gräßle besteht deswegen auf die Einführung einer Auskunftspflicht:
"Die Transparenzvorschriften, die wir brauchen, bestehen natürlich darin, dass diejenigen, die über Fördermittel entscheiden, dass die offenlegen, welche Beziehung sie zu den möglichen Empfängern haben. Ich möchte nicht, dass da Leute eingeschaltet werden, deren einzige Existenzberechtigung ist, das Geld ins eigene Haus zu schaufeln – das geht nicht. Deswegen müssen hier die Dinge offengelegt werden."
Mehr Transparenz wird noch von anderer Seite gefordert. David Hammerstein ist gesundheitspolitischer Experte bei der Nichtregierungsorganisation Trans Atlantic Consumer Dialogue. Er kritisiert, dass die Forschungsergebnisse der IMI weder für alle Projektteilnehmer noch für die Öffentlichkeit verfügbar sind. Am Ende könnten die Pharmakonzerne mit Hilfe des Projekts teure und noch dazu patentierte Medikamente auf den Markt bringen. So würde Steuergeld in Wissen umgesetzt, dieses Wissen aber nahezu ausschließlich von der Pharmaindustrie angeeignet und zu Geld gemacht:
"Wir brauchen klare Datenregeln in öffentlich-rechtlichen Kooperationen, die sicherstellen, dass die Daten frei zugänglich sind oder geteilt werden. Wir brauchen freien Zugang zu wissenschaftlichen Artikeln. Im Gegensatz dazu wurde die IMI von allen Open Data Regeln ausgenommen, die für andere Bereiche der EU gelten. Das ist ziemlich schockierend."
Es lässt sich also eine niederschmetternde Zwischenbilanz ziehen: Die IMI subventioniert die Pharmaindustrie mit Steuergeldern, hüllt sich in Intransparenz und privatisiert die Forschungsresultate.
Mit diesen Ergebnissen konfrontiert, gibt die EU-Kommission ein Statement heraus. Darin heißt es schlicht:
"Auf Grundlage des WHO Berichts zu vorrangig benötigten Medikamenten in Europa und der Welt konzentriert die IMI ihre Arbeit auf die großen Herausforderungen öffentlicher Gesundheit. [...] Seit Beginn der Initiative zur innovativen Medizin werden die Mittel von Seiten der Pharmakonzerne in Übereinstimmung mit den ursprünglichen Zielen verwendet."
Welches Fazit muss man nun aber aus diesem Pilotprojekt ziehen? Zeigt sich am Beispiel der IMI, dass die Idee eines geöffneten Innovationsprozesses im Rahmen von öffentlich-privaten Forschungs-Kooperationen grundsätzlich zum Scheitern verurteilt ist?
"Wenn ich neue Projekte dieser Art verhindern könnte, dann würde ich es tun",
meint die CDUlerin Inge Gräßle mit Blick auf die privat-öffentliche Organisationsform, denn:
"PPPs haben einen inhärenten Interessenkonflikt – der sagt ganz klar, dass sie natürlich als Teil der Industrie sehr viel industrienäher arbeiten als steuerzahlernah und daraus ergibt sich ein Konflikt, der quasi nicht aufzulösen ist."
David Hammerstein hingegen hält sie für unersetzbar:
"Wir brauchen privat öffentliche Kooperationen, um Marktversagen der Industrie auszugleichen – zum Beispiel bei Antibiotikaresistenzen, mit Blick auf bezahlbare Hepatitis C- und Krebs- Medikamente oder um im globalen Süden vernachlässigte Krankheiten wie Malaria zu erforschen, an denen sonst nicht geforscht wird. Aber bislang fehlen die Bedingungen, die Regeln in diesen Kooperationen, um auch für die Öffentlichkeit einen Mehrwert sicherzustellen."
Pharmaunternehmen forschen da, wo das Geld winkt
Privat-Öffentliche Kooperationen können nämlich Brücken zwischen dem Allgemeinwohl und den nötigen Mitteln schlagen. Pharmaunternehmen sind finanzstark, forschen aber vor allem dort, wo das meiste Geld winkt. Sind die potentiellen Kunden bzw. Patienten zahlungsschwach – wie zum Beispiel bei Malaria oder Ebola – ist auch der Anreiz klein. Universitäten hingegen sind dem Allgemeinwohl sehr viel mehr verbunden, verfügen aber oft nicht über die finanzielle Ausstattung, großangelegte Forschungsprojekte alleine zu stemmen.
Wie nun aber dafür sorgen, dass die großen Konzerne in Open Innovation Prozessen das neu gewonnene Wissen nicht alleine abschöpfen? David Hammerstein sieht da einen Weg:
"Die Lösung liegt darin, die Forschungs- und Entwicklungskosten zu trennen vom letztlichen Medikamenten-Preis. Diese Idee wird von Ökonomen und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt unterstützt – einschließlich von denen der WHO. Man würde also andere Anreize nutzen – seien es Innovationspreise, Patent-Pools, Open Data Zusammenarbeit oder sozialverantwortliche Lizenzvergaben – Anreize, bei denen die öffentlichen Investitionen in den Endprodukten gespiegelt werden, so dass alle davon profitieren."
Mit anderen Daten- und Lizenzrechten würde verhindert, dass öffentliche Gelder in die Entwicklung von Medikamenten fließen, die sich ihre Empfänger kaum oder gar nicht leisten können. So wäre sichergestellt, dass geteiltes Wissen auch zu geteilten Ergebnissen führt.
Um diese Vorschläge wahr werden zu lassen, ist aber noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Nicht nur bei der Pharmaindustrie, auch in der EU. Und in der IMI müssten die Projektteilnehmer erst einmal zu gleichberechtigten Partnern gemacht werden.
Und so ziehen Nicola Kuhrt, Inge Gräßle und David Hammerstein gemeinsam einen ambivalenten Schluss: Open Innovation bitte gerne, aber mit demokratischer Kontrolle.