Erzählte Welt
Angeblich lügen wir durchschnittlich 200 Mal am Tag. Dahinter müsse kein böser Wille stecken, meint der Soziologe Sebastian Wessels.
Erzählungen ordnen die Welt. Wer etwas erlebt, macht eine Erzählung daraus. Dazu greift er eine kleine, überschaubare Auswahl von Aspekten des Erlebten heraus und verknüpft sie so, dass sie eine strukturierte Geschichte ergeben – mit Anfang, Mittelteil und Schluss. Dieses Auswählen und Verknüpfen ist immer ein kreativer Prozess, egal wie genau wir beobachten oder wie wahrheitsgetreu wir berichten wollen.
Dass man dieses Erzählhandwerk erst lernen muss, wird deutlich, wenn wir Kindern im Grundschulalter zuhören. Ihnen fehlt noch das Fingerspitzengefühl bei der Auswahl und Zusammenstellung des Materials. Sie beschränken ihre Erzählungen noch nicht auf das, was wesentlich oder dramaturgisch notwendig ist. Kinder sind verbale Expressionisten. Die konventionellen Erzählformen kommen erst später.
Erzählungen ordnen die Welt – aber nur, solange nicht mehrere davon aufeinandertreffen. Nach einem simplen Auffahrunfall zum Beispiel werden die Beteiligten, jeder für sich, das Erlebte schnell in einer Geschichte verarbeiten. Meist vergeht kein Tag, bevor sie sie mindestens einmal erzählt haben. Wenn der Fall nun aber vor Gericht endet und dort, sagen wir, zwei Beteiligte und drei Zeugen gehört werden, kann es leicht passieren, dass fünf verschiedene Erzählungen im Spiel sind. Dann tritt deren kreativer Charakter zutage – auch wenn die Zeugen und Beteiligten das wohl nur bei den jeweils anderen zugeben würden.
Das Gericht behilft sich nun seinerseits mit einer Erzählung, die von der Glaubwürdigkeit der aufgenommenen Aussagen handelt, und schreibt das offizielle Ende. Das wiederum wird noch einmal umformuliert, wenn die Prozessparteien und Zeugen zu Hause davon erzählen. Die Autobiografie hat ein neues Kapitel: ‘Als ich einmal einen Unfall hatte’.
Auch in der Politik konkurrieren verschiedene Erzählungen um offizielle Gültigkeit. Angela Merkel erzählt von verfehlter Wirtschaftspolitik in verschuldeten Euro-Ländern, die sich nun zusammenreißen müssten, um im Gegenzug Unterstützung zu erhalten. Der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück erzählt von Bankenexzessen, für die man nicht immer wieder mit "Staatsknete" einspringen dürfe.
Wenn eine dieser Erzählungen allgemeine Akzeptanz findet, hat das Folgen, und deswegen wird um sie gekämpft. Gleichzeitig zeichnen Merkel und Steinbrück mit solchen Erzählungen ein Bild von sich selbst. Merkel tritt als disziplinierte Verteidigerin deutschen Geldes gegen den südeuropäischen Schlendrian auf, Steinbrück als moderat kapitalismuskritischer Sozialdemokrat.
Beide Erzählungen sind für Deutschland gemacht und funktionieren hier, weil sie die Krise auf allgemeinverständliche Formeln reduzieren. Aus denen wiederum lassen sich Lösungen ableiten, die den deutschen Lebensstandard nicht antasten. Man könnte es für ein unverschämtes Glück halten, dass uns so simple Antworten auf die komplizierte Krise in den Schoß fallen. Es ist aber kein Glück, sondern liegt daran, dass Merkel und Steinbrück wie wir alle beim Erzählen zunächst einmal eine große künstlerische Freiheit genießen und die auch nutzen.
Diese Freiheit hat allerdings eine Kehrseite. Hat man sich nämlich einmal für eine Erzählung entschieden - dass etwa Griechenland "die Hausaufgaben machen" müsse -, ist man, in diesem Fall Merkel, mehr oder weniger darauf festgelegt. Wer A sagt, muss auch B sagen.
Nach einer Weile geht es gar nicht mehr darum, ob die ursprüngliche Entscheidung richtig war. Denn nun kann man diese Erzählung nicht mehr verwerfen, ohne sich vor der ganzen Welt unrettbar unglaubwürdig zu machen. Und ohne mangels des ordnenden Prinzips der Erzählung womöglich selbst die Orientierung zu verlieren.
Damit das nicht mit der ganzen EU passiert, falls der Euro scheitert, wird nun immer wieder betont, Europa lebe doch von mehr als nur der gemeinsamen Währung. Das ist der Versuch, Erzählungen zu stärken, die bei einem Zusammenbruch der Währungsunion nicht mit zusammenbrächen. Dazu allerdings müsste man diese europäischen Geschichten eben wirklich erzählen, statt nur in Randnotizen zur Euro-Rettung darauf zu verweisen, dass es sie gibt.
Sebastian Wessels, geboren 1976 in Bremen, studierte Sozialwissenschaften in Hannover und Cardiff (Wales). Seit 2009 arbeitet er im Forschungsprojekt "Autonomie - Handlungsspielräume des Selbst" am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI). Gemeinsam mit Harald Welzer stellte er im September 2011 in der Zeitschrift "Merkur" erstmals Ergebnisse des Projekts vor. Neben der Konformitätsforschung gehören Gesellschaftstheorie und Nachhaltigkeit/Klimawandel zu seinen Arbeitsschwerpunkten.
Dass man dieses Erzählhandwerk erst lernen muss, wird deutlich, wenn wir Kindern im Grundschulalter zuhören. Ihnen fehlt noch das Fingerspitzengefühl bei der Auswahl und Zusammenstellung des Materials. Sie beschränken ihre Erzählungen noch nicht auf das, was wesentlich oder dramaturgisch notwendig ist. Kinder sind verbale Expressionisten. Die konventionellen Erzählformen kommen erst später.
Erzählungen ordnen die Welt – aber nur, solange nicht mehrere davon aufeinandertreffen. Nach einem simplen Auffahrunfall zum Beispiel werden die Beteiligten, jeder für sich, das Erlebte schnell in einer Geschichte verarbeiten. Meist vergeht kein Tag, bevor sie sie mindestens einmal erzählt haben. Wenn der Fall nun aber vor Gericht endet und dort, sagen wir, zwei Beteiligte und drei Zeugen gehört werden, kann es leicht passieren, dass fünf verschiedene Erzählungen im Spiel sind. Dann tritt deren kreativer Charakter zutage – auch wenn die Zeugen und Beteiligten das wohl nur bei den jeweils anderen zugeben würden.
Das Gericht behilft sich nun seinerseits mit einer Erzählung, die von der Glaubwürdigkeit der aufgenommenen Aussagen handelt, und schreibt das offizielle Ende. Das wiederum wird noch einmal umformuliert, wenn die Prozessparteien und Zeugen zu Hause davon erzählen. Die Autobiografie hat ein neues Kapitel: ‘Als ich einmal einen Unfall hatte’.
Auch in der Politik konkurrieren verschiedene Erzählungen um offizielle Gültigkeit. Angela Merkel erzählt von verfehlter Wirtschaftspolitik in verschuldeten Euro-Ländern, die sich nun zusammenreißen müssten, um im Gegenzug Unterstützung zu erhalten. Der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück erzählt von Bankenexzessen, für die man nicht immer wieder mit "Staatsknete" einspringen dürfe.
Wenn eine dieser Erzählungen allgemeine Akzeptanz findet, hat das Folgen, und deswegen wird um sie gekämpft. Gleichzeitig zeichnen Merkel und Steinbrück mit solchen Erzählungen ein Bild von sich selbst. Merkel tritt als disziplinierte Verteidigerin deutschen Geldes gegen den südeuropäischen Schlendrian auf, Steinbrück als moderat kapitalismuskritischer Sozialdemokrat.
Beide Erzählungen sind für Deutschland gemacht und funktionieren hier, weil sie die Krise auf allgemeinverständliche Formeln reduzieren. Aus denen wiederum lassen sich Lösungen ableiten, die den deutschen Lebensstandard nicht antasten. Man könnte es für ein unverschämtes Glück halten, dass uns so simple Antworten auf die komplizierte Krise in den Schoß fallen. Es ist aber kein Glück, sondern liegt daran, dass Merkel und Steinbrück wie wir alle beim Erzählen zunächst einmal eine große künstlerische Freiheit genießen und die auch nutzen.
Diese Freiheit hat allerdings eine Kehrseite. Hat man sich nämlich einmal für eine Erzählung entschieden - dass etwa Griechenland "die Hausaufgaben machen" müsse -, ist man, in diesem Fall Merkel, mehr oder weniger darauf festgelegt. Wer A sagt, muss auch B sagen.
Nach einer Weile geht es gar nicht mehr darum, ob die ursprüngliche Entscheidung richtig war. Denn nun kann man diese Erzählung nicht mehr verwerfen, ohne sich vor der ganzen Welt unrettbar unglaubwürdig zu machen. Und ohne mangels des ordnenden Prinzips der Erzählung womöglich selbst die Orientierung zu verlieren.
Damit das nicht mit der ganzen EU passiert, falls der Euro scheitert, wird nun immer wieder betont, Europa lebe doch von mehr als nur der gemeinsamen Währung. Das ist der Versuch, Erzählungen zu stärken, die bei einem Zusammenbruch der Währungsunion nicht mit zusammenbrächen. Dazu allerdings müsste man diese europäischen Geschichten eben wirklich erzählen, statt nur in Randnotizen zur Euro-Rettung darauf zu verweisen, dass es sie gibt.
Sebastian Wessels, geboren 1976 in Bremen, studierte Sozialwissenschaften in Hannover und Cardiff (Wales). Seit 2009 arbeitet er im Forschungsprojekt "Autonomie - Handlungsspielräume des Selbst" am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI). Gemeinsam mit Harald Welzer stellte er im September 2011 in der Zeitschrift "Merkur" erstmals Ergebnisse des Projekts vor. Neben der Konformitätsforschung gehören Gesellschaftstheorie und Nachhaltigkeit/Klimawandel zu seinen Arbeitsschwerpunkten.
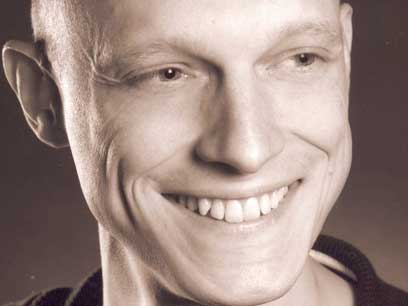
Sebastian Wessels© privat