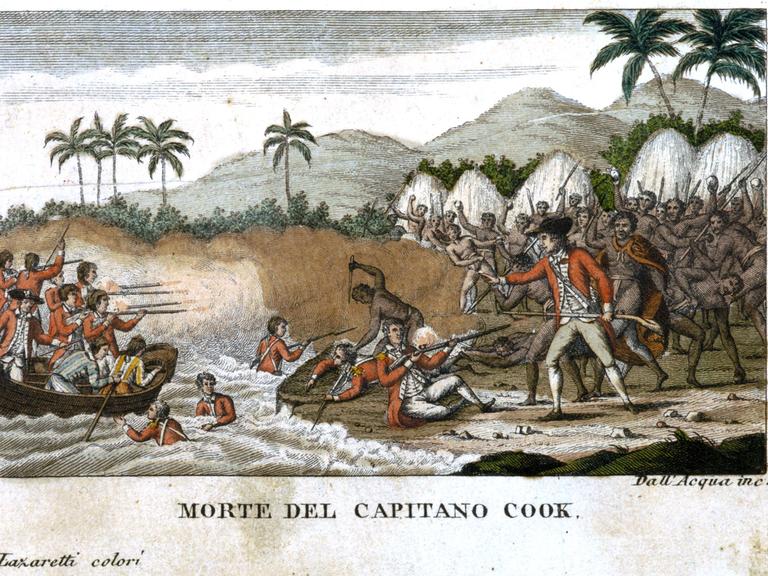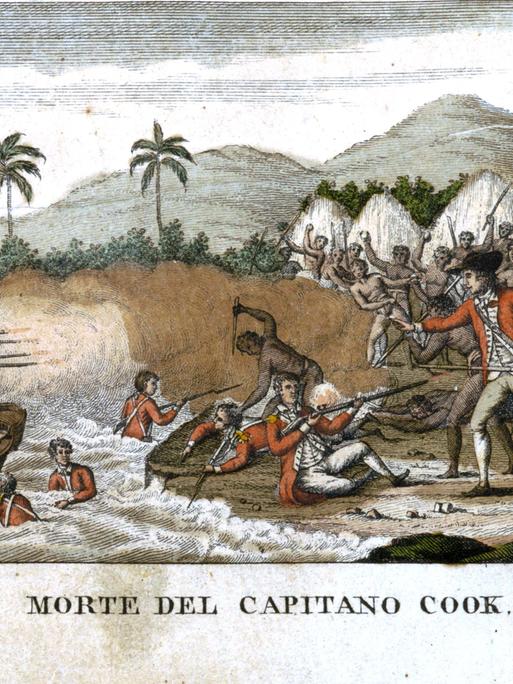Erika Fatland: "Seefahrer""
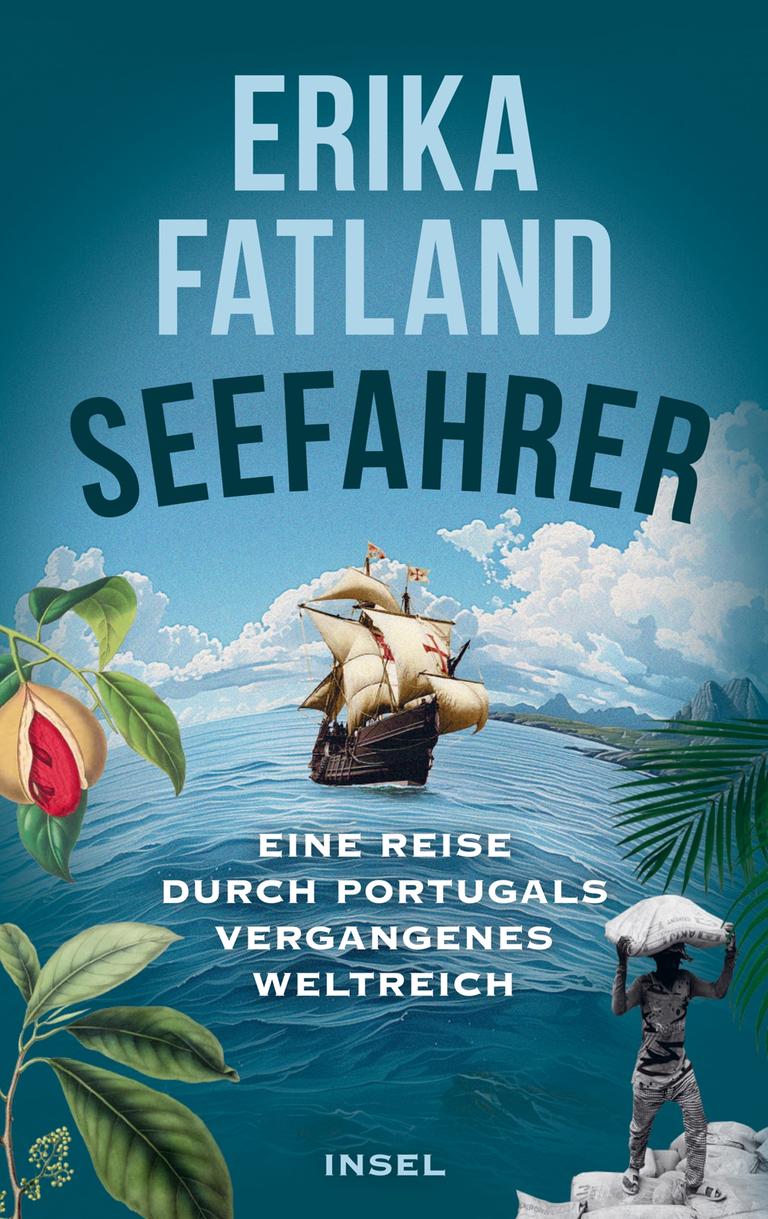
© Insel-Verlag
Präziser Blick auf das heutige Leben in ehemaligen Kolonien
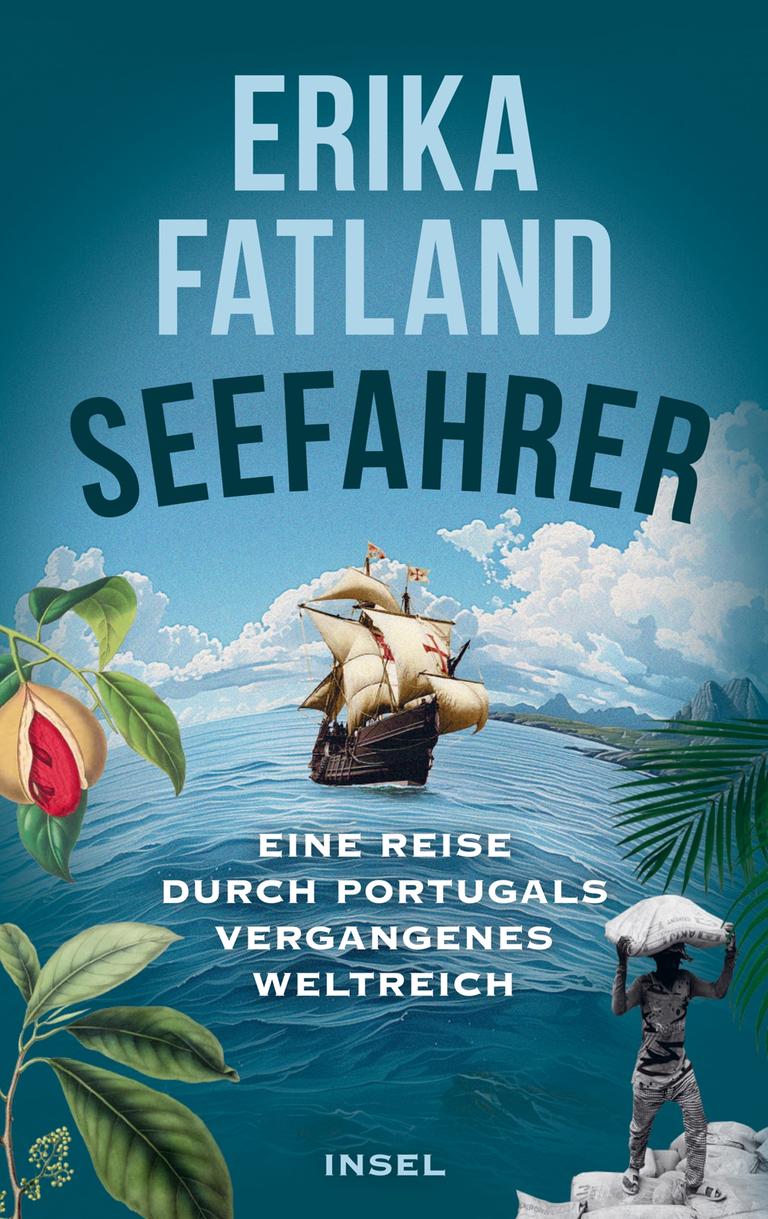
Fatland, Erika
Stilzebach, Daniela
Seefahrer. Eine Reise durch Portugals vergangenes WeltreichInsel, Berlin 2025751 Seiten
30,00 Euro
Die Autorin und Forscherin Erika Fatland war unterwegs auf den Spuren der portugiesischen Seefahrer. Im 15. und 16. Jahrhundert umsegelten sie die Erde, gründeten Kolonien, beherrschten weite Teile der Handelswege. Ihr Buch ist ein Lesegenuss.
Das portugiesische Königshaus, insbesondere Prinz Heinrich, der den Beinamen „der Seefahrer“ trug, war die treibende Kraft hinter den Entdeckungsreisen. Er finanzierte im 15. Jahrhundert die ersten Expeditionen auf der Suche nach den Gewürzinseln; Expeditionen, die man auch und vielleicht eher als von Gier getriebene Raubzüge bezeichnen könnte.
Denn die Küstenbezeichnungen der Portugiesen in Westafrika waren eindeutig: Die Pfefferküste lag in Liberia, die Elfenbeinküste im heute noch so heißenden Staat, die Goldküste in Ghana und die Sklavenküste in den Staaten Togo, Benin und Nigeria. Als die Portugiesen schließlich an der Küste Indiens landeten, antworteten sie auf die Frage einheimischer Händler, was sie dort wollten: „Wir suchen Christen und Gewürze!“ Letztlich ging es darum, Handelsmonopole durchzusetzen.
Historie und aktuelle Reportage
Erika Fatland, die für ihr Buch unter anderem per Schiff nach Guinea-Bissau, Angola und Mosambik, Goa, Malakka, Indonesien, Osttimor, Japan und Brasilien reiste, erzählt flüssig; schreibt zugleich sehr genau über die historischen Fakten der portugiesischen Entdeckergeschichte und räumt so auch mit einigen Mythen wie dem von einer Seefahrerschule in Sagres an der Algarve auf. Geschickt und lebendig und immer im passenden Tonfall mischt die Sozialanthropologin die historische Erzählung mit ihren heutigen Recherchen.
Die Autorin an Bord eines Containerschiffes
Sie berichtet vom Leben an Bord des Containerschiffes, von den Träumen der Matrosen, deren allabendlichen Basketballspiel, langen Karaoke-Abenden und auch der eigenen Seekrankheit. Wichtiger aber noch ist ihr präziser Blick auf das heutige Leben in den ehemaligen Kolonien. So spricht sie in Ceuta, der heute spanischen Exklave in Nordafrika, mit jungen Flüchtlingen aus dem Senegal, die von einer Zukunft in Europa träumen, auf den Kapverden mit Musikern und Mitstreitern Amílcar Cabrals, der die Unabhängigkeitsbewegung der Kapverden und Guineas prägte und auf den von portugiesischer Seite mehrere Attentate verübt wurden.
Blutige Entkolonialisierung
Portugal wollte unter der Diktatur Salazars (1932-1968) seine Kolonien nicht aufgeben, und so wurden einige Länder wie Angola oder Mosambik erst 1975 unabhängig – und prompt brachen dort dann Bürgerkriege aus, auch als Stellvertreterkriege im Ost-West-Konflikt. In Angola wuchsen Generationen im Krieg auf, und Erika Fatlands Gesprächspartner dort sind traumatisierte Menschen, in deren Gedächtnis sich – egal ob sie selbst Kriegsteilnehmer waren oder Nachgeborene – furchtbare Bilder eingegraben haben. Bürgerkriege und Leid als Spätfolgen des Kolonialismus.
In Portugal erinnert bis heute das verherrlichende Denkmal der Entdeckungen am Lissaboner Tejo-Ufer an die Kolonialzeit. Es wurde 1960 zum 500. Todestag von Heinrich, dem Seefahrer errichtet. Bis heute steht es, ohne der Opfer zu gedenken. Erika Fatlands glänzend geschriebenes Buch füllt diese Lücke.