Eingebildete Mündigkeit
Im aufgeklärten Westen herrscht das Leitbild der persönlichen Mündigkeit. Doch Theorie und Praxis gehen hier auseinander. Die viel gerühmte und hartnäckig geforderte Selbstbestimmung scheitert im Alltag unerwartet oft.
Der moderne Mensch ist mündig und frei. Er entscheidet seine Angelegenheiten allein, sein Leben und sein Bauch gehören ihm. Ja, er sucht und entdeckt in sich schlummernde Kräfte, von denen er selbst nichts wusste und in denen er sich verwirklicht. Im Prinzip der "Selbstverwirklichung" ist der Grundsatz der Mündigkeit gewissermaßen potenziert.
Dumm nur, dass er sich dabei häufig verheddert. Ständig fragt er sich, wer er ist und was er "eigentlich" will oder fühlt, lauscht auf seine inneren Stimmen und hört doch meistens nur Kakophonie.
Odo Marquard hat vor über 30 Jahren die Gesellschaft der Gegenwart einmal als ein "Zeitalter der Weltfremdheit" charakterisiert. Die zentrale Ursache sieht er in einem wachsenden Auseinanderklaffen von Erfahrung und Erwartung: Der Kern der Eigenerfahrung schrumpft, immer mehr Menschen schöpfen ihre Maßstäbe und Vorstellungen über Leben und Welt vornehmlich aus zweiter und dritter Hand. Gleichzeitig steigen die Erwartungen und Ansprüche ins Uferlose: die ideale Beziehung, der Traumjob, Ruhm und Erfolg, am besten ohne große Anstrengung. Und weil die hochfliegenden Ideale immer weniger an konkreten, selbst gemachten Erfahrungen überprüft und korrigiert werden können, reagieren viele Menschen heute auf die Enttäuschung ihrer "Überhoffnungen" nicht mehr mit der Entwicklung von Realitätssinn und Augenmaß, sondern mit Panik.
Der Weltfremdheit entspricht eine bestimmte Aufgeregtheit, die Furcht, irgendeine Chance zu verpassen. Man will sich alle Optionen offen halten und gleichzeitig alles unter Kontrolle haben. Und hier bietet sich die mittlerweile in allen Schichten verbreitete Rhetorik der Mündigkeit als attraktiver und bequemer Deutungsrahmen an.
Dumm nur, dass er sich dabei häufig verheddert. Ständig fragt er sich, wer er ist und was er "eigentlich" will oder fühlt, lauscht auf seine inneren Stimmen und hört doch meistens nur Kakophonie.
Odo Marquard hat vor über 30 Jahren die Gesellschaft der Gegenwart einmal als ein "Zeitalter der Weltfremdheit" charakterisiert. Die zentrale Ursache sieht er in einem wachsenden Auseinanderklaffen von Erfahrung und Erwartung: Der Kern der Eigenerfahrung schrumpft, immer mehr Menschen schöpfen ihre Maßstäbe und Vorstellungen über Leben und Welt vornehmlich aus zweiter und dritter Hand. Gleichzeitig steigen die Erwartungen und Ansprüche ins Uferlose: die ideale Beziehung, der Traumjob, Ruhm und Erfolg, am besten ohne große Anstrengung. Und weil die hochfliegenden Ideale immer weniger an konkreten, selbst gemachten Erfahrungen überprüft und korrigiert werden können, reagieren viele Menschen heute auf die Enttäuschung ihrer "Überhoffnungen" nicht mehr mit der Entwicklung von Realitätssinn und Augenmaß, sondern mit Panik.
Der Weltfremdheit entspricht eine bestimmte Aufgeregtheit, die Furcht, irgendeine Chance zu verpassen. Man will sich alle Optionen offen halten und gleichzeitig alles unter Kontrolle haben. Und hier bietet sich die mittlerweile in allen Schichten verbreitete Rhetorik der Mündigkeit als attraktiver und bequemer Deutungsrahmen an.
Die eigene Befindlichkeit als Maß aller Dinge
Mündig ist, wer sein Leben selbst in die Hand nimmt und sein Tun voll verantwortet. Mündigkeit ist Entscheidungsautonomie plus Verantwortung. Merkwürdig nur, dass gerade die Protagonisten der Mündigkeit oftmals ein großes Geschick entwickeln, misslichen Entscheidungszwängen auszuweichen, für die Folgen eigener Handlungen nicht einzustehen und Verantwortung auf andere abzuwälzen.
Ein Beispiel ist der allgegenwärtige Politikerhass: Man unterstellt ihnen raffgierigen Eigennutz – Stichwort: "Diäten" –, zeiht sie der Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit … und schiebt ihnen alle Verantwortung zu. Gerade die Unfähigen sollen Wunder vollbringen. Bei jedem Skandal fordert man neue Gesetze und Richtlinien – und hetzt vehement gegen die Bürokratie. Die eigene Befindlichkeit ist das Maß aller Dinge. Anstatt von seinen Freiheiten tatsächlich Gebrauch zu machen, fahndet man nach immer neuen Ungerechtigkeiten und Zwängen, von denen man sich emanzipieren muss.
Die Mündigkeit, die diese Menschen für sich reklamieren, ist in Wirklichkeit bloßer Schein. Sie wollen von niemandem abhängig sein und sehnen sich doch insgeheim nach Führung. Für die Ausführung ihrer Forderungen sind ohnehin andere zuständig. Auch die hochfahrende Empörung will es letztlich bequem haben. Nein, statt wirklicher Mündigkeit, die selbständig entscheidet und zu den Konsequenzen steht, streben sie lediglich das Gefühl der Mündigkeit an, das sie ansonsten mit Versorgungsdenken, Risikoscheu und dem Abschieben von Arbeit und Verantwortung durchaus zu vereinbaren wissen.
Trotzdem ist ihr Selbstbewusstsein groß und ungebrochen. Nur Kritik können sie meist nicht vertragen. Gerade die Mündigkeitsmenschen mögen es gar nicht, wenn man sie mit der Nase auf ihre Widersprüchlichkeit stößt.
Rainer Paris, geboren 1948 in Oldenburg, ist Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal und beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit Macht- und Organisationsforschung, Mikrosoziologie und sozialen Bewegungen. Buchveröffentlichungen (Auswahl): "Stachel und Speer. Machtstudien" (1998); "Normale Macht" (2005); "Neid. Von der Macht eines versteckten Gefühls" (2010). Über mehrere Jahre hinweg schrieb er eine Soziologie-Kolumne in der Zeitschrift "Merkur".
Ein Beispiel ist der allgegenwärtige Politikerhass: Man unterstellt ihnen raffgierigen Eigennutz – Stichwort: "Diäten" –, zeiht sie der Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit … und schiebt ihnen alle Verantwortung zu. Gerade die Unfähigen sollen Wunder vollbringen. Bei jedem Skandal fordert man neue Gesetze und Richtlinien – und hetzt vehement gegen die Bürokratie. Die eigene Befindlichkeit ist das Maß aller Dinge. Anstatt von seinen Freiheiten tatsächlich Gebrauch zu machen, fahndet man nach immer neuen Ungerechtigkeiten und Zwängen, von denen man sich emanzipieren muss.
Die Mündigkeit, die diese Menschen für sich reklamieren, ist in Wirklichkeit bloßer Schein. Sie wollen von niemandem abhängig sein und sehnen sich doch insgeheim nach Führung. Für die Ausführung ihrer Forderungen sind ohnehin andere zuständig. Auch die hochfahrende Empörung will es letztlich bequem haben. Nein, statt wirklicher Mündigkeit, die selbständig entscheidet und zu den Konsequenzen steht, streben sie lediglich das Gefühl der Mündigkeit an, das sie ansonsten mit Versorgungsdenken, Risikoscheu und dem Abschieben von Arbeit und Verantwortung durchaus zu vereinbaren wissen.
Trotzdem ist ihr Selbstbewusstsein groß und ungebrochen. Nur Kritik können sie meist nicht vertragen. Gerade die Mündigkeitsmenschen mögen es gar nicht, wenn man sie mit der Nase auf ihre Widersprüchlichkeit stößt.
Rainer Paris, geboren 1948 in Oldenburg, ist Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal und beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit Macht- und Organisationsforschung, Mikrosoziologie und sozialen Bewegungen. Buchveröffentlichungen (Auswahl): "Stachel und Speer. Machtstudien" (1998); "Normale Macht" (2005); "Neid. Von der Macht eines versteckten Gefühls" (2010). Über mehrere Jahre hinweg schrieb er eine Soziologie-Kolumne in der Zeitschrift "Merkur".
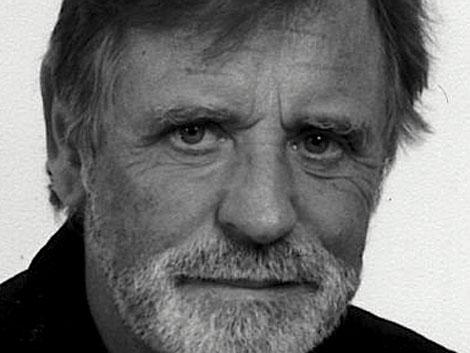
Der Soziologe Rainer Paris© privat