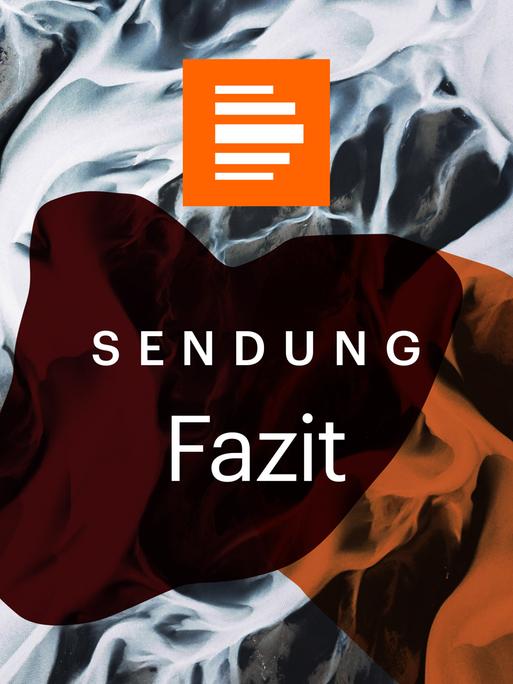Einem Phänomen auf der Spur
In Berlin gibt es derzeit eine Ausstellung, die sich mit der Geschichte des Schmerzes beschäftigt, seinen Formen, seinem Ausdruck und unserem Umgang mit Schmerz. Begleitend zur Ausstellung ist der Band "Schmerz. Kunst und Wissenschaft" erschienen. Darin erkunden Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen, was es in unserem Kulturkreis mit dem Schmerz auf sich hat.
Wohl keineswegs zufällig wurde in Berlin die Ausstellung "Schmerz"zu Ostern eröffnet. Nichts repräsentiert die christlich-abendländische Vorstellung von Schmerz so wie das Bild von Jesus am Kreuz.
Zur Ausstellung ist ein Buch erschienen: "Schmerz. Kunst und Wissenschaft". Über zwanzig Autoren versuchen in ebenso vielen Essays dem Phänomen "Schmerz" auf den Grund zu kommen. Unter ihnen sind Philosophen, Ethnologen, Kunsthistoriker, Mediziner und Literaturwissenschaftler.
Das Buch bezieht sich auf die Ausstellung, steht aber für sich und lässt nichts vermissen, was man von einem anregenden und gut gemachten Sachbuch erwartet. Graphisch ansprechend, mit vielen farbigen Abbildungen illustriert, klar gegliedert, nimmt es den Leser mit auf eine Reise durch die Welt der Schmerzen von der Antike bis zur Gegenwart. Interdisziplinär erkunden die Autoren, was es in unserem Kulturkreis mit dem Schmerz auf sich hat. Thematisiert werden die Entstehung von Schmerzen, das Erlebnis des Schmerzes, die Art und Weise wie der Mensch ihn ausdrückt, die Schwierigkeit ihn mitzuteilen, seine Konsequenzen für das Individuum.
In der Medizin ist der Schmerzbegriff relativ klar umrissen. "Ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht", heißt es beispielsweise in der Definition der Internationalen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes. Die beiden Mediziner Andreas Kopf und Rainer Sabatowski drücken sich in ihrem Aufsatz präziser aus: "Nach Einwirkung durch Hitze, Verletzung, Infektion oder Chemikalien kommt es bei den am Ort der Schädigung vorhandenen, für die Schmerzleitung spezialisierten Nervenfaserendigungen zu einer Veränderung der Erregbarkeit ... Dass heißt, die Feuerungsrate bzw. Impulsfrequenz der Nerven wird vermehrt."
Die neurologische Einordnung des Schmerzes steht am Ende einer langen Entwicklung. Aristoteles sah das Herz als Verursacher von Schmerzen, Hippokrates die Imbalance verschiedener Körpersäfte. Erst im 19. Jahrhundert begann sich das moderne Schmerzverständnis zu entwickeln. Und erst seit gut fünfzig Jahren werden Schmerzen nicht nur als Krankheitssymptom, sondern als eigenständige Erkrankung angesehen.
Einig sind sich die Wissenschaftler darüber, dass Schmerz nicht objektivierbar ist. Nicht teilbar und nur schwer mitteilbar. Wir können zwar mitleidend äußerliche Reaktionen auf die Wirksamkeit eines Schmerzes erkennen, der Schmerz selbst aber - obgleich lokalisierbar - bleibt unsichtbar. Dementsprechend vielfältig ist das Bemühen, dem Schmerz eine philosophische, theologische oder künstlerische Dimension zu geben.
Für Nietzsche beispielsweise "steht der Schmerz nicht nur am Anfang der (europäischen) Kultur, sondern er sieht in ihm auch einen ständigen Antrieb und Anlass für die geistige Aktivität des Menschen", erklärt die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel in ihrem Aufsatz zum "homo dolens". Menschliches Sein und Schmerz bedingten einander, begründet sie mit Hinweis auf die stets herausragende Stellung des Schmerzes in der Kultur.
Etliche Aufsätze sind der Abbildbarkeit des Schmerzes gewidmet. Entweder in der Musik - den Madrigalen Monteverdis, den Kompositionen Bachs oder den Opern Richard Wagners. Oder in der Bildenden Kunst, den zeitgenössischen Arbeiten Francis Bacons und Bruce Naumans, sowie der Laokoon-Gruppe des Bildhauers Sansovino aus dem 16. Jahrhundert - Beispiel für den archetypischen Ausdruck für die Physiognomie von Schmerz, wie ihn auch zahlreiche Passionsbilder darstellen. Interessant ist der Hinweis des Theologen Christoph Markschies, "dass das aus den Kirchenliedern und der kirchlichen Kunst wohlvertraute Bild des Schmerzensmannes erst im hohen Mittelalter aufgekommen ist." Zuvor galt der demonstrative Ausdruck von Schmerzen als Defekt. Zur Zeit des Barock erlebte er seinen Höhepunkt. In der anbrechenden Moderne - Zeit von Säkularisierung und Rationalisierung - war in der Öffentlichkeit kein Platz für zur Schau gestellte, expressive Schwachheit. Pathos und Wirkungskraft der "Schmerzblicke" kehrte erst mit der Verbreitung von Film und Fotografie wieder zurück, erläutert die Kunst- und Literaturwissenschaftlerin Annemarie Hürlimann.
Neben vielen gedanklichen Höhenflügen bietet das Buch auch plattes, dabei durchaus reizvolles Anschauungsmaterial: skurril das Foto des amerikanischen Gerichtsmediziners Zugibe, der in aufwendigen Versuchsreihen seine Assistenten ans Kreuz hängt. Phantasie stimulierend die Abbildung eines Beißstabes, der Patienten bei Operationen ohne Narkose in den Mund gesteckt wurde. Votivgaben, Nahaufnahmen von Präparaten der pathologischen Sammlung der Berliner Charité, von Narben oder Medikamenten vermitteln die Vielfalt der Aspekte, unter denen das Phänomen Schmerz betrachtet werden kann.
Eine Kulturgeschichte der Schmerzen will das Buch dennoch nicht sein. Das ist ein Vorteil. Statt zu systematisieren, eröffnet es Perspektiven. Und schafft bestenfalls Bewusstsein - auch im Umgang mit dem Schmerz, den wir täglich zu sehen bekommen.
Rezensiert von Carsten Hueck
Eugen Blume, Annemarie Hürlimann, Thomas Schnalke, Daniel Tyradellis (Hrsg.): Schmerz. Kunst und Wissenschaft
Köln, DuMont Verlag
311 Seiten. 39,90 Euro
Zur Ausstellung ist ein Buch erschienen: "Schmerz. Kunst und Wissenschaft". Über zwanzig Autoren versuchen in ebenso vielen Essays dem Phänomen "Schmerz" auf den Grund zu kommen. Unter ihnen sind Philosophen, Ethnologen, Kunsthistoriker, Mediziner und Literaturwissenschaftler.
Das Buch bezieht sich auf die Ausstellung, steht aber für sich und lässt nichts vermissen, was man von einem anregenden und gut gemachten Sachbuch erwartet. Graphisch ansprechend, mit vielen farbigen Abbildungen illustriert, klar gegliedert, nimmt es den Leser mit auf eine Reise durch die Welt der Schmerzen von der Antike bis zur Gegenwart. Interdisziplinär erkunden die Autoren, was es in unserem Kulturkreis mit dem Schmerz auf sich hat. Thematisiert werden die Entstehung von Schmerzen, das Erlebnis des Schmerzes, die Art und Weise wie der Mensch ihn ausdrückt, die Schwierigkeit ihn mitzuteilen, seine Konsequenzen für das Individuum.
In der Medizin ist der Schmerzbegriff relativ klar umrissen. "Ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht", heißt es beispielsweise in der Definition der Internationalen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes. Die beiden Mediziner Andreas Kopf und Rainer Sabatowski drücken sich in ihrem Aufsatz präziser aus: "Nach Einwirkung durch Hitze, Verletzung, Infektion oder Chemikalien kommt es bei den am Ort der Schädigung vorhandenen, für die Schmerzleitung spezialisierten Nervenfaserendigungen zu einer Veränderung der Erregbarkeit ... Dass heißt, die Feuerungsrate bzw. Impulsfrequenz der Nerven wird vermehrt."
Die neurologische Einordnung des Schmerzes steht am Ende einer langen Entwicklung. Aristoteles sah das Herz als Verursacher von Schmerzen, Hippokrates die Imbalance verschiedener Körpersäfte. Erst im 19. Jahrhundert begann sich das moderne Schmerzverständnis zu entwickeln. Und erst seit gut fünfzig Jahren werden Schmerzen nicht nur als Krankheitssymptom, sondern als eigenständige Erkrankung angesehen.
Einig sind sich die Wissenschaftler darüber, dass Schmerz nicht objektivierbar ist. Nicht teilbar und nur schwer mitteilbar. Wir können zwar mitleidend äußerliche Reaktionen auf die Wirksamkeit eines Schmerzes erkennen, der Schmerz selbst aber - obgleich lokalisierbar - bleibt unsichtbar. Dementsprechend vielfältig ist das Bemühen, dem Schmerz eine philosophische, theologische oder künstlerische Dimension zu geben.
Für Nietzsche beispielsweise "steht der Schmerz nicht nur am Anfang der (europäischen) Kultur, sondern er sieht in ihm auch einen ständigen Antrieb und Anlass für die geistige Aktivität des Menschen", erklärt die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel in ihrem Aufsatz zum "homo dolens". Menschliches Sein und Schmerz bedingten einander, begründet sie mit Hinweis auf die stets herausragende Stellung des Schmerzes in der Kultur.
Etliche Aufsätze sind der Abbildbarkeit des Schmerzes gewidmet. Entweder in der Musik - den Madrigalen Monteverdis, den Kompositionen Bachs oder den Opern Richard Wagners. Oder in der Bildenden Kunst, den zeitgenössischen Arbeiten Francis Bacons und Bruce Naumans, sowie der Laokoon-Gruppe des Bildhauers Sansovino aus dem 16. Jahrhundert - Beispiel für den archetypischen Ausdruck für die Physiognomie von Schmerz, wie ihn auch zahlreiche Passionsbilder darstellen. Interessant ist der Hinweis des Theologen Christoph Markschies, "dass das aus den Kirchenliedern und der kirchlichen Kunst wohlvertraute Bild des Schmerzensmannes erst im hohen Mittelalter aufgekommen ist." Zuvor galt der demonstrative Ausdruck von Schmerzen als Defekt. Zur Zeit des Barock erlebte er seinen Höhepunkt. In der anbrechenden Moderne - Zeit von Säkularisierung und Rationalisierung - war in der Öffentlichkeit kein Platz für zur Schau gestellte, expressive Schwachheit. Pathos und Wirkungskraft der "Schmerzblicke" kehrte erst mit der Verbreitung von Film und Fotografie wieder zurück, erläutert die Kunst- und Literaturwissenschaftlerin Annemarie Hürlimann.
Neben vielen gedanklichen Höhenflügen bietet das Buch auch plattes, dabei durchaus reizvolles Anschauungsmaterial: skurril das Foto des amerikanischen Gerichtsmediziners Zugibe, der in aufwendigen Versuchsreihen seine Assistenten ans Kreuz hängt. Phantasie stimulierend die Abbildung eines Beißstabes, der Patienten bei Operationen ohne Narkose in den Mund gesteckt wurde. Votivgaben, Nahaufnahmen von Präparaten der pathologischen Sammlung der Berliner Charité, von Narben oder Medikamenten vermitteln die Vielfalt der Aspekte, unter denen das Phänomen Schmerz betrachtet werden kann.
Eine Kulturgeschichte der Schmerzen will das Buch dennoch nicht sein. Das ist ein Vorteil. Statt zu systematisieren, eröffnet es Perspektiven. Und schafft bestenfalls Bewusstsein - auch im Umgang mit dem Schmerz, den wir täglich zu sehen bekommen.
Rezensiert von Carsten Hueck
Eugen Blume, Annemarie Hürlimann, Thomas Schnalke, Daniel Tyradellis (Hrsg.): Schmerz. Kunst und Wissenschaft
Köln, DuMont Verlag
311 Seiten. 39,90 Euro