Ein eklatanter Mangel an politischem Stil
Gut 15 Jahre ist es her, dass der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Machtversessenheit der Politiker geißelte. Die Klage über den Politikverdruss ist seitdem zur professionellen Routine verkommen. Geändert hat sie nichts, das öffentliche Ansehen der Politiker fällt beständig.
Bemisst man es an der Zahl der Nichtwähler, so ist es in den letzten 15 Jahren um die Hälfte gesunken. Und mit den Geschehnissen vom Wochenende dürfte es einen weiteren Einbruch erlitten haben. Selbst wenn man angesichts der Provinzialität Kurt Becks dessen Ablösung von der Parteispitze für unausweichlich gehalten hat, so erschüttert an den Abläufen doch der eklatante Mangel an politischem Stil und die völlige Missachtung politischer Normen und Formen. Der Bürger erlebte einen SPD-Vorsitzenden, der sich wie ein geprügelter Hund zur Hintertür hinaus schlich und einen kommissarischen Nachfolger, der die naheliegende Frage nach den Gründen des Konflikts in Lobeshymnen auf den Geschassten erstickte. Er sah die Führungsgremien der Partei, die sich wie Sommergäste zur Landpartie einfanden, um wortlos einen der größten Umbrüche der SPD zu akklamieren. Innerparteiliche Willensbildung sieht anders aus. In dieser Sprachlosigkeit ist der Keim weiterer Querelen bereits angelegt. Die SPD hat zwar einen neuen Vorsitzenden, geführt wird sie deshalb noch lange nicht.
Als ob die Misere nicht schon groß genug wäre, fallen CDU und CSU über den Außenminister her, als hätten sie mit der SPD nie einen Koalitionsvertrag geschlossen, als hätten sie dem Wähler seinerzeit nicht versprochen, seinen Willen zu achten. Selbst die Kanzlerin kennt nur noch Parteien und keine Kabinettsdisziplin mehr.
Der Mangel an Führung in der Regierung, die permanente Dominanz der Parteiinteressen erzeugen eine rastlose Lähmung der Exekutive. Die Kurzatmigkeit des Augenblicksvorteils tritt an die Stelle planerischen Handelns. Der spürbare Verdruss, den dieses Vorgehen beim Bürger erzeugt, wird hingenommen, solange es komparative Vorteile gegenüber dem Koalitionspartner verspricht.
Max Weber nannte zwei Fähigkeiten, die einen guten Politiker auszeichnen: Augenmaß und Urteilskraft. Das Augenmaß der derzeitigen Politiker sind die Umfragen, an denen sie den Rückhalt ihrer Partei, mithin die eigenen Karrierechancen messen. Ihr Urteil bilden sie sich aus den Medien, deren Lektüre ihnen die Wirklichkeit ersetzt.
So werden sie zu Getriebenen der Ereignisse, statt sie zu steuern. Sie jagen verlorenem Vertrauen hinterher, wo es gälte, Autorität zu gewinnen. Vertrauensverlust ist der gängige Reim, den man sich auf den Politikverdruss des Bürgers macht. Vertrauensbildende Maßnahmen, Bürgergespräch, Politiker zum Anfassen, so lautet die entsprechende Therapie.
Doch vielleicht will der Souverän vom Politiker gar nicht so sehr ins Vertrauen gezogen werden, vielleicht hat er ein entwickeltes Sensorium für dessen Aufgabe und hegt von sich aus eine Distanz, die er eigentlich von jenem erwartet. Erfolgreich waren in der Geschichte der Bundesrepublik selten Politiker, die sich durch eine überschwappende Volksnähe auszeichneten.
Die Gründergeneration lebte noch mit der Gewissheit, dass es darauf ankomme, die Lehren aus der Geschichte in der Gegenwart durchzusetzen. Weder Konrad Adenauer noch Herbert Wehner oder Helmut Schmidt wären auf die Idee gekommen, das einmal für richtig Erkannte auf dem Markt der Umfragen preiszugeben. Franz Müntefering ist der Einzige, der derzeit diese Unbeirrtheit verkörpert.
Auch die 68er Generation, die nun abtritt, war noch von der Gewissheit beseelt, das Richtige für die Zukunft zu wissen. Doch war ihr die Politik zugleich Medium biografischer Selbstverwirklichung. Damit einher ging ein gerüttelt Maß an Institutionen-Verachtung und die Neigung zu persönlichen Eskapaden, von denen der Rücktritt Oskar Lafontaines zweifellos die spektakulärste war.
Sie hatten einst für die Politik gelebt, doch mit den Jahren lebten sie immer mehr von der Politik. Der bruchlose Wechsel Gerhard Schröders in die russische Gaswirtschaft ist nur das unappetitlichste Beispiel für einen rasanten Verfall politischen Stils. Diese Stillosigkeit scheint in der nun nachkommenden Politikergeneration Normalität zu werden. Vernetzung lautet ihr modus operandi erfolgreicher Politik. Die Übergänge zwischen Politik, professioneller Politikberatung und Unternehmenspolitik sind fließend geworden. Politik wird zum Management. Das thymotische Motiv einer Selbstverwirklichung, die sich nicht am Ego, sondern an der Sache misst, die es durchzusetzen gilt, spielt keine Rolle mehr. Vielmehr wird eine Haltung des dezidiert Unideologischen gepflegt, Pragmatismus ist die Kunst der Stunde. Dabei wird jedoch vergessen, dass in der Politik Pragmatismus mehr noch als Ideologie eine persönliche Haltung erfordert.
Dieter Rulff, Journalist, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. Ab 1. Januar 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
Als ob die Misere nicht schon groß genug wäre, fallen CDU und CSU über den Außenminister her, als hätten sie mit der SPD nie einen Koalitionsvertrag geschlossen, als hätten sie dem Wähler seinerzeit nicht versprochen, seinen Willen zu achten. Selbst die Kanzlerin kennt nur noch Parteien und keine Kabinettsdisziplin mehr.
Der Mangel an Führung in der Regierung, die permanente Dominanz der Parteiinteressen erzeugen eine rastlose Lähmung der Exekutive. Die Kurzatmigkeit des Augenblicksvorteils tritt an die Stelle planerischen Handelns. Der spürbare Verdruss, den dieses Vorgehen beim Bürger erzeugt, wird hingenommen, solange es komparative Vorteile gegenüber dem Koalitionspartner verspricht.
Max Weber nannte zwei Fähigkeiten, die einen guten Politiker auszeichnen: Augenmaß und Urteilskraft. Das Augenmaß der derzeitigen Politiker sind die Umfragen, an denen sie den Rückhalt ihrer Partei, mithin die eigenen Karrierechancen messen. Ihr Urteil bilden sie sich aus den Medien, deren Lektüre ihnen die Wirklichkeit ersetzt.
So werden sie zu Getriebenen der Ereignisse, statt sie zu steuern. Sie jagen verlorenem Vertrauen hinterher, wo es gälte, Autorität zu gewinnen. Vertrauensverlust ist der gängige Reim, den man sich auf den Politikverdruss des Bürgers macht. Vertrauensbildende Maßnahmen, Bürgergespräch, Politiker zum Anfassen, so lautet die entsprechende Therapie.
Doch vielleicht will der Souverän vom Politiker gar nicht so sehr ins Vertrauen gezogen werden, vielleicht hat er ein entwickeltes Sensorium für dessen Aufgabe und hegt von sich aus eine Distanz, die er eigentlich von jenem erwartet. Erfolgreich waren in der Geschichte der Bundesrepublik selten Politiker, die sich durch eine überschwappende Volksnähe auszeichneten.
Die Gründergeneration lebte noch mit der Gewissheit, dass es darauf ankomme, die Lehren aus der Geschichte in der Gegenwart durchzusetzen. Weder Konrad Adenauer noch Herbert Wehner oder Helmut Schmidt wären auf die Idee gekommen, das einmal für richtig Erkannte auf dem Markt der Umfragen preiszugeben. Franz Müntefering ist der Einzige, der derzeit diese Unbeirrtheit verkörpert.
Auch die 68er Generation, die nun abtritt, war noch von der Gewissheit beseelt, das Richtige für die Zukunft zu wissen. Doch war ihr die Politik zugleich Medium biografischer Selbstverwirklichung. Damit einher ging ein gerüttelt Maß an Institutionen-Verachtung und die Neigung zu persönlichen Eskapaden, von denen der Rücktritt Oskar Lafontaines zweifellos die spektakulärste war.
Sie hatten einst für die Politik gelebt, doch mit den Jahren lebten sie immer mehr von der Politik. Der bruchlose Wechsel Gerhard Schröders in die russische Gaswirtschaft ist nur das unappetitlichste Beispiel für einen rasanten Verfall politischen Stils. Diese Stillosigkeit scheint in der nun nachkommenden Politikergeneration Normalität zu werden. Vernetzung lautet ihr modus operandi erfolgreicher Politik. Die Übergänge zwischen Politik, professioneller Politikberatung und Unternehmenspolitik sind fließend geworden. Politik wird zum Management. Das thymotische Motiv einer Selbstverwirklichung, die sich nicht am Ego, sondern an der Sache misst, die es durchzusetzen gilt, spielt keine Rolle mehr. Vielmehr wird eine Haltung des dezidiert Unideologischen gepflegt, Pragmatismus ist die Kunst der Stunde. Dabei wird jedoch vergessen, dass in der Politik Pragmatismus mehr noch als Ideologie eine persönliche Haltung erfordert.
Dieter Rulff, Journalist, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte. Ab 1. Januar 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
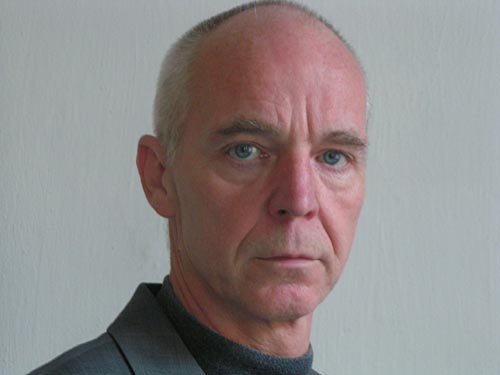
Dieter Rulff© privat