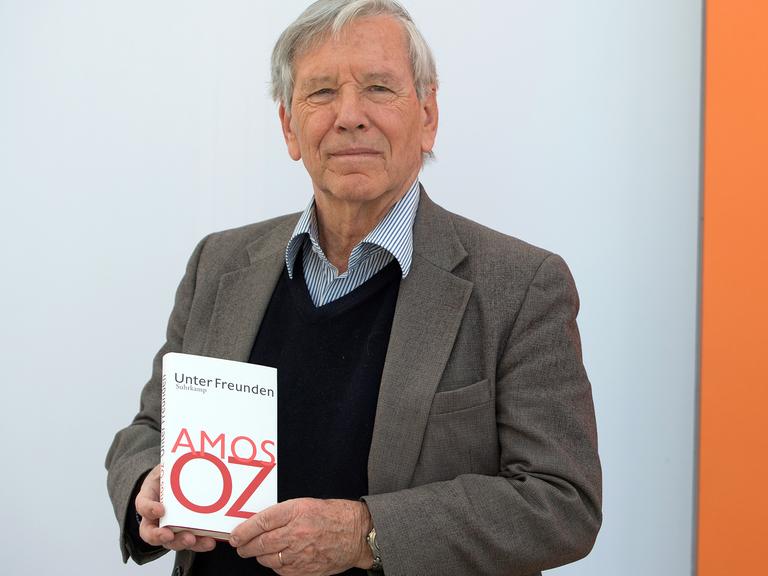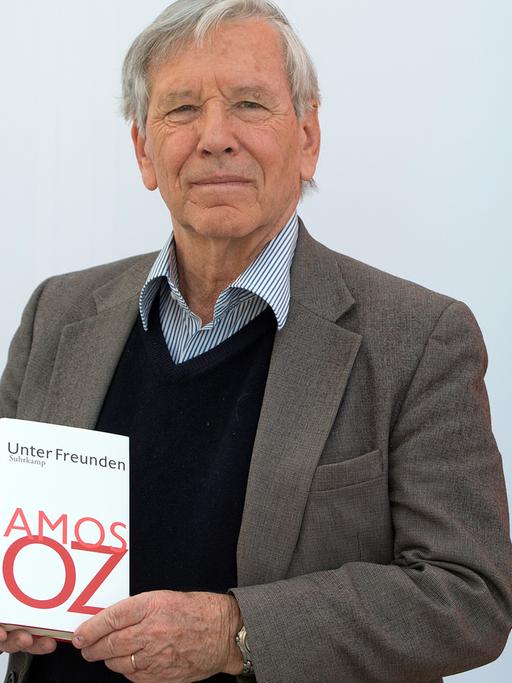Zeitreise in ein Land, das so hoffnungsvoll begann

Der Dokumentarfilm "Erhobenen Hauptes" erzählt die Geschichte einer Gruppe von Juden, die aus Deutschland nach Palästina flohen. Er erzählt von ihrem Überlebenswillen im neuen Staat Israel und ihrer gelebten Gesellschaftsutopie: den Kibbuzim.
"Ich stehe jeden Morgen um sechs Uhr auf, bereite mich für das Schwimmbecken vor, putze selbstverständlich die Zähne und trinke ein Glas Wasser auf leeren Magen – und so fängt jeder Tag an..."
Zu Beginn des Filmes sieht man eine Handvoll älterer Menschen, die von ihrem Alltag erzählen. Sie alle leben in einem sonnigen Land – und sie alle sprechen deutsch. Was zunächst wie eine Nobel-Seniorenresidenz irgendwo in Südeuropa aussieht, entpuppt sich schnell als etwas ganz anderes.
"Das Bild vom Abschied von meinen Eltern, das ist... Ich kann das nicht auslöschen. Sie stehen am Bahnhof zusammen, und das ist das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe."
"So sind wir am 25. August aus Berlin rausgefahren und kamen am 26. früh in Paris an, am ersten Tag von der Mobilisierung. Das war der letzte Zug, der Personenzug, der rausgefahren ist aus Deutschland."
"So sind wir am 25. August aus Berlin rausgefahren und kamen am 26. früh in Paris an, am ersten Tag von der Mobilisierung. Das war der letzte Zug, der Personenzug, der rausgefahren ist aus Deutschland."
Die Geschichte erzählen, bevor es zu spät ist
Erst nach einigen Minuten erfährt der Zuschauer: Alle im Film gezeigten Menschen sind als Kinder jüdischer Eltern aus Deutschland geflohen – manche mit ihren Eltern, manche ohne sie.
"Also, das ist meine erste Identitätskarte hier in Palästina. Israel hat noch nicht existiert."
Sie alle verbindet, dass sie im Kibbuz Ma'arbarot im Nordwesten Israels ankamen. Am Anfang waren sie circa 120 Erwachsene und 60 Kinder.
"Wir haben sehr viel Hebräisch gelernt. Wir wollten kein Deutsch sprechen. Unbedingt nicht."
Und doch tun sie es – bevor es zu spät ist, ihre Geschichte zu erzählen. Die Filmemacher der Gruppe DocView haben daraus ein so eindringliches wie unaufdringliches Portrait zusammengefügt, das nicht wie so viele Dokumentarfilme den Fokus auf die Leiden der Juden durch Verfolgung und Shoah legt, sondern auf den Überlebenswillen dieser jungen Flüchtlinge.
"Zuhause kann man nur an einem Platz sein und wir wollten uns nicht noch mal verbreiten überallhin und nachher nicht wissen, wohin gehen (sic!) sollen, das ist doch ganz normal. Und wir wollen so sein wie alle anderen."
Im Kibbuz wird alles geteilt: Das Land wird gemeinsam bestellt, wer außerhalb arbeitet, gibt seinen Lohn im Kibbuz ab, alle bekommen das gleiche Grundeinkommen. Die 1923 in Berlin geborene Hanni Aisner gab sogar ihre Hochzeitsgeschenke an den Kibbuz weiter. Und auch wenn es immer weniger Kibbuze in Israel gibt – die Gründergeneration von Ma'arbarot lebt ihre Utopie unbeirrt weiter.
"Als alter Mensch habe ich ein gutes Leben. Ich arbeite nicht, aber was ich tue, ist freiwillig. Erstens ist man zusammen mit anderen Menschen, man ist nicht alleine. Zweitens ist eine Beschäftigung – Stricken für Babies, hauptsächlich wir machen für Babies..."
Etwas Positives, das aus einer tragischen Situation entstand
In Ma'arbarot sind die alten Menschen noch immer aktiver Teil der Gesellschaft. Dass so etwas Positives aus einer historisch tragischen Situation entstand, lässt einen hoffen. Überhaupt ist die Hoffnung das Leitmotiv dieses Filmes. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft treibt auch den Kibbuznik Zvi Cohen an deutsche Schulen, wo er seine Geschichte erzählt.
"Man hört ein Schicksal, man fühlt, wie es übertragen wird – und das geht an zwei Zielplätze: Hier rein, ins Gehirn, und hier rein, ins Herz. Man spürt es, man erfasst es. Meiner Meinung nach ist das der einzige Weg, um so etwas in Zukunft zu verhindern."
Der jungen Filmgruppe DocView ist ein Film gelungen, der unaufgeregt und ohne Inszenierung des Leides auskommt, das viele der Portraitierten durchlitten haben – was vielleicht auch daran liegt, dass die Portraitierten zu ihnen wie zu ihren Enkeln sprechen. Und noch etwas ist bemerkenswert: Die Kibbuzim hängen noch immer an der Utopie von einem gemeinsamen Staat mit Arabern – die Bilder von der Grenzmauer zu Palästina sprechen da aber eine ganz andere Sprache. Insofern ist der Film auch Zeitreise in ein Land, das so hoffnungsvoll begann, und in dem heute so viel festgefahren scheint. In Ma'abarot lebt die Utopie eines friedlichen Zusammenlebens aller weiter.
"Ich fühl mich noch heute hier im Kibbuz sauwohl. Also der beste Platz für mich ist mein Kibbuz, der inzwischen – gottseidank – noch ein Kibbuz ist. Und ich mache alle Bemühungen, dass, solange ich lebe, dass es so bleibt. Ob ich's schaffen werde – das kann ich nicht versprechen."