Die weiche Landung nach dem Fall
Unternehmer riskieren ganze Vermögen, weshalb sie für ihre Verantwortung belohnt werden müssten - so rechtfertigen Manager ihre enormen Gehälter und Boni. Dabei begeben sie sich nicht in wirkliche Gefahr - denn die Risiken werden weitergegeben, meint Heiner Ganßmann.
Unternehmer sind anders als das übrige Volk: offener für neue Erfahrungen und risikofreudiger als der gemeine Angestellte. Das will das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung herausgefunden haben. Im Gegensatz zu Normalverbrauchern, die etwas von ihrem Einkommen sparen und vorsichtig anlegen, riskieren Unternehmer ganze Vermögen. Dafür sollen sie dann eine höhere Belohnung bekommen: den Gewinn, der über den Normalzins hinausgeht.
So und ähnlich rechtfertigen Konzerne ihre Margen und Manager ihre enormen Gehälter und Boni. Doch diese Rechtfertigung geht nur auf, wenn Unternehmer erstens überhaupt Risiken eingehen und wenn sie zweitens bei schlechtem Ausgang auch für Verluste geradestehen müssen.
Was riskieren Unternehmer? Zum Beispiel investiert ein Autohersteller viel Geld in eine neues Modell. Verkauft es sich gut, macht er Gewinn. Falls es schlimm kommt, geht er Bankrott.
So die Theorie. In Wirklichkeit setzen viele Unternehmen ihre Preise so, dass Verluste gar nicht entstehen können. Eine Risikoprämie können Gewinne wohl dann nicht sein, wenn man sie zwar aus riskanten Unternehmen einstreicht, aber verschwindet, sobald Verluste entstehen. Doch genau das war die Praxis von vielen Finanzhäusern, wie die Krise von 2008 offenbarte.
Eine altmodische Bank lebte von der Differenz zwischen dem Zins, den sie an ihre Einleger zahlt, und dem Zins, den sie von ihren Kreditnehmern verlangt. Dass Kredite nicht zurückgezahlt werden, war ihr Hauptrisiko. Aber seit der Deregulierung der Finanzmärkte können Risiken bequem weitergereicht werden. Zum Beispiel vergibt eine neumodische Bank Hypotheken, stößt dabei an die Grenze der geforderten Eigenkapitaldeckung und will trotzdem noch mehr Hypothekengeschäfte machen. Legal geht das nur, wenn sie diese Hypotheken neu verpackt und als Immobilienfonds weiterverkauft. Womit wir wieder beim Risiko wären: Es wird an die Käufer der Immobilienfonds weitergereicht.
Als sich vor fünf Jahren in den USA die Hypothekenkrise anbahnte, war bei vielen Hauskäufen von vornherein klar, dass die Käufer ihre Schulden nicht bedienen könnten. Doch das interessierte kaum jemanden. Das Risiko wurde einfach weiterverkauft, an deutsche Landesbanken zum Beispiel, die keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich erwarben.
So wanderte das Risiko über den Atlantik und tauchte an ganz anderen Stellen des globalen Finanzsystems wieder auf: in Deutschland bei IKB, bei der Hypo Real Estate, bei fast allen Landesbanken, bei der Commerzbank und so weiter. Als die Blase platzte, blieb nur der Staat als Retter. Und wieder begann das Risiko zu wandern.
Aus der Finanzkrise wurde eine Staatsschuldenkrise, mit der Unterzone Euro-Krise. Jetzt müssen ganze überschuldete Staaten "gerettet" werden.
Ist das in unseren Tagen aus dem unternehmerischen Risiko geworden? Es wandert und wandert, bis es beim Steuerzahler ankommt. Die Gewinne aber, die scheinbaren Risiko-Prämien, bleiben dort hängen, wo sie schon immer waren: beim angeblich so risikofreudigen Investor oder Unternehmer.
Was können die Bürger und Steuerzahler gegen solche wandernden Risiken tun? Die verantwortlichen Politiker abwählen? Die Kaufkraft des Stimmzettels ist leider gesunken. Zur Wahl stehen fast nur Politiker, die das tun, was die Märkte diktieren. Das zeigen die meisten europäischen Regierungswechsel seit 2008.
Nur auf einer kleinen Insel im Nordatlantik war das anders. Dort durften die Wähler vor ein paar Jahren die Zustimmung zur Übernahme der Bankschulden durch ihren Staat verweigern. Und dort ist das Risiko wenigstens teilweise geblieben, wo es hingehört. Glückliches Island …
Heiner Ganßmann, geboren 1944 in Darmstadt, studierte an der Freien Universität Berlin. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt an der "New School" in New York Ende der 1970er-Jahre trat er 1980 an der Freien Universität die Professur für Soziologie an. Als Wirtschaftssoziologe erforschte er Sozialstaat und Arbeitsmarkt. In der jüngeren Vergangenheit befasst sich Ganßmann zunehmend mit Fragen zur Geld- und Finanzkrise.
Mehr zum Thema:
Urteil: Commerzbank muss Banker-Boni zahlen
Londoner Investmentbanker sollen Millionen bekommen (Aktuell)
Verdrängtes Risiko
Die unbewussten Grundlagen ökonomischen Handelns (DLF)
Mythos freier Markt
Teil 3 der Serie "Wirtschaftsweise ratlos?" (DLF)
So und ähnlich rechtfertigen Konzerne ihre Margen und Manager ihre enormen Gehälter und Boni. Doch diese Rechtfertigung geht nur auf, wenn Unternehmer erstens überhaupt Risiken eingehen und wenn sie zweitens bei schlechtem Ausgang auch für Verluste geradestehen müssen.
Was riskieren Unternehmer? Zum Beispiel investiert ein Autohersteller viel Geld in eine neues Modell. Verkauft es sich gut, macht er Gewinn. Falls es schlimm kommt, geht er Bankrott.
So die Theorie. In Wirklichkeit setzen viele Unternehmen ihre Preise so, dass Verluste gar nicht entstehen können. Eine Risikoprämie können Gewinne wohl dann nicht sein, wenn man sie zwar aus riskanten Unternehmen einstreicht, aber verschwindet, sobald Verluste entstehen. Doch genau das war die Praxis von vielen Finanzhäusern, wie die Krise von 2008 offenbarte.
Eine altmodische Bank lebte von der Differenz zwischen dem Zins, den sie an ihre Einleger zahlt, und dem Zins, den sie von ihren Kreditnehmern verlangt. Dass Kredite nicht zurückgezahlt werden, war ihr Hauptrisiko. Aber seit der Deregulierung der Finanzmärkte können Risiken bequem weitergereicht werden. Zum Beispiel vergibt eine neumodische Bank Hypotheken, stößt dabei an die Grenze der geforderten Eigenkapitaldeckung und will trotzdem noch mehr Hypothekengeschäfte machen. Legal geht das nur, wenn sie diese Hypotheken neu verpackt und als Immobilienfonds weiterverkauft. Womit wir wieder beim Risiko wären: Es wird an die Käufer der Immobilienfonds weitergereicht.
Als sich vor fünf Jahren in den USA die Hypothekenkrise anbahnte, war bei vielen Hauskäufen von vornherein klar, dass die Käufer ihre Schulden nicht bedienen könnten. Doch das interessierte kaum jemanden. Das Risiko wurde einfach weiterverkauft, an deutsche Landesbanken zum Beispiel, die keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich erwarben.
So wanderte das Risiko über den Atlantik und tauchte an ganz anderen Stellen des globalen Finanzsystems wieder auf: in Deutschland bei IKB, bei der Hypo Real Estate, bei fast allen Landesbanken, bei der Commerzbank und so weiter. Als die Blase platzte, blieb nur der Staat als Retter. Und wieder begann das Risiko zu wandern.
Aus der Finanzkrise wurde eine Staatsschuldenkrise, mit der Unterzone Euro-Krise. Jetzt müssen ganze überschuldete Staaten "gerettet" werden.
Ist das in unseren Tagen aus dem unternehmerischen Risiko geworden? Es wandert und wandert, bis es beim Steuerzahler ankommt. Die Gewinne aber, die scheinbaren Risiko-Prämien, bleiben dort hängen, wo sie schon immer waren: beim angeblich so risikofreudigen Investor oder Unternehmer.
Was können die Bürger und Steuerzahler gegen solche wandernden Risiken tun? Die verantwortlichen Politiker abwählen? Die Kaufkraft des Stimmzettels ist leider gesunken. Zur Wahl stehen fast nur Politiker, die das tun, was die Märkte diktieren. Das zeigen die meisten europäischen Regierungswechsel seit 2008.
Nur auf einer kleinen Insel im Nordatlantik war das anders. Dort durften die Wähler vor ein paar Jahren die Zustimmung zur Übernahme der Bankschulden durch ihren Staat verweigern. Und dort ist das Risiko wenigstens teilweise geblieben, wo es hingehört. Glückliches Island …
Heiner Ganßmann, geboren 1944 in Darmstadt, studierte an der Freien Universität Berlin. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt an der "New School" in New York Ende der 1970er-Jahre trat er 1980 an der Freien Universität die Professur für Soziologie an. Als Wirtschaftssoziologe erforschte er Sozialstaat und Arbeitsmarkt. In der jüngeren Vergangenheit befasst sich Ganßmann zunehmend mit Fragen zur Geld- und Finanzkrise.
Urteil: Commerzbank muss Banker-Boni zahlen
Londoner Investmentbanker sollen Millionen bekommen (Aktuell)
Verdrängtes Risiko
Die unbewussten Grundlagen ökonomischen Handelns (DLF)
Mythos freier Markt
Teil 3 der Serie "Wirtschaftsweise ratlos?" (DLF)
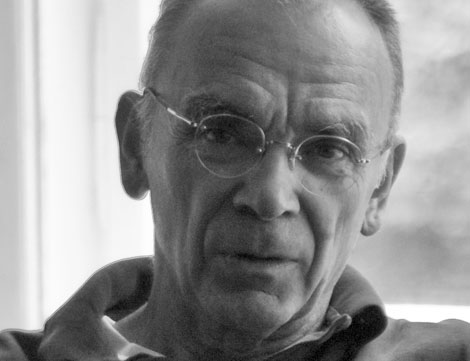
Heiner Ganßmann© privat