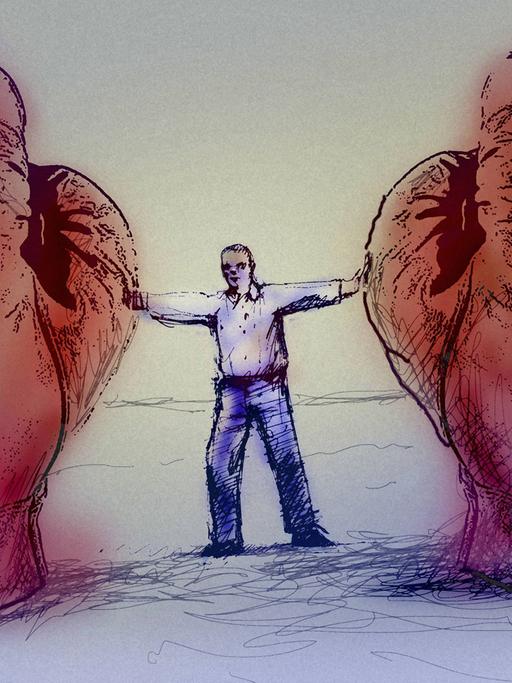Welche Art von Gesellschaft wollen wir?

Seit der Bundestagswahl warten viele darauf, dass die Zeit der angeblich alternativlosen Politik der Großen Koalition endet. Längst schien es so, als sei alles einerlei, rechts wie links. Die Schriftstellerin Katharina Döbler widerspricht dem vehement. Sie fordert ein Umdenken.
Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, verkündete Kaiser Wilhelm im August 1914 – und sämtliche Parteien im deutschen Reichstag, einschließlich der Sozialdemokraten, stimmten für Kriegskredite. Nur eine kleine linksradikale Minderheit um Karl Liebknecht verweigerte sich dem nationalen Begeisterungssturm.
Die Behauptung, es gebe keine Parteien mehr, nur noch gemeinsame Interessen, ist für politische Minderheiten gefährlich. Und für Mehrheiten ohne Interessenvertretung und politischen Einfluss bedeutet sie die Fortsetzung dieses Zustands. Dissidenz zu leugnen, liegt im selbstverständlichen Interesse der Macht.
Auf dem Weg zur Macht geht das Profil verloren
Wenn heute davon die Rede ist, dass die Unterschiede zwischen rechts und links nicht mehr gelten, ist die Frage angebracht, wem solche Behauptungen politisch nützen. Aber zuvor gilt es zu überprüfen, ob oder in wie weit sie stimmen.
Die Tatsache, dass die Macht sich derzeit in der so genannten politischen Mitte konzentriert, hat damit zu tun, dass die Parteien sich da hin definieren, wo sie die meisten Wähler vermuten. Und wie 1914 die Genossen von der SPD sich aufrichtig freuten, nun zu den Deutschen gezählt und kooptiert zu werden – sie, die gerade noch als vaterlandslose Gesellen geschmäht wurden – so neigen alle Parteien seit jeher dazu, auf dem Weg zur Macht ihre Extreme abzulegen und an Profil zu verlieren. Aber das heißt nicht, dass unterschiedliche politische Zielsetzungen einfach verschwinden.
Die zentrale Idee, an der sich Links und Rechts scheiden, ist die Solidarität.
Der Gedanke der Solidarität steckte auch hinter der Verweigerung der linken SPD-Minderheit im Ersten Weltkrieg: Die Proletarier aller Länder sollten zusammenstehen. Sie sollten nicht aufeinander schießen im Dienst der nationalen Kapitalisten, die einander Märkte und Profite abzujagen versuchten.
Linke Theoretiker sind inzwischen selbst vermögend
Diese Solidarität, also Gemeinschaftlichkeit anstelle von Hierarchien, steckt auch als Grundidee hinter dem Schlagwort der sozialen Gerechtigkeit: Der Reichtum der Gesellschaft soll allen zugute kommen, auch denen, die nichts außer ihrer Arbeitskraft besitzen und damit allein keinen Reichtum erwerben können.
Derzeit gibt es in der politischen Landschaft nicht viele, die für dieses Prinzip stehen. Linke Theoretiker von einst sind inzwischen selbst Erben komfortabler Vermögen, die sie in der Praxis keineswegs zu sozialisieren gedenken. Gleichzeitig ist das arbeitende Prekariat in seiner Vereinzelung weit davon entfernt, irgendeine Art von solidarischer Massenorganisation zu bilden.
Neoliberaler Mainstream: Jeder ist sich selbst der Nächste
Im Mainstream der politischen Mitte gilt derzeit das Prinzip, dass jeder möglichst für sich selbst sorgen soll. In der Praxis heißt das, dass jeder zusammenrafft so viel er kann, um sich zu bereichern, aber auch, um sich abzusichern. Dem zugrunde liegt das zutiefst unsolidarische Modell des Neoliberalismus', das wirtschaftspolitisch am offensivsten von der FDP und der AfD vertreten wird. Teile der Grünen, die als Partei in den Komfortzonen des Establishments angekommen sind, tendieren in die selbe Richtung. Es gibt auch auf Seiten der Rechten durchaus eine Sozialpolitik; aber die funktioniert nicht nach einem solidarischen, sondern nach einem paternalistischen Modell, das vor allem die CSU und die Sozialpolitiker der CDU vor sich hertragen: Der Chef sorgt für seine Leute, die Kirche für die Armen, der Mann für Frau und Kinder.
Welche Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich?
Die Unterschiede zwischen links und rechts existieren also nach wie vor, auch wenn im flachen und immer größer werdenden Gebiet der so genannten politischen Mitte eher rechte Ideologien vorherrschen. Die Barrikaden werden an dessen Rändern errichtet: Außerhalb der Mitte liegt das Feindesland des Populismus. Und wenn es gegen die Populisten geht, kennt man keine Parteien mehr, nur noch Demokraten. Die Frage aber, welche Art Gesellschaft wir wollen, wird damit ausgeklammert.