Die Sicherheit und ihr Preis
Wer sich einen Reim auf das sicherheitspolitische Vorgehen von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble machen will, der landet schnell bei dem amerikanischen Psychologen Robert Cialdini. Der entwickelte vor dreißig Jahren das sogenannte Door-in-the-face-Prinzip.
Es wurde ein Grundelement erfolgreicher Verkaufsstrategie und funktioniert folgendermaßen: Der Kunde wird zunächst mit einer Position konfrontiert, die ihm unannehmbar erscheint. Er lehnt erwartungsgemäß ab, doch zugleich steigert sich dadurch seine Bereitschaft, ein leicht verbessertes Angebot, das ihm hernach unterbreitet wird, anzunehmen.
Die Handhabung dieses Prinzips gehört zum Arsenal eines jeden Gebrauchwagen-Händlers. Doch augenscheinlich lassen sich auch Verschärfungen der Sicherheitspolitik so einfacher an den Mann bringen. Ob die Einschränkung der Unschuldvermutung, die gezielte Tötung von Terroristen oder der Militäreinsatz im Inneren, immer rufen die öffentlichen Überlegungen des Innenministers prompt die erwartete Ablehnung der Opposition, des Fachpublikums und der Medien hervor. Im Lichte der allgemeinen Empörung erscheinen die hernach beratenen konkreten Gesetzesmaßnahmen als geradezu angemessen und akzeptabel.
Weil Sicherheit wie kein anderer Politikbereich an ein klares, geradezu dogmatisches Normensystem gebunden ist, schlägt jede Debatte über ihre Veränderung leicht in erregten Dogmatismus um. Apodiktisch werden Sicherheit und Freiheit in einen Gegensatz gesetzt. Wo Schäuble seine terroristischen Drohbilder an die Wand malt, ertönt auf der Gegenseite der Daueralarm, dass der Bürger unter Generalverdacht und Totalüberwachung gestellt werde, der Rechtsstaat auf dem Spiel stünde, es mithin fünf vor zwölf sei.
Seit zwanzig Jahren ist es fünf vor zwölf. Doch keiner will die Zeit zurückdrehen.
Die Einstellung der Bürger zur Sicherheitspolitik und den damit verbundenen Eingriffen des Staates hat sich radikal gewandelt. Wo ehedem Freiheit und Sicherheit parteipolitisch noch klar links und rechts zu verorten wurden, wo sich Hunderttausende gegen eine einfache Volkszählung mobilisieren ließen und das Vorhaben Großer Lauschangriff zu einem empörten Ministerrücktritt führte, sieht sich die Gesellschaft heute weniger vom Staat eingeschränkt, doch zunehmend von Gefahren, die in ihrer Mitte lauern, bedroht. Dabei korrespondiert die Allgegenwart und gleichzeitige Unsichtbarkeit des Terrorismus, deren Sinnbild der vollends assimilierte Schläfer ist, mit der Erfahrung allgemeiner sozialer Desintegration und gestiegener Lebensrisiken.
Die Begriffe Safety und Security, die im Englischen die innere und die soziale Variante beschreiben, verschmelzen im Deutschen zu einem einzigen Begriff Sicherheit. Der Mangel daran kennt nur einen Adressaten: den Staat.
Der kann beides nicht mehr wie früher gewährleisten. Die Globalisierung hat in den letzten zwanzig Jahren den fürsorgenden Sozialstaat zersetzt, die nationalstaatliche Demokratie hat an Autonomie verloren. Dieser Prozess hat auch im Rechtsstaat seine Spuren hinterlassen. Das frühere Ideal, das auch im schwersten Straftäter noch den Bürger erkannte, ihm umfassende Verfahrensrechte zubilligte und ihn als ein resozialisierungsfähiges Mitglied der Gesellschaft ansah, weicht einem Feindbild, dessen sinnfälliger Ausdruck Gesetze sind, die sich schon in ihren Überschriften der Bekämpfung widmen.
Die Grenze zwischen innerer und äußerer Gefährdung verschwimmen ebenso wie die Unterscheidungen der Sicherheitsmaßnahmen, mit denen ihnen begegnet werden soll.
Die Bekämpfungs-Gesetzgebung ist zum Teil symbolisch, in ihr manifestiert sich der Wille des Staates, sei Gewaltmonopol zu verteidigen. Doch auch symbolische Politik hat ihren stabilisierenden Sinn. Und der kann mit dem Verweis auf die vermeintliche Erfolglosigkeit der Maßnahmen nicht einfach ausgehebelt werden. Die liberale Kritik an der Sicherheitspolitik tut sich zudem meist schwer mit dem Nachweis höherer Effizienz der eigenen Vorschläge. Ein redlicher Liberalismus sollte sich dazu bekennen, dass sein Preis ein höheres Risiko ist.
Die Bekämpfungs-Gesetzgebung ist selektiv und selten. Sie trifft kleine Gruppen und kommt weit weniger zur Anwendung, als die bürgerrechtlichen Klagen über Generalverdacht und Überwachungsstaat Glauben machen. Das Maß möglicher Freiheitseinschränkungen ist enorm gewachsen, das der tatsächlichen wenig. Vor allem aber ist das Maß gelebter Freiheit nicht erkennbar gesunken.
Im Volkszählungsurteil von 1983 äußerte das Bundesverfassungsgericht die Befürchtung, dass der überwachte Bürger von seinen Freiheitsrechten keinen Gebrauch mehr machen würde. Diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Offenbar gilt für eine überwiegende Mehrheit der Satz, den der britische Premierminister Gordon Brown angesichts der jüngsten Terroranschläge sagte, auch für die Maßnahmen der Terrorbekämpfung: "Wir lassen uns in unserer Art zu leben nicht erschüttern."
Dieter Rulff, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die "Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte". Ab 1. Januar 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
Die Handhabung dieses Prinzips gehört zum Arsenal eines jeden Gebrauchwagen-Händlers. Doch augenscheinlich lassen sich auch Verschärfungen der Sicherheitspolitik so einfacher an den Mann bringen. Ob die Einschränkung der Unschuldvermutung, die gezielte Tötung von Terroristen oder der Militäreinsatz im Inneren, immer rufen die öffentlichen Überlegungen des Innenministers prompt die erwartete Ablehnung der Opposition, des Fachpublikums und der Medien hervor. Im Lichte der allgemeinen Empörung erscheinen die hernach beratenen konkreten Gesetzesmaßnahmen als geradezu angemessen und akzeptabel.
Weil Sicherheit wie kein anderer Politikbereich an ein klares, geradezu dogmatisches Normensystem gebunden ist, schlägt jede Debatte über ihre Veränderung leicht in erregten Dogmatismus um. Apodiktisch werden Sicherheit und Freiheit in einen Gegensatz gesetzt. Wo Schäuble seine terroristischen Drohbilder an die Wand malt, ertönt auf der Gegenseite der Daueralarm, dass der Bürger unter Generalverdacht und Totalüberwachung gestellt werde, der Rechtsstaat auf dem Spiel stünde, es mithin fünf vor zwölf sei.
Seit zwanzig Jahren ist es fünf vor zwölf. Doch keiner will die Zeit zurückdrehen.
Die Einstellung der Bürger zur Sicherheitspolitik und den damit verbundenen Eingriffen des Staates hat sich radikal gewandelt. Wo ehedem Freiheit und Sicherheit parteipolitisch noch klar links und rechts zu verorten wurden, wo sich Hunderttausende gegen eine einfache Volkszählung mobilisieren ließen und das Vorhaben Großer Lauschangriff zu einem empörten Ministerrücktritt führte, sieht sich die Gesellschaft heute weniger vom Staat eingeschränkt, doch zunehmend von Gefahren, die in ihrer Mitte lauern, bedroht. Dabei korrespondiert die Allgegenwart und gleichzeitige Unsichtbarkeit des Terrorismus, deren Sinnbild der vollends assimilierte Schläfer ist, mit der Erfahrung allgemeiner sozialer Desintegration und gestiegener Lebensrisiken.
Die Begriffe Safety und Security, die im Englischen die innere und die soziale Variante beschreiben, verschmelzen im Deutschen zu einem einzigen Begriff Sicherheit. Der Mangel daran kennt nur einen Adressaten: den Staat.
Der kann beides nicht mehr wie früher gewährleisten. Die Globalisierung hat in den letzten zwanzig Jahren den fürsorgenden Sozialstaat zersetzt, die nationalstaatliche Demokratie hat an Autonomie verloren. Dieser Prozess hat auch im Rechtsstaat seine Spuren hinterlassen. Das frühere Ideal, das auch im schwersten Straftäter noch den Bürger erkannte, ihm umfassende Verfahrensrechte zubilligte und ihn als ein resozialisierungsfähiges Mitglied der Gesellschaft ansah, weicht einem Feindbild, dessen sinnfälliger Ausdruck Gesetze sind, die sich schon in ihren Überschriften der Bekämpfung widmen.
Die Grenze zwischen innerer und äußerer Gefährdung verschwimmen ebenso wie die Unterscheidungen der Sicherheitsmaßnahmen, mit denen ihnen begegnet werden soll.
Die Bekämpfungs-Gesetzgebung ist zum Teil symbolisch, in ihr manifestiert sich der Wille des Staates, sei Gewaltmonopol zu verteidigen. Doch auch symbolische Politik hat ihren stabilisierenden Sinn. Und der kann mit dem Verweis auf die vermeintliche Erfolglosigkeit der Maßnahmen nicht einfach ausgehebelt werden. Die liberale Kritik an der Sicherheitspolitik tut sich zudem meist schwer mit dem Nachweis höherer Effizienz der eigenen Vorschläge. Ein redlicher Liberalismus sollte sich dazu bekennen, dass sein Preis ein höheres Risiko ist.
Die Bekämpfungs-Gesetzgebung ist selektiv und selten. Sie trifft kleine Gruppen und kommt weit weniger zur Anwendung, als die bürgerrechtlichen Klagen über Generalverdacht und Überwachungsstaat Glauben machen. Das Maß möglicher Freiheitseinschränkungen ist enorm gewachsen, das der tatsächlichen wenig. Vor allem aber ist das Maß gelebter Freiheit nicht erkennbar gesunken.
Im Volkszählungsurteil von 1983 äußerte das Bundesverfassungsgericht die Befürchtung, dass der überwachte Bürger von seinen Freiheitsrechten keinen Gebrauch mehr machen würde. Diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Offenbar gilt für eine überwiegende Mehrheit der Satz, den der britische Premierminister Gordon Brown angesichts der jüngsten Terroranschläge sagte, auch für die Maßnahmen der Terrorbekämpfung: "Wir lassen uns in unserer Art zu leben nicht erschüttern."
Dieter Rulff, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Vom März 2002 bis Ende 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die "Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte". Ab 1. Januar 2006 Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
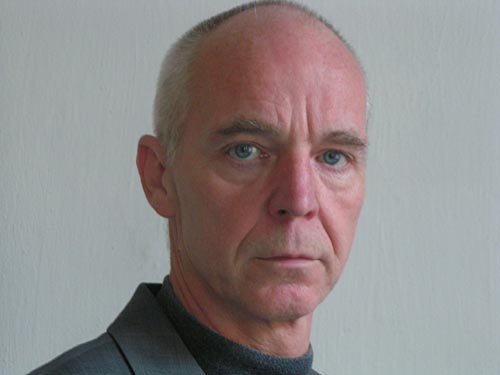
Dieter Rulff© privat