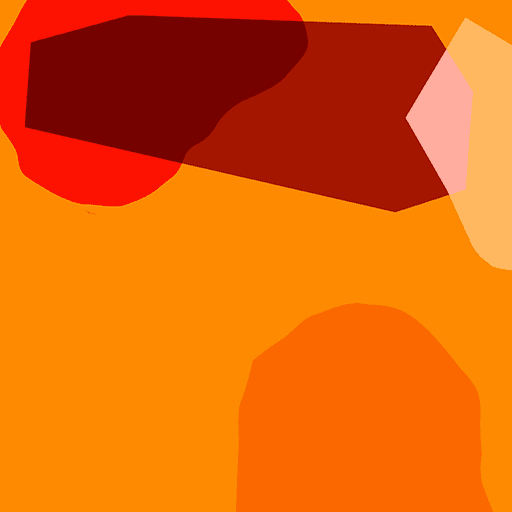Die Sachlichkeit des Herzens
Kurt Sanderlings 100. Geburtstag wäre in den Herbst dieses Jahres gefallen. Er war der letzte Vertreter seiner Generation, der noch aktiv dirigierte: sein Abschiedskonzert gab er im Mai 2002 beim Berliner Sinfonie-Orchester, das er während der 60er und 70er-Jahre zu einem auch international zunehmend beachteten Ensemble geformt hatte.
Vor wenigen Monaten starb mit Kurt Sanderling der letzte Überlebende jenes legendären Dirigentenjahrgangs 1912, dem sich die ersten Folgen der diesjährigen "Interpretationen" widmen. Sanderling, dessen 100. Geburtstag in den Herbst dieses Jahres gefallen wäre, war auch der letzte Vertreter seiner Generation, der noch aktiv dirigierte: sein Abschiedskonzert gab er im Mai 2002 beim Berliner Sinfonie-Orchester, das er während der 60er und 70er-Jahre zu einem auch international zunehmend beachteten Ensemble geformt hatte.
Dieser Aspekt seiner Arbeit spielt in Jan Brachmanns Sendung eine ebensolche Rolle wie die danach beginnende Alterskarriere des Dirigenten und jene Zeit, die die Grundlage für beides gelegt hatte: die Jahre seines Exils in der Sowjetunion, wohin er durch die nazistische Judenverfolgung gezwungen worden war. Dort, an der Seite des legendären Jewgenij Mrawinski in Leningrad, lernte er nicht nur Dmitri Schostakowitsch kennen, zu dessen kompetentem Sachwalter er fortan wurde, sondern lebte sich überhaupt so tief wie sonst kaum ein anderer nicht-slawischer Dirigent in die Welt der russischen Sinfonik ein.
Von dort wiederum ergaben sich Brücken und Rückbindungen zu Gustav Mahler und Jean Sibelius – zwei Komponisten, für deren Durchsetzung er in seinen späteren DDR-Jahren eine Pionierrolle spielte und die Sanderlings tiefe Liebe zu den Klassikern zwischen Mozart und Brahms ins 20. Jahrhundert hinein erweiterten. Brachmann, der den Künstler in seinen letzten Jahren noch persönlich kennenlernte, zeichnet das Bild eines engagierten, integeren und dabei klug wägenden Zeitgenossen, dessen Arbeit von der "Sachlichkeit des Herzens" geprägt war.
Dieser Aspekt seiner Arbeit spielt in Jan Brachmanns Sendung eine ebensolche Rolle wie die danach beginnende Alterskarriere des Dirigenten und jene Zeit, die die Grundlage für beides gelegt hatte: die Jahre seines Exils in der Sowjetunion, wohin er durch die nazistische Judenverfolgung gezwungen worden war. Dort, an der Seite des legendären Jewgenij Mrawinski in Leningrad, lernte er nicht nur Dmitri Schostakowitsch kennen, zu dessen kompetentem Sachwalter er fortan wurde, sondern lebte sich überhaupt so tief wie sonst kaum ein anderer nicht-slawischer Dirigent in die Welt der russischen Sinfonik ein.
Von dort wiederum ergaben sich Brücken und Rückbindungen zu Gustav Mahler und Jean Sibelius – zwei Komponisten, für deren Durchsetzung er in seinen späteren DDR-Jahren eine Pionierrolle spielte und die Sanderlings tiefe Liebe zu den Klassikern zwischen Mozart und Brahms ins 20. Jahrhundert hinein erweiterten. Brachmann, der den Künstler in seinen letzten Jahren noch persönlich kennenlernte, zeichnet das Bild eines engagierten, integeren und dabei klug wägenden Zeitgenossen, dessen Arbeit von der "Sachlichkeit des Herzens" geprägt war.